
Die zentrale Konfliktlinie verläuft heute zwischen der offenen Gesellschaft und den diversen Spielarten des Gemeinschaftsradikalismus. Die Herausforderung lautet, den rasanten Wandel der globalen Moderne mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Sicherheit in Einklang zu bringen.
Es war einmal eine Zeit, da schien die ganze Welt auf einem gemeinsamen Weg in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft zu sein. Die einen waren schon weit vorangeschritten, die anderen beeilten sich aufzuschließen. Künftig würde es keine konkurrierenden wirtschaftlichen und politischen Systeme geben, nur noch verschiedene Spielarten des liberalen Kapitalismus. Die am Ende des Zweiten Weltkriegs besiegelte Teilung Europas war endlich überwunden. Handelsbarrieren fielen, die Weltwirtschaft boomte, Computer und Internet begannen ihren Siegeszug. Es war ein Zeitalter der Zuversicht.
Was heute wie ein Märchen klingt, war in den 90er Jahren die vorherrschende Stimmung in Europa und den USA. Man kann die Diskrepanz zwischen damals und heute an zwei Bestsellern festmachen: 1992 erschien Francis Fukuyamas «The End of History and the Last Man». Seine Kernthese lautete, dass mit dem Kollaps des «sozialistischen Weltsystems» alle Gegensätze in eine große Konvergenz münden werden. Ende der Geschichte hieß Ende der Systemkonkurrenz. Die Kombination aus einem sozial temperierten Kapitalismus und liberaler Demokratie war das finale Stadium der Geschichte. Ihr entsprach die Hegemonie der USA als Weltordnungsmacht, die für die Einhaltung der Spielregeln sorgte.
Ein Jahr später veröffentlichte Samuel Huntington seinen nicht minder berühmt gewordenen Essay «The Clash of Civilizations?» (in der späteren Buchausgabe fehlte das Fragezeichen). Huntington ist der Anti-Fukuyama. Folgt man ihm, so stehen wir nicht vor einem Zeitalter ewigen Friedens, in dem sich alle Welt dem westlichen Modell annähert, sondern vor einem weltweiten Zusammenprall der Kulturen entlang alter, religiös eingefärbter Konfliktlinien. Statt der universellen Ausbreitung westlicher Werte sagte er eine Rückbesinnung eigenständiger Zivilisationen auf ihre spezifischen Wertvorstellungen voraus. Der Westen (Nordamerika und Westeuropa) werde künftig von anderen Machtzentren herausgefordert: von China, Russland (als Zentrum der slawisch-orthodoxen Welt), Indien und dem islamischen Kulturkreis. Auf den kurzen unipolaren Moment amerikanischer Hegemonie folgt eine multipolare Weltordnung.
In Deutschland wurde Huntington für seine Kulturkampf-Thesen heftig geprügelt, insbesondere wegen seiner Überhöhung kulturell-religiöser Traditionen zu bestimmenden Faktoren von Weltgeschichte und Weltpolitik. Seine Prämisse, dass die Weltereignisse von rivalisierenden Zivilisationen geprägt werden, die ihren eigenen Gesetzen folgen, ist eine klassische Gegenposition zur Idee einer globalen, als schrittweise Verwestlichung der Welt gedachten Moderne. Sie zielt auf die Aufteilung der Welt in ethnisch und kulturell definierte Großräume, die jeweils von einer dominierenden Großmacht geführt werden. Die Welt ist plural, aber die konkurrierenden Zivilisationen sind in sich homogen. Sie folgen einer je eigenen Leitkultur, die tief in die Geschichte zurückreicht und eine unverwechselbare Identität begründet. Die Stoßrichtung dieser Sorte von Ideologien ist klar. Ihr Feind ist die Globalisierung in allen Dimensionen. Sie verteidigen eisern das Prinzip der nationalen Souveränität; sie wenden sich gegen die universelle Geltung demokratischer Werte; sie verabscheuen die Globalisierung des westlichen Lebensstils; sie lehnen den Freihandel ab und bekämpfen die transnationale Migration.
Autoritarismus oder Demokratie
Mir liegt es fern, Huntington in die sumpfige Ecke des Ethnopluralismus zu schieben. Er hat früher als andere die Wiederkehr identitärer Politik auf die Weltbühne gesehen – und damit die Rückkehr antagonistischer Konflikte, die Fukuyama schon aus der Geschichte verbannen wollte. Und er machte sich keine Illusionen über die große Kräfteverschiebung in der Weltpolitik. China, Indien, Iran, die Türkei oder Russland waren bis zum Siegeszug des europäisch-amerikanischen Imperialismus stolze Großmächte. Heute streben sie wieder nach Weltgeltung und regionaler Hegemonie. Das ist mit einem relativen Machtverlust des Westens verbunden. Er wird nicht nur wirtschaftlich und politisch von den alt-neuen Mächten herausgefordert, sondern auch normativ. China steht für ein selbstbewusstes Modell autoritärer Modernisierung: ökonomische Liberalisierung in Grenzen, aber keine Lockerung des Machtmonopols der Funktionärsaristokratie. Russland ist heute zum Hauptquartier einer neuen antiliberalen Internationale geworden, deren gemeinsamer Nenner ihr Antiamerikanismus, ihre Aversion gegen die Europäische Union, gegen offene Grenzen und offene Märkte ist. Der Iran ist das Zentrum des schiitischen Fundamentalismus und die Türkei driftet in Richtung einer autoritären Fassadendemokratie. Sie alle setzen der liberalen Moderne ihr eigenes Narrativ entgegen. Insofern sind wir tatsächlich mit einem globalen Kulturkampf konfrontiert.
Allerdings findet dieser «clash of civilizations» nicht nur zwischen den großen geopolitischen Blöcken statt, sondern wird in ihnen ausgetragen. Der Kampf zwischen freiheitlichen und autoritären, modernen und antimodernen Kräften wird in China ebenso ausgetragen wie in arabischen Ländern, in Russland und in der Türkei. Parallel wird das Projekt der liberalen Moderne – also jene Kombination aus Menschenrechten, Demokratie und kulturellem Pluralismus, die sich seit der Aufklärung in Europa entwickelte – auch innerhalb des Westens infrage gestellt. Auch das ist nicht neu – man muss nur daran erinnern, dass die beiden radikalen Gegenbewegungen zur liberalen Moderne, Kommunismus und Faschismus, europäische Erfindungen waren.
Nein, die Geschichte wiederholt sich nicht, und man sollte vorsichtig mit historischen Parallelen umgehen. Die bundesdeutsche Demokratie ist ungleich stabiler, als es die Weimarer Republik je war. Das gilt auch für die Lage in Europa. Aber auch wir sind nicht gefeit gegen die Rückkehr antidemokratischer Strömungen. In vielen europäischen Ländern erfassen sie bereits zwanzig bis dreißig Prozent des Wahlvolks. Ihr gemeinsamer Nenner sind die Verachtung der liberalen Demokratie und der Ruf nach direkter Volksherrschaft, der Rückzug in die nationale Wagenburg, die Verteidigung einer fiktiven kulturellen Homogenität, die Beschwörung von Familie, Volk und Staat als Solidargemeinschaft gegen ein bedrohliches Außen. Das alles trifft sich in einem tief sitzenden Antiamerikanismus, der aus allen Poren und Ritzen quillt.
Die neuen gesellschaftlichen Fronten
Derlei regressive Tendenzen sind keineswegs auf die Milieus der Modernisierungsverlierer und sozial Abgehängten beschränkt. Die neue Qualität der antiliberalen Revolte besteht gerade darin, dass sie sich horizontal wie vertikal ausbreitet. Sie erfasst auch gutbürgerliche Kreise und Teile der Linken. Der «Wutbürger» ist in der Regel gut ausgebildet, geht einem anerkannten Beruf nach und zählt nicht zu den Ärmsten. Noch geht es ihm gut, aber er spürt den Boden unter seinen Füßen wanken. Wirtschaftlich empfindet er wachsende Konkurrenz und Leistungsdruck. Kulturell fühlt er sich bedrängt von der Krise des Patriarchats, dem Verlust männlicher Rollensicherheit, dem offensiven Auftreten von Schwulen und Lesben und der Einwanderung aus islamischen Ländern. Er pflegt den Eindruck, dass für alles und alle Geld da ist, bloß nicht für ihn und seine Anliegen. Er fühlt sich von «denen da oben» im Stich gelassen und gegängelt. Ihm passt die ganze Richtung nicht.
Seit der großen Wende von 1989/90 hat sich das Tempo politischer, technischer, sozialer Veränderungen enorm beschleunigt. Mit der Globalisierung wächst auch die Krisenanfälligkeit. Zwischen der Dynamik globaler Märkte und der Steuerungsfähigkeit internationaler Politik klafft eine riskante Lücke. Die Finanzkrise von 2008 ff. hat die Verwundbarkeit der Weltwirtschaft schlagartig offengelegt. Zugleich hat sie das Vertrauen in die Institutionen erschüttert. «Bankenrettung» wurde zum Symbol für die Abwälzung der Krisenlasten auf die arbeitende Bevölkerung. Die gering Qualifizierten geraten immer stärker unter Druck, in den Mittelschichten wächst die Verunsicher-ung. Teile der Bevölkerung fühlen sich politisch nicht mehr repräsentiert. Die Vertreter/innen der kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Eliten, die sie im Fernsehen sehen, schauen eher mit Verachtung auf diejenigen herab, die mit europäischer Integration, Multikulti und LGBTI nichts am Hut haben. Das ist der Boden, auf dem antili-berale Parteien und Bewegungen gedeihen.
Die Moderne erzeugt ihre eigene Opposition
Dass die Globalisierung radikale Gegenbewegungen auf den Plan ruft, verwundert nicht. Jede neue Stufe der Moderne erzeugt Ängste und Abwehr, von der Dampfmaschine bis zur digitalen Revolution. Die wissenschaftlich-technische Entzauberung der Welt ruft die Romantik hervor, die Säkularisierung den religiösen Fundamentalismus, die fortschreitende Individualisierung weckt die Sehnsucht nach Gemeinschaft, der globale Wettbewerb den Ruf nach dem protektionistischen Staat. Der springende Punkt ist, dass die Moderne ihre Opposition aus sich selbst heraus erzeugt. Dieser Konflikt zieht sich bis ins Bewusstsein der Einzelnen.
Die meisten Menschen haben ein gespaltenes Verhältnis zur Moderne. Wir nutzen die Bildungs- und Aufstiegschancen einer sozial durchlässigen Gesellschaft, reklamieren unsere individuelle Freiheit und schätzen die Vielfalt möglicher Lebensformen, kommunizieren mit aller Welt, sind global unterwegs, nehmen Anteil an der internationalen Kunst, Musik und Literatur und erwarten selbstverständlich, im Ernstfall nach den modernsten Erkenntnissen der medizinischen Forschung behandelt zu werden. Gleichzeitig gibt es eine anschwellende Begleitmusik von Artikeln, Büchern und Konferenzen, die mit diesen oder jenen Tendenzen der Moderne hadern. Die Botschaften sind uns vertraut: Befreiung vom Überfluss, Ausstieg aus der Leistungskonkurrenz, Entschleunigung des Lebens, Sein statt Haben. Das alles ist Teil jener permanenten Selbstkritik, die zur «reflexiven Moderne» gehört. Der Witz besteht darin, dass die Kombination von Demokratie und Kapitalismus jede Opposition in Innovation verwandelt und sich auf diese Weise ständig erneuert. Allerdings kann man nicht beides haben: die Dynamik der Moderne stilllegen und zugleich die Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen Zivilisation festhalten. Das eine ist die Kehrseite des anderen.
Die zentrale politische Konfliktlinie verläuft heute nicht mehr zwischen rechts und links, sondern zwischen offener Gesellschaft und den diversen Spielarten des Gemeinschaftsradikalismus. Unter diesem Begriff fasste der Philosoph Helmut Plessner schon Anfang der 20er Jahre die faschistische und kommunistische Fundamentalopposition gegen die liberale Moderne. Die Gegensätze von damals finden sich heute wieder: politische und kulturelle Vielfalt oder Gleichschaltung der Gesellschaft, Parlamentarismus oder Volksdemokratie, kosmopolitische Öffnung oder nationale Schließung, politischer Pluralismus oder autoritäre Führung. Wenn wir die offene Gesellschaft verteidigen wollen, reicht es nicht aus, die Werte von Freiheit und Demokratie zu beschwören. Die entscheidende Herausforderung lautet, den rasanten Wandel, den die globale Moderne mit sich bringt, mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Sicherheit in Einklang zu bringen. Das erfordert zum einen den Ausbau der «Global Governance», also der Krisenprävention und des Krisenmanagements auf supranationaler Ebene. Zum anderen geht es um Strategien, die den sozialen Zusammenhalt stärken und den Einzelnen befähigen, souverän mit dem permanenten Wandel umzugehen.
Es wäre ein schwerer Fehler, Freiheit und Sicherheit gegeneinander auszuspielen. Absolute Sicherheit kann keine Gesellschaftsform garantieren. Aber halbwegs stabile Lebensumstände sind eine Bedingung für die Ausübung der Freiheit. Wer von ständiger Angst vor sozialem Absturz oder vor willkürlicher Gewalt geplagt wird, ist nicht frei, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. In einer hoch komplexen Gesellschaft ist die Freiheit des Einzelnen an institutionelle Voraussetzungen gebunden: Rechtsstaatlichkeit, öffentliche Sicherheit, ein gut ausgebautes Bildungssystem, Rückversicherung gegen Arbeitslosigkeit und Krankheit etc. Die öffentlichen Institutionen sind der Stabilitätsanker in einer Welt rapider Veränderungen. Wer die liberale Demokratie bewahren will, muss nicht nur die individuelle Freiheit verteidigen, sondern die Institutionen stärken, die das Rückgrat der demokratischen Republik bilden.
Der Beitrag ist zuerst in unserem Böll.Thema 2/2016 "Die große Verunsicherung - Die Krise der liberalen Moderne" erschienen.
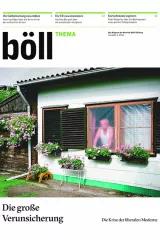
![Skulptur Großer Dialog, Draht, Metall, Stoff, Epoxidharz, roter Lack, Größe 145x190x83 cm By Karel Nepraš (Národní galerie v Praze) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons](/sites/default/files/styles/3d2_small/public/uploads/2016/09/dialog.png.jpg?itok=LHb9wTwr)