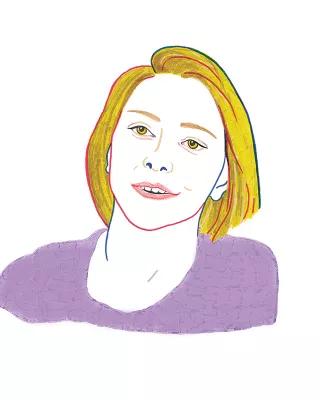Johanna Roth: Frau Belin, was ist derzeit die größte Herausforderung für liberale Demokratien?
Sie sind von zwei Seiten gleichzeitig herausgefordert: Von innen und von außen. Von außen, weil der Wettbewerb mit autoritären Staaten wie China zunimmt. Das zeigt sich gerade in der Corona-Krise, weil sie Staaten auf die Probe stellt: Welches Modell ist anpassungsfähiger, das autoritäre oder das libertäre? Und dann gibt es die Spannung von innen. Wir haben kürzlich zwei – beziehungsweise drei, wenn man den Brexit mitzählt – interessante Wahlen gesehen: Die von Donald Trump einerseits und die von Emmanuel Macron, der quasi aus der Asche des französischen Parteiensystems gestiegen ist, andererseits. Statt eines Systems von vier oder fünf Parteien dominierte im jeweiligen Land plötzlich eine neue, populistische Bewegung den öffentlichen Diskurs. Während der Finanzkrise vor zehn Jahren wurden die liberalen Demokratien des Westens in ihrem Kern erschüttert, und das hat dieses Gleichgewicht zerstört.
Wie beeinflussen diese Entwicklungen die transatlantischen Beziehungen?
Auch das zeigt sich am Beispiel der Coranakrise. Partnerschaften und Machtbalancen sollten eigentlich gut funktionieren. Was wir aber sehen, ist ein enormer Rückgang an Führungsstärke der USA. Für Trump ist jeder ein potentieller Feind. Er hat gar nicht erst den Anspruch, ein Bündnis zu führen, er verweigert sich völlig. Auf der anderen Seite steht eine EU, die unfähig zur Solidarität scheint, der Spanien und Italien verlorengehen. In der Außenpolitik verschieben sich gerade Welten. Denn wer das Machtvakuum füllen wird, das Trump mit seiner Nicht-Außenpolitik geschaffen hat, liegt auf der Hand: China.
Donald Trump befürwortet den Brexit und hat sich in der Vergangenheit auch mit Marine Le Pen freundschaftlich getroffen. Woher kommt diese «transatlantische Populismusallianz»?
Trump, Farage, Le Pen oder auch Salvini – sie alle sind das, was wir «populistische Nationalisten» nennen und haben denselben Hintergrund: Die Krise der demokratischen Institutionen, bedingt durch sozioökonomische Faktoren. Nicht nur sind etwa Parteien oder Gewerkschaften nicht mehr repräsentativ, sie verschwinden einfach. Mit steigender Globalisierung erfüllen sie ihren Daseinszweck nicht mehr. Frankreich ist ein Beispiel, aber in den USA sieht man eine noch krassere Entwicklung, auch wirtschaftlich. Die Löhne steigen viel zu langsam, die Preise umso mehr. Von Altersvorsorge ganz zu schweigen. Deshalb leiden gerade die Menschen in den USA furchtbar unter der Corona-Krise. Allerdings wird auch Trump diese Krise politisch nicht unbeschadet überstehen. Sie wird zu sehr an ihm haften bleiben, als dass er die Wahl noch mal so einfach gewinnen könnte wie 2016.
Wo haben die Parteien links der Mitte versagt? Die US-Demokraten haben ja eine ähnliche Entfremdung hinter sich wie die französischen Sozialisten oder die SPD.
Sie haben den richtigen Moment zur Radikalisierung verpasst, nach der Finanzkrise 2008. Damals hatten sie mehrheitlich das Problem, dass sie in der Regierungsverantwortung waren. Sie entschieden sich deshalb für den Weg der Vernunft und legten sich eine Erzählung zurecht, nach der es ihnen unmöglich gewesen sei, die Veränderungen durchzusetzen, die es gebraucht hätte, um die sozialen und politischen Zustände zu verhindern, die wir heute haben.
In den USA wird noch in diesem Jahr gewählt, in Deutschland nächstes Jahr, in Frankreich im übernächsten. Was ist nötig, um die Wählerinnen und Wähler der Populisten zurückzugewinnen?
Für die Demokraten geht es vor allem darum, Nichtwähler zu mobilisieren. Denn die Republikaner gewinnen immer dann, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist. Vor allem aber müssen die Demokraten aufhören, so zu tun, als sei die Wahl 2016 ein Unfall gewesen. Die US-Präsidentschaftswahl könnte auch eine Art Blaupause für zukünftige Wahlen in Europa sein: Wir haben eine klare populistische Strömung, die im politischen Establishment angekommen ist und der ein progressives Gegenangebot gegenübersteht. Klingt bedrückend, aber es bietet auch die Chance, stärker in die Offensive zu gehen und wieder klarzumachen, wofür man steht. Um die gesellschaftliche Spaltung zu bekämpfen, brauchen wir Instrumente, die Antworten auf möglichst viele Fragen geben. Der Green New Deal, für den sich Bernie Sanders eingesetzt hat, ist ein gutes Beispiel, weil er die ökologische mit der sozialen Frage verbindet. Aber auch die aktuelle Krise bietet progressiven Kräften die Gelegenheit, Prioritäten neu zu setzen.
Célia Belin ist Gastprofessorin beim Center on the United States and Europe bei der Brookings Institution, einem Thinktank mit Sitz in Washington, D.C. Zuvor war sie u.a. als Beraterin des französischen Außenministeriums tätig.
Johanna Roth berichtet als freie Korrespondentin aus den USA, u.a. für Zeit-Online.