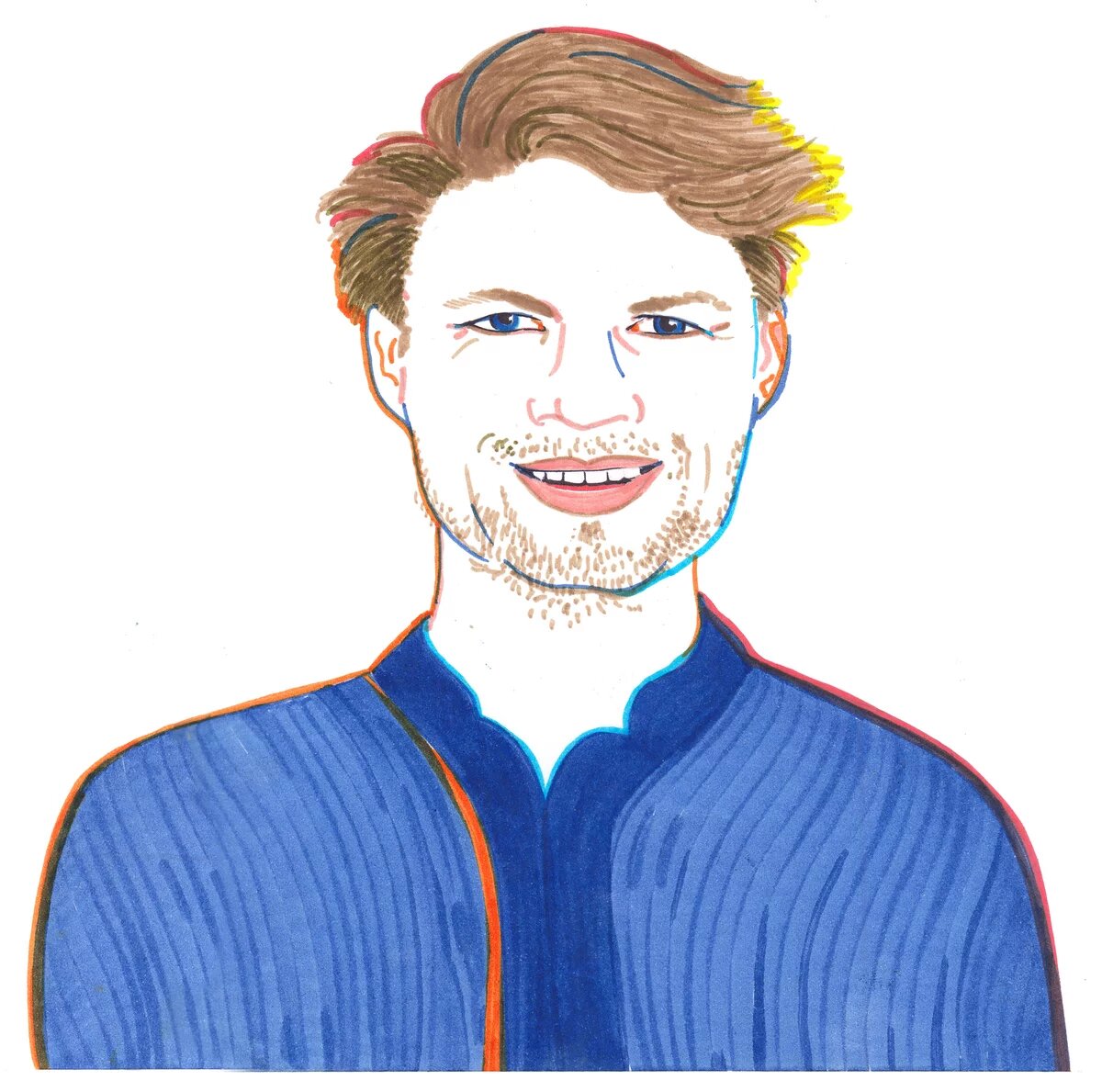Tommi Winkler: Frau Urbatsch, Herr Steuernagel, Sie beide werden in der Presse als „Sozialunternehmer“ bezeichnet, weil Sie tätig sind in einem Bereich, den man „social economy“ nennt. Was ist das eigentlich?
Katja Urbatsch (KU): Das ist ein weites Feld, das auch unter dem Begriff „social entrepeneurship“ zusammengefasst wird. Dahinter steht eine Bewegung, die sagt: Wir wollen keine nur finanzielle Profitorientierung, sondern auch sozialen Profit erwirtschaften. Schlussendlich geht es darum, die Gesellschaft anders zu gestalten: sozialer, nachhaltiger, lebenswerter. Das sind Ziele, an denen etwa Klimaaktivist*innen arbeiten, aber auch gemeinnützige Organisationen wie meine. ArbeiterKind.de hätte sich früher vermutlich als Verein organisiert, jetzt aber sind wir ein Sozialunternehmen, das dynamischer sein kann und versucht, soziale Probleme mit unternehmerischem Spirit zu lösen.
Armin Steuernagel (AS): Das Schöne an dem Begriff „social entrepeneurship“ ist, dass er den Begriff Unternehmer nicht allein der Gewinnmaximierung überlässt – und damit die Eigeninitiative, ein Nicht-auf-den-Staat-Warten, eine Einfach-mal-tun-Lebenseinstellung unabhängig von eigennützigen Motiven macht. Allerdings störe ich mich an dem Begriff auch manchmal, weil ich denke, dass jedes Unternehmertum eigentlich sozial ist. Denn selbst wenn ich Autos herstelle, tue ich das ja nicht für mich, sondern eigentlich für andere. Zum Problem wird es, wenn ich nur noch den „shareholder value“ maximieren will.
Sehen Sie Unternehmertum auch generell so positiv, Frau Urbatsch?
KU: Grundsätzlich finde ich auch, dass Unternehmertum nichts Schlechtes ist. Da steckt ja drin: Ich bin aktiv, ich habe eine Idee, ich will gestalten. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit dieses Unternehmertum nur auf den eigenen Profit oder auch auf andere Ziele ausgerichtet ist. Beim Verkaufen von Autos wirds aber schon schwierig, da gehts nun mal vor allem um finanziellen Profit.
AS: Das muss ja nicht so sein. Auch ein Autohersteller kann seinen Betrieb so aufstellen, dass es ihm gar nicht mehr um seine maximalen Gewinne geht, sondern darum, die besten Fortbewegungsmittel zu produzieren – heute also welche, die auch den Umweltschutz beachten.
KU: Es kommt eben darauf an, welche Autos produziert werden. Ich glaube jedenfalls nicht an die „invisible hand“.
Die „unsichtbare Hand“ des Ökonomen Adam Smith, der glaubte, dass ein möglichst freier Markt schon alles zum Besten des Gemeinwohls regeln würde.
AS: Die „invisible hand“ von Adam Smith ist nicht nur eine jener Ideen, die von der Wirklichkeit nachhaltig widerlegt wurden, sondern auch gefährlich. Selbst ein Experte wie Michael Hüther, der als Direktor des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft des Sozialismus unverdächtig ist, schreibt im Handelsblatt, dass die Idee, moralfreie Unternehmen würden dank der „invisible hand“ und klarer staatlicher Regeln schlussendlich moralisch wirtschaften, nicht funktioniert – vor allem nicht in globalen und digitalen Märkten – und dass wir deshalb nicht weiter die Moral an den Staat outsourcen können. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Idee, dass wir Moral wieder in die Betriebe einsourcen müssen, sich mehr und mehr durchsetzt. Das heißt nicht, dass ich ein neues Moralaposteltum fordere – im Gegenteil. Mir geht es um freies Unternehmertum, das die Folgen seines Handelns, die Externalitäten, einfach mitbedenkt, statt auf den Staat zu warten, der das Chaos hinter uns dann schon beseitigt.
Frau Urbatsch, Sie helfen mit ArbeiterKind.de Menschen aus nichtakademischen Milieus beim sozialen Aufstieg. Herr Steuernagel, Sie beraten Betriebe, die soziale Verantwortung übernehmen wollen. Kann man sagen, dass Sie das Thema Eigenverantwortung zwar ähnlich sehen, aber mal von unten und mal von oben angehen?
AS: Ja, das sind zwei unterschiedliche Wege. Frau Urbatsch versucht Menschen auf individueller Ebene zu fördern. Wir versuchen eine neue Rechtsform für Unternehmen in die Welt zu bringen, um Verantwortungseigentum möglich zu machen. Normalerweise muss ich ein Unternehmen kaufen oder in die richtige Familie hineingeboren sein, um das Geschäft zu übernehmen. Aber wir wollen, dass Teilhabe an einem Unternehmen möglich wird, unabhängig von genetischer Herkunft und Finanzkraft. Das stärkt die Eigeninitiative.
KU: Ja, wir wollen empowern, aber wir denken nicht nur von unten. Wir versuchen auch, die Strukturen zu verändern, Druck auf die Politik zu machen, sie für die Probleme von jungen Menschen aus Familien ohne Hochschultradition zu sensibilisieren und zwischen den Milieus zu vermitteln. Denn das große Kapital, das unsere Studierenden der ersten Generation mitbringen, ist ihre Erfahrung, die sie aus anderen Schichten in akademische Milieus einbringen. Dass im vergangenen Jahr soziale Herkunft als siebte Diversity-Dimension in die Charta der Vielfalt aufgenommen wurde, war für uns ein riesiger Erfolg.
Sie beide appellieren an die Eigenverantwortung. Warum übernehmen nicht mehr Menschen diese Verantwortung für sich – und dann auch für andere?
KU: Ich glaube, man muss Menschen erst einmal in die Position bringen, Eigenverantwortung übernehmen zu können. Wer um seine Existenz kämpft, hat keine Kapazitäten, sich noch zu engagieren. Aber daran, wie viele Menschen sich im Ehrenamt engagieren, sieht man ja, dass die Bereitschaft grundsätzlich vorhanden ist. Ich glaube allerdings, dass das Ehrenamt nicht mehr wie früher funktioniert, weil vor allem junge Leute sich heute flexibler engagieren und schneller etwas erreichen wollen. Darauf gründet auch der Erfolg von ArbeiterKind.de, weil sich bei uns Menschen in flachen Strukturen auch kurzzeitig engagieren können.
AS: Ich denke aber auch, dass die Struktur der Erwerbsarbeit wichtig ist: Wenn ich mich täglich von 9 bis 17 Uhr an starren Strukturen und formalen Hierarchien ohne Möglichkeit zur Eigeninitiative abarbeiten muss, fehlt mir höchstwahrscheinlich auch danach die Lust an Eigeninitiative. Aber nicht nur die Arbeitswelt ist das Problem, sondern das fängt schon viel früher an. Schon in der Schule werden wir oftmals darauf programmiert, Tests zu schreiben und Erwartungen zu erfüllen, die andere irgendwann einmal festgelegt haben – Stichwort Zentralabitur –, anstatt zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen: Was ist da draußen in der Welt los? Welche Fragen müssen wir lösen? Wo liegen die Probleme?
Ist die Bildungspolitik also der entscheidende Hebel, um Eigenverantwortung und -initiative in diesem Land zu stärken?
AS: Ja, und wenn Sie mich fragen, was die Politik ganz konkret tun kann: Abitur abschaffen. Oder noch radikaler: Noten abschaffen. Es ist doch längst wissenschaftlich erwiesen, dass Noten nur zu gehorsamen, frustrierten Menschen führen. Anstatt jedes Kind – und übrigens auch jede Lehrkraft – von der ersten Klasse an darauf zu trimmen, einmal eine zentrale, bundesweite Abiprüfung zu schaffen, sollte man Kinder dazu befähigen, ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Und die Unis machen dann – so wie das in den USA oder anderswo längst üblich ist – eigene Eingangstests und suchen die Menschen, die geeignet sind.
KU: Für eine neue Gesellschaft müssen alle Bevölkerungsgruppen beteiligt werden und die Gesellschaft mitgestalten. Dazu müssten wir aber endlich mal über Klasse sprechen. Das ist in Deutschland aber immer noch ein großes Tabuthema, die oben tun sich sehr schwer, über Klasse und ihre Privilegien zu reden. Aber die, die unten sind, haben ein sehr ausgeprägtes Klassenbewusstsein, sie wissen sehr genau, wo sie stehen – und merken, dass sie durch die Bürokratie ausgebremst werden. Denn auch das höre ich immer wieder: Der Staat will gar nicht, dass ich hier rauskomme. Und daraus resultiert dann auch diese Politikverdrossenheit.
AS: Ich sehe das Problem auch darin, dass zumindest ein Teil der Bürokratie von einem sehr negativen Menschenbild ausgeht, zum Beispiel, wenn es um Hartz IV geht. Wenn ich glaube, dass Menschen generell nicht motiviert und eher faul sind, dann muss ich die wöchentlich anrufen und schließlich sanktionieren.
KU: Und in diesen Strukturen werden Schicksale entschieden.
AS: Unser von Hobbes herrührendes Staatsverständnis, Gesetze müssten immer für den Schlechtesten herhalten, führt dazu, dass wir alle unter Generalverdacht stellen. Die Kollateralschäden davon sind inzwischen gut erforscht, wir wissen zum Beispiel, dass Finanzämter, die den Bürgern generell Missbrauch unterstellen, die intrinsische Motivation, Steuern zu zahlen, unterminieren. Was es braucht, ist nichts weniger als unseren Staat neu zu denken, und zwar auf Grundlage eines Menschenbilds, das den Menschen – auf gesunde, nicht auf naive Weise – Vertrauen entgegenbringt.
Katja Urbatsch ist mehrfach ausgezeichnete Gründerin und Geschäftsführerin der Organisation ArbeiterKind.de. Die gemeinnützige Initiative setzt sich für Chancengleichheit ein, indem sie Schüler*innen aus Familien ohne Hochschultradition zum Studium ermutigt. Urbatsch studierte Amerikanistik, BWL und Kommunikationswissenschaften und ist selbst die erste Akademikerin in ihrer Familie.
Armin Steuernagel war Waldorfschüler, studierte Politik und Ökonomie in Oxford, Witten und New York und macht sich nun stark für eine neue Eigentumsform für Unternehmen, die sich nicht mehr allein am finanziellen Profit ausrichten, sondern ihre Werte- und Langfristorientierung in der Unternehmensverfassung verankern. Um solchen Unternehmen eine Stimme zu geben, hat er mit Gleichgesinnten die Stiftung Verantwortungseigentum gegründet, deren Vorstand und Geschäftsführer er ist.
Tommi Winkler lebt als freier Journalist in Lehnitz.