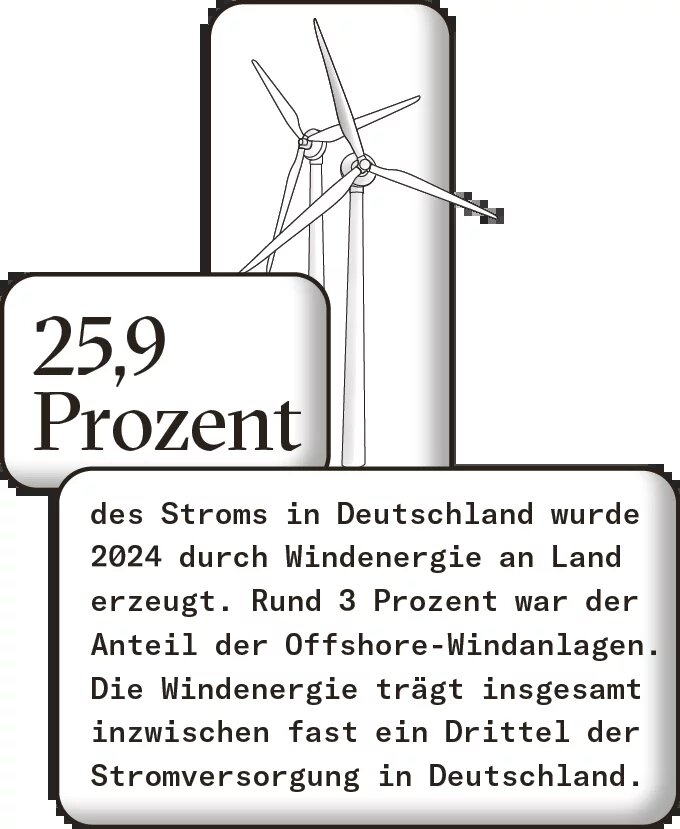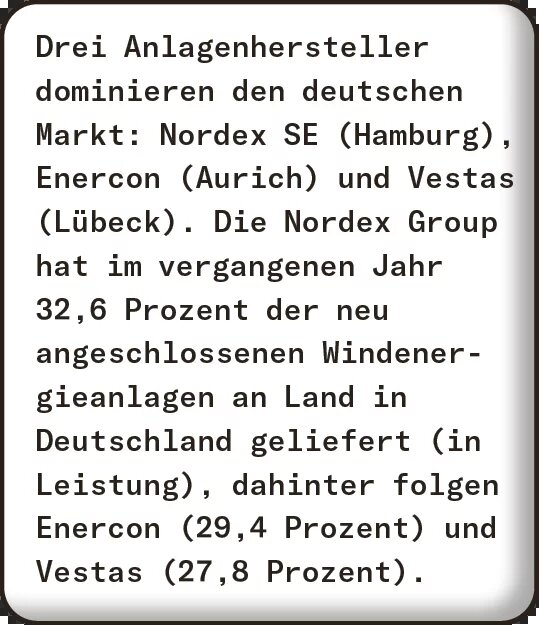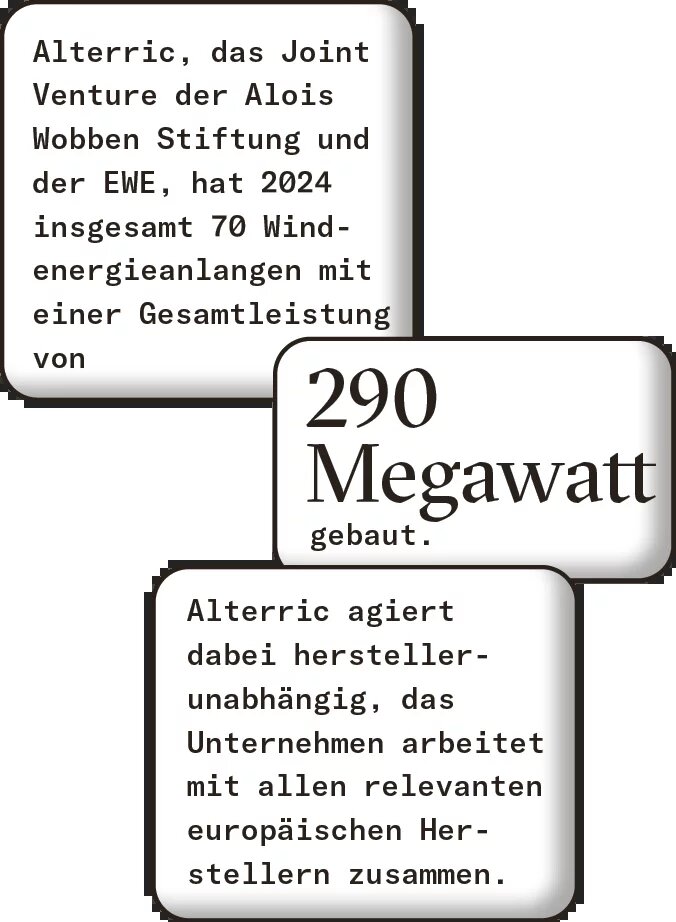Es gibt einige Zahlen, die in der Windenergiebranche zuletzt sehr gern zitiert wurden. 2.405 war eine davon: So viele Windenergieanlagen wurden im vergangenen Jahr neu genehmigt. Die Zahl 14 eine weitere: So viel Gigawatt Leistung wird durch die neu entstehenden Anlagen dereinst erzeugt werden. Grüner Strom für umgerechnet ungefähr 10 Millionen Drei-Personen-Haushalte jährlich. Diese Werte sind Bestmarken, wurden nie zuvor erreicht. Zwar sind die Räder noch nicht aufgestellt und der tatsächliche Zubau stockt weiterhin – aber die Tendenz stimmt.
Das sieht auch Frank May so, Vorsitzender der Geschäftsführung des Auricher Unternehmens Alterric. Die Firma entwickelt, projektiert und betreibt als eigenständiger Grünstromerzeuger Windenergieanlagen. Im Bereich der Onshore-Windkraft ist Alterric einer der wichtigsten Player in Europa und hat über 250 Windparks im Bestand. Die meisten – über 200 – davon sind in Deutschland angesiedelt, weitere in Frankreich und Griechenland. «Die hohe Zahl an Genehmigungen im abgelaufenen Jahr sind ein Erfolg für die gesamte Branche und ein riesengroßer Schritt nach vorn», sagt May im Videochat-Gespräch. «In den kommenden Jahren wird sich das auch in der Zahl der realisierten Anlagen niederschlagen.» Da sei er sich sicher. Vorausgesetzt, der politisch eingeschlagene Weg wird auch zukünftig fortgesetzt. Alterric ist eines der Unternehmen, die unmittelbar von den Weichenstellungen der Ampeljahre in der Energiepolitik profitieren: Das Wind-an-Land-Gesetz schreibt den Bundesländern vor, bis 2023 zwei Prozent Fläche für Windkraft zur Verfügung zu stellen, der Bau von Windkraftanlagen wurde zum «überragenden öffentlichen Interesse» erklärt.
Alterric setzt auf Hybridparks und Batterietechnologie als Zukunftsmodell
Alterric wurde vor vier Jahren als Gemeinschaftsunternehmen der Aloys Wobben Stiftung (AWS) und der EWE gegründet. Die Alois Wobben Stiftung ist auch Eigentümerin des Windanlagenherstellers Enercon, einstiger Weltmarktführer für Onshore-Windanlagen und derzeit zweitgrößter Hersteller hierzulande. EWE ist einer der großen Energieversorger im Nordwesten Deutschlands. Mit der Neugründung wollte man Synergieeffekte erzielen: Die bereits bestehenden Windparks beider Unternehmen legte man zusammen und nahm sich gleichzeitig vor, den weiteren Auf- und Ausbau von Windparks an das eigenständige Unternehmen Alterric zu übertragen. Das junge Unternehmen ist auf Wachstumskurs. Seit Gründung hat man 38 neue Windparks mit insgesamt 139 Windenergieanlagen gebaut. Allein im vergangenen Jahr kamen europaweit rund 70 Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 290 Megawatt dazu. Zudem erhielt Alterric in Deutschland 2024 Genehmigungen für den Bau von weiteren Anlagen mit über 600 Megawatt Gesamtleistung. Die Auricher sind Entwickler, Betreiber und Grünstromerzeuger zugleich, an den Windparks sind sie, teilweise in Kooperationen mit Partnern, mit unterschiedlich hohen Anteilen beteiligt. Seine Mitarbeiterzahl hat Alterric in nur drei Jahren mehr als verdoppelt (von 200 auf über 500 Mitarbeitende), der Jahresumsatz lag 2023 bei 506 Millionen Euro. Auch die jüngsten Monate gestaltete man erfolgreich: So konnte Alterric etwa die Batteriezellfabrik von VW in Salzgitter als Großabnehmer von grünem Strom gewinnen. Geschäftsführer May blickt entsprechend positiv in die Zukunft: «Wir haben uns als zuverlässiger Erzeuger und Vermarkter von Grünstrom etabliert und wollen in unseren Kernmärkten weiterwachsen», sagt der 58-jährige Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. So wird Alterric sein Angebot ausbauen: In Zukunft will man bestehende Windparks zu Hybridparks
umrüsten, also Mischformen aus Wind- und Solarenergieparks. Drei Hybridparks befinden sich aktuell in der Planungs- oder Genehmigungsphase.
Ein weiteres Vorhaben ist es, in Speichertechnologie zu investieren. «Wir müssen in Zukunft mehr Batteriespeicher an Wind- und Hybridparks installieren, damit unsere Anlagen noch wirtschaftlicher werden und ihren Beitrag auch zur Versorgungssicherheit leisten können», sagt May. Batteriespeicher können generell auch dabei helfen, den Strommarkt stabil zu halten: Aufgrund der Schwankungen im Angebot bei der wetterabhängigen Wind- und Solarkraft erlebte der Strommarkt 2024 bei den Preisen extreme Höhen und Tiefen – vom Negativpreis bis zu Preisrekorden. Die sogenannte Dunkelflaute – wenn also Wind und Sonne ausbleiben – hat erst im Dezember bewirkt, dass die Megawattstunde Strom an der Börse zeitweise mehr als 900 Euro kostete.
Eine andere Unternehmenskultur und Bindung der Mitarbeitenden
Andere Wege gehen will Alterric auch in der Unternehmenskultur und der Bindung der Mitarbeitenden. Seit rund einem Jahr beteiligt Alterric sie über Genussrechte an einer Windenergieanlage im niedersächsischen Dietrichsfeld – und damit unmittelbar am unternehmerischen Erfolg. Der Frauenanteil im Unternehmen liegt laut May zwischen 30 und 40 Prozent, wobei sich dies in der Führung, die aus drei Männern besteht, nicht abbildet. Stolz verweist May auch darauf, dass Alterric zwei Jahre in Folge bei der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zu den Top Companys zählt, mit Bewertungen, die deutlich über dem Branchenschnitt liegen.
Die aktuelle Stimmung in der Branche spiegelt Alterric insgesamt somit gut wider. Doch Ungewissheit herrscht darüber, wie es mit der Energiewende unter der nächsten Bundesregierung weitergeht. Zuletzt polemisierte Unions-Kanzlerkandidat* Friedrich Merz gegen die Windkraft. Er sagte, man müsse raus aus der Festlegung auf bestimmte Energieerzeugungsarten und könne Windräder «eines Tages wieder abbauen, weil sie hässlich sind und weil sie nicht in die Landschaft passen».
Frank May formuliert seine Erwartungshaltung an eine zukünftige Bundesregierung daher sehr deutlich: «Die Politik muss Verlässlichkeit über den Investitionsrahmen für die Erzeugungsseite schaffen, damit das Angebot aus Erneuerbaren weiter ausgebaut und finanziert werden kann. Wir müssen in Infrastruktur und Standortqualität investieren, um die notwendige Transformation voranzutreiben, denn die Wirtschaft in Deutschland braucht für Wachstum und internationale Wettbewerbsfähigkeit einen Strompreis von 60 Euro/MWh – mit Kohle, Gas und Kernkraft ist das aber nicht erreichbar.»
Das Ziel der noch amtierenden Bundesregierung ist es, zehn Gigawatt Leistung jährlich im Bereich der Onshore-Windkraft zuzubauen (erreicht worden sind im vergangenen Jahr nur 2,5 Gigawatt netto). Aktuell erzeugen die knapp 29.000 Onshore-Windräder in Deutschland 63,5 Gigawatt Leistung – diesen Wert will man bis 2030 etwa verdoppeln. Das hieße: volle Auftragsbücher für Unternehmen wie Alterric.
«Um diese Ziele zu erreichen, muss sich der gesamte Realisierungszeitraum noch mal deutlich verkürzen», sagt Frank May. Damit meint er die Zeitspanne zwischen Projektbeginn und Inbetriebnahme einer Windanlage. Acht Jahre verstreichen in Deutschland durchschnittlich, bevor sich das Rad dreht und Strom erzeugt, hat eine Studie der Fachagentur Wind und Solar 2023 ermittelt. Der Prozess ist dabei in den vergangenen Jahren länger geworden, nicht kürzer. «Wir müssen eher auf vier als auf acht Jahre kommen, sonst werden wir die Ziele weiterhin verfehlen», sagt May.
Doch so mancher Prozess braucht Zeit, etwa die Schutzgüterabwägung, die bei Windkraftprojekten oft eine Rolle spielt. Verschiedene Interessen wägen Behörden dabei ab, etwa wenn es um Denkmal- oder Naturschutz geht. Dem Rotmilan etwa haben die Windräder zu einiger Popularität verholfen; Gegner der Windkraft bringen ihn gern ins Spiel, zu oft würde er von den Rotorblättern erschlagen. Eine Studie ergab kürzlich, dass dies eine eher seltene Todesursache bei Rotmilanen ist. Insgesamt sind Windkraftanlagen auch viel breiter akzeptiert, als man gemeinhin aufgrund der sehr laut auftretenden Windkraftgegnerschaft annimmt. Rund 78 Prozent der deutschen Bevölkerung hielten den weiteren Ausbau zuletzt laut einer Forsa-Umfrage für «sehr wichtig» oder «eher wichtig».
«Der Widerstand in der Bevölkerung ist nicht stärker geworden», sagt auch Frank May. «Vielen ist einfach die Versorgungssicherheit wichtig, und sie wissen die höhere Unabhängigkeit von fossilen Quellen und Gasimporten zu schätzen.» Er fordert eine deutliche Beschleunigung beim Thema Windkraft – und dies nicht allein aus Eigeninteresse. «100 Prozent Energiewende» – das ist die Mission, die sich das Unternehmen und die Mitarbeitenden auf die Fahne geschrieben haben. «Wir müssen den Ausbau der Windenergie industrialisieren», sagt er. Wenn das gelingt, dürfte es bald neue Rekordzahlen geben – dann nicht nur bei den Genehmigungen.
Jens Uthoff ist Redakteur der taz. Er schreibt vor allem über Gesellschaftsthemen, Kultur und internationale Politik.
*Der Text wurde im Januar 2025 recherchiert und geschrieben.