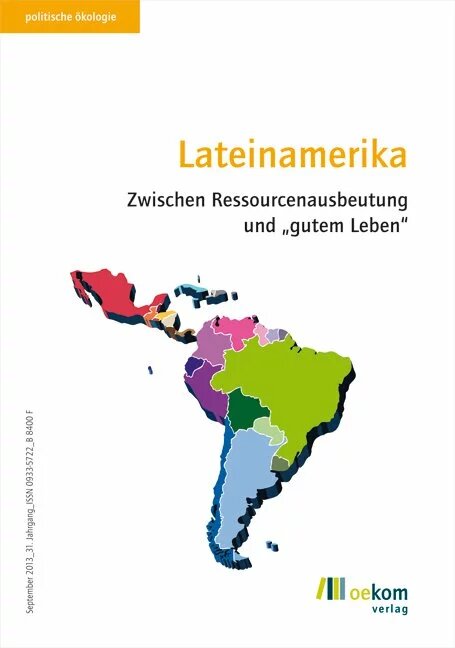

Die Gewaltspirale dreht sich nirgends auf der Welt so schnell wie in Lateinamerika. Drogenkartelle korrumpieren demokratische Institutionen, Jugendbanden drangsalieren Migranten und die harte Hand der Politik sät mehr Angst als Sicherheit.
Vor allem aus Mexiko kamen in den vergangenen Jahren verstörende Meldungen: Seit der ehemalige Präsident Felipe Calderón bei seinem Amtsantritt 2006 den „Krieg gegen die Drogen“ erklärt hatte, hat die Gewalt in dem Land an der Grenze zwischen Nord- und Südamerika erschreckende Ausmaße angenommen. Die Bilanz seiner sechsjährigen Amtszeit ist bedrückend. Es wurden mehr als 70.000 Tote und mindestens 27.000 Vermisste gezählt. Dabei erreichten die Morde ein teilweise unvorstellbares Ausmaß an Brutalität. Insbesondere die Kartelle senden mit ihren Gewaltakten Botschaften an die rivalisierenden Kartelle und die Verräter(innen) aus den eigenen Reihen, an Regierung und Sicherheitskräfte und natürlich an die Bevölkerung. „Wir haben hier die Kontrolle, die Regierung ist machtlos, und wer sich mit uns anlegt, dem ergeht es sehr schlecht“, lautet der Subtext. Sogenannte „Narco-Mensajes“, Transparente, die plötzlich an Brücken und öffentlichen Plätzen auftauchen, vermitteln bizarre Botschaften. Darauf werden Gegner diskreditiert, wird die Urheberschaft für Morde angezeigt oder bestritten, oder der Bevölkerung mitgeteilt, dass man sich keine Sorgen machen müsse und das Kartell nur für Ruhe und Ordnung sorge.
Unter dem neuen Präsidenten Enrique Peña Nieto sind die negativen Schlagzeilen aus Mexiko weniger geworden. Es ist aber noch zu früh, um einzuschätzen, ob das auf eine bessere Sicherheitspolitik zurückzuführen ist oder ob die neue Regierung nur eine geschicktere Kommunikationsstrategie verfolgt.
Die Sicherheitskräfte schauen weg
Die Organisierte Kriminalität ist mittlerweile auf dem gesamten lateinamerikanischen Kontinent zu einer Sicherheitsbedrohung geworden. Nicht überall tritt sie so gewaltsam auf wie in Mexiko, Zentralamerika und den brasilianischen Favelas, denn zunächst geht es um ökonomische Aktivitäten, die häufig im Grenzbereich zwischen der legalen und der illegalen Wirtschaft stattfinden. Da es sich um illegale Wertschöpfung handelt, greifen die legalen Steuerungs- und Regulierungsmechanismen nicht. Gewalt bleibt neben Korruption das zentrale Regulierungsinstrument, um sich Zugang zu Märkten zu verschaffen oder um marktinterne Konflikte zu lösen. Die Gewalt ist somit dort am größten, wo Gruppen oder Kartelle um Vorherrschaft kämpfen und/oder wo es zu nennenswerten Auseinandersetzungen mit dem staatlichen Sicherheits- und Justizapparat kommt. Gehandelt wird neben Drogen vor allem mit Menschen, menschlichen Organen und Schmuggelware aller Art.
Die lateinamerikanische Kommission zu Drogen und Demokratie benennt neben der quantitativen Zunahme von Fällen offener Gewalt, die inzwischen alle Sektoren der Gesellschaft betrifft, noch zwei weitere Charakteristika der Organisierten Kriminalität in Lateinamerika (1): erstens die Korruption von öffentlichen Funktionären, und hier vor allem der Sicherheitskräfte wie Polizei und Militär, sowie zweitens eine deutliche Zunahme von direkten Verbindungen in die politische Sphäre und in die demokratischen Institutionen. Insbesondere die Gewinne, die mit dem Drogenhandel erzielt werden, sind so immens, dass nahezu unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. „Gold oder Blei“ lautet die Devise. Wer sich nicht kaufen lassen will, muss dies meistens mit dem Leben bezahlen, wenn es nicht gelingt, sich rechtzeitig ins Exil abzusetzen. Eigens ausgebildete Killer, die nicht nur aus dem großen Heer arbeitsloser Jugendlicher, sondern auch aus Polizei und Armee rekrutiert werden, besorgen den schmutzigen Teil des Geschäfts. Vor allem die Korruption trägt auf allen Ebenen dazu bei, dass die illegalen Geschäfte laufen. Angehörige der staatlichen Sicherheitskräfte schauen weg oder arbeiten direkt mit den Kartellen zusammen. Korrumpierte Mitarbeiter(innen) des Justizsystems bleiben untätig, Politiker(innen) halten ihre schützende Hand über die maßgebenden Personen.
Die Verbindungen und die Verwobenheit mit der politischen, wirtschaftlichen und institutionellen Sphäre sind je nach Land unterschiedlich. In Brasilien ist relativ wenig über eine Verbindung der Organisierten Kriminalität mit den oberen Regierungs- und Verwaltungskreisen bekannt. Das Problem scheint vielmehr auf der lokalen Ebene in den Favelas von Rio de Janeiro, São Paulo und anderen Städten zu liegen. In Kolumbien hingegen wurden 2008 im Zuge des sogenannten Parapolítica-Skandals etwa ein Viertel aller Kongressabgeordneten verhaftet wegen des Verdachts auf Zusammenarbeit mit paramilitärischen Todesschwadronen und Verbindung zum Drogenhandel. In Mexiko kommt es immer wieder zu Festnahmen hoher Funktionäre und Politiker wie beispielsweise dem ehemaligen Anti-Drogen-Zar Noe Ramirez Mandujo (2009) oder dem ehemaligen Chef von Interpol-Mexiko, Rodolfo de la Guardia García.
„Lieber reich sterben als alt und arm“
Insbesondere Jugendliche sind gefährdet, in eine illegale Erwerbsbiografie abzudriften, und das möglicherweise mit einem frühen gewaltsamen Tod zu bezahlen. In Mittelamerika sind es die „Maras“, die berüchtigten Jugendbanden, die entwurzelten Jugendlichen sozialen Zusammenhalt und ökonomisches Auskommen bieten. Ihre Gründung geht bis in die Zeit Ende der 1980er-Jahre zurück, als die USA nach Ende der Bürgerkriege in Mittelamerika massenweise straffällig gewordene Jugendliche in ihre Ursprungsländer deportierten. In den Favelas von Rio de Janeiro und Sao Paulo werden jedes Jahr Hunderte, vor allem schwarze Jugendliche von der Polizei erschossen, weil sie unter dem Generalverdacht stehen, zum Organisierten Verbrechen zu gehören. In Mexiko können die Drogenkartelle vor allem dort, wo Jugendliche keine Ausbildungs- und Arbeitsangebote finden und somit keine Zukunftschancen haben, immer wieder leicht die Lücken in ihren Strukturen füllen, die der blutige Drogenkrieg fordert. Für die jungen Männer ist die Perspektive verlockend, schnell relativ viel Geld und andere Machtinsignien wie Autos, Mädchen, Respekt und – innerhalb ihrer Gruppe – Ansehen zu erwerben. In Mexiko kursiert das Lebensmotto „Lieber jung und reich sterben als alt und arm.“ Die Jugendlichen stammen häufig aus entwurzelten familiären Verhältnissen. Insbesondere in den Industriegebieten des Nordens Mexikos – die aus dem Boden gestampft wurden, um die wachsende Weltmarktnachfrage nach verarbeiteten Produkten zu stillen, aber über keine soziale Infrastruktur verfügen – sind die Kinder und Jugendlichen weitgehend auf sich allein gestellt. Ihre Eltern, häufig Migrant(inn)en aus den ländlichen Gebieten Mexikos, mussten von früh bis spät arbeiten, ohne dass sie eine Betreuung für ihre Kinder organisieren konnten. Heute haben diese Kinder nicht einmal die Chance, in den gleichen Fabriken wie ihre Eltern Arbeit zu finden. Der globale Hunger nach billigen Waren hat die Produktion längst in andere Länder getrieben, die noch billigere Arbeitskräfte zu bieten haben. Somit sind sie leichte Beute für die Drogenkartelle.
Keine Papiere – keine Rechte
Seit einigen Jahren ist auch international bekannt, welchen Gefahren die Migrant(inn)en auf ihrem Weg durch Mexiko in die USA ausgesetzt sind. Die meisten kommen aus Zentral- und Südamerika, aber auch Migrant(inn)en aus Afrika und Asien nutzen vermehrt diese Route. Als Folge einer zunehmend restriktiven und diskriminierenden Migrationspolitik sind viele von ihnen ohne Papiere unterwegs und damit auch nahezu rechtlos. Auf ihrer Reise sind sie dem Terror und der Willkür von Jugendbanden, der Maras, aber auch der staatlichen mexikanischen Sicherheitskräfte ausgesetzt, die sie berauben, erpressen, misshandeln und manchmal auch töten. Frauen müssen zudem fürchten, vergewaltigt zu werden. Einige Schleppernetzwerke – von einfachen Gruppen, die die Migrant(inn)en über die Grenze führen, bis hin zu Organisationen, die gefälschte Papiere und Visa verkaufen – sind inzwischen mit dem Organisierten Verbrechen verbunden und benutzen die Migrant(inn)en als „Mulas“, als Drogenkuriere. Das Risiko, dabei erwischt zu werden, tragen die Migrant(inn)en alleine. Für die Auftraggeber hält sich der finanzielle Verlust durch die möglicherweise verloren gegangenen Drogen in Grenzen, sodass sie die Kuriere manchmal auch selbst verraten, um von größeren Transporten abzulenken.
In den letzten Jahren hat sich die Situation noch weiter verschärft, da die Migrant(inn)en noch auf andere Weise ins Visier der Drogenkartelle geraten sind, die hier eine weitere Einnahmequelle entdeckt haben. Die mexikanischen Kartelle, vor allem die extrem gewalttätigen Zetas, ehemalige Elitesoldaten, haben sich auf die Entführung und Erpressung von Migrant(inn)en spezialisiert. Wenn die Opfer respektive ihre Verwandten das geforderte Lösegeld – zur Zeit bis zu 6.000 US-Dollar – nicht zahlen können oder wollen, bleibt ihnen nur, direkt für die Kartelle zu arbeiten. Wer dies ablehnt oder dafür nicht geeignet ist, wird kaltblütig ermordet. Immer wieder werden Massengräber entdeckt, die Zeugnis über diese brutalen Verbrechen ablegen.
Die Ursachen der Gewalt
Nicht alle Gewaltakte sind auf die Organisierte Kriminalität zurückzuführen. Lateinamerika ist der gewaltintensivste Kontinent der Welt. Der UN-Bericht über die menschliche Entwicklung 2013 verweist auf 22,2 Morde pro 100.000 Einwohner(innen). Zum Vergleich: Afrika südlich der Sahara liegt bei 20,4, Europa bei 5,5 Morden. Allerdings sind die nationalen Unterschiede beträchtlich: Während Honduras mit 91,6 Morden, gefolgt von El Salvador (69,2), Jamaika (52,2), und Venezuela (45,1) auch weltweit die traurige Spitze bildet, weisen Chile (3,2), Argentinien (3,4) und Uruguay (5,9) vergleichsweise niedrige Mordraten auf.
Von Gewalt und Unsicherheit sind insbesondere Frauen und Jugendliche betroffen sowie soziale, ethnische, religiöse und sexuelle Minderheiten. Armut und Ungleichheit sowie die Fortdauer früherer Kriegsgewalt gelten ebenso als wesentliche Ursachen wie die hohe Straflosigkeit aufgrund eines ineffektiven und häufig auch korrupten Polizei- und Justizsystems. Die Straflosigkeit liegt beispielsweise in Mexiko bei 95 und in Kolumbien bei 90 Prozent. Die Datenlage zur Gewalt gegen Frauen ist jedoch mehr als dünn, lange Zeit wurde das Phänomen ignoriert. Entsprechend gibt es so gut wie keine belastbaren statistischen Daten, zumal viele Kriminalitätsstatistiken keine Trennung nach Geschlechtern vornehmen. Nur Fallstudien und Befragungen lassen das Ausmaß dieses Unrechts erahnen. In Guatemala hatten einer Umfrage von 2008/2009 zufolge 45 Prozent der befragten Frauen schon eine Gewalterfahrung in ihrem Leben gemacht. In Peru gaben 41,2 Prozent der Frauen im Jahr 2000 an, schon einmal in ihrem Leben von ihrem Partner misshandelt worden zu sein; 2009 waren es immer noch 38,8 Prozent. (2) Die wohl brutalste Form der Misshandlungen sind die sogenannten Feminizide – Morde, die aufgrund des Geschlechtes begangen werden und sich meist durch besondere Grausamkeit auszeichnen. International bekannt geworden sind sie vor allem durch die vielen ungeklärten Frauenmorde in Ciudad Juárez und anderen Städten im Norden Mexikos (vgl. S. 58ff.). Aber auch andere lateinamerikanische Länder wie El Salvador, Guatemala, Honduras und Peru weisen hohe Feminizidraten auf. Hier ist die Datenlage ebenfalls extrem schlecht.
Strategien zum Umgang mit dem Verbrechen
Mit wenigen Ausnahmen haben bislang alle lateinamerikanischen Regierungen auf das besorgniserregende Szenario von Gewalt und Unsicherheit im gleichen Duktus reagiert: Leitendes Prinzip ist die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, indem die Rolle der Sicherheitskräfte gestärkt und eine repressive Politik verfolgt wird. In den gewaltintensivsten Ländern dominieren deshalb Angst, ein Gefühl der Machtlosigkeit und eine „Politik der harten Hand“, die einseitig auf repressive Methoden der Strafverfolgung setzt und dabei häufig Menschenrechte sowie demokratische Prinzipien unterläuft. Auch Journalist(inn)en und Menschenrechtsverteidiger(innen), die diese Politik kritisch begleiten, geraten schnell in den Fokus staatlicher Repression. Die Planung dieser Politik erfolgt auf nationaler Ebene, während die lokale Ebene, auf der die meisten Verbrechen begangen werden, bei der Problemlösung vernachlässigt wird.
Teilweise erfolgreich war eine solche Politik in Kolumbien, wo die harte Hand der Regierung des Präsidenten Álvaro Uribes die kolumbianischen Drogenkartelle und Teile der Guerilla erheblich geschwächt hat. Zumindest in den größeren Ballungsräumen und einigen Landesteilen ließ sich die Gewalt drastisch reduzieren. Unbehelligt blieben allerdings die paramilitärischen Gruppen, die vor allem dort die Bevölkerung terrorisieren, wo mineralische und landwirtschaftliche Bodenschätze große Profite ermöglichen. Insbesondere Gewerkschaftler(innen) und Aktivist(inn)en, die sich gegen die zerstörerische Ausbeutung von Ressourcen und für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, sind hier in den vergangenen Jahren verstärkt bedroht.
Mit dem politischen Wechsel in El Salvador und – in geringerem Ausmaß – während der Präsidentschaft von Alvaro Colom in Guatemala (2008-2012) gewannen auch andere sicherheitspolitische Ansätze an Bedeutung. Im Mittelpunkt standen die Prävention und die Einbeziehung der lokalen Ebene in das Sicherheitskonzept. Doch aufgrund von internem und externem Druck, schnelle Ergebnisse zu liefern, wurden diese Ansätze kaum verfolgt. In El Salvador handelte die Regierung 2012 mit den beiden Jugendbanden Mara Salvatrucha und M-19 ein Waffenstillstandsabkommen aus als Gegenleistung für bessere Haftbedingungen ihrer inhaftierten Mitglieder. Die Mordrate im Land nahm daraufhin signifikant ab, sodass inzwischen auch Honduras über ein solches Abkommen verhandelt. Innerhalb der Bevölkerung wird dieses Abkommen aber sehr zwiespältig gesehen, da es sich dabei fast um einen Freibrief für die anderen Verbrechen wie Entführungen, Raub und Schutzgelderpressung handelt. Auch Brasilien hat mit dem Konzept der Befriedungseinheiten der Polizei (Unidade de Policia Pacificadora, UPP) zumindest partiell einen anderen Weg eingeschlagen. Hier kämmen zunächst Eliteeinheiten der Polizei die Favelas nach Drogenbanden durch. Danach errichtet die UPP vor Ort Präsenzposten und versucht das Vertrauen der Bevölkerung zu erlangen und die Sicherheitssituation dauerhaft zu verbessern. Wie nachhaltig diese verschiedenen Ansätze sind, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. Sowohl aus Brasilien als auch aus Kolumbien mehren sich inzwischen erneut Hinweise auf ein Wiedererstarken von Drogenhandel und Unsicherheit.
Die Rolle der Zivilgesellschaft
Viele (lokale) zivilgesellschaftliche Initiativen verrichten in allen Ländern eine mutige Arbeit. Sie können die notwendigen staatlichen Maßnahmen nicht ersetzen und den Staat auf keinen Fall aus seiner Verantwortung entlassen. Aber sie bilden eine wichtige und notwendige Ergänzung zur Herstellung von Sicherheit, Recht und Rechtsstaatlichkeit. Sie sind nicht nur unverzichtbar, um Unrecht und Missbrauch öffentlich anzuprangern und grundlegende Reformen einzufordern, sie leisten auch essentielle konkrete Arbeit, etwa im Bereich von Prävention und Begleitung von Gewaltopfern, bei der Entwicklung einer Kultur der Legalität und bei der Suche nach friedlichen Alternativen des Umgangs mit Konflikten. Die mexikanische Organisation „Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos“ (zu Deutsch „Vereinigte Kräfte für unsere Verschwundenen“) unterstützt beispielsweise die Angehörigen von Verschwundenen. Sie sammelt und bündelt Informationen, gibt Hinweise, wie man sich durch das Dickicht der staatlichen Ignoranz schlägt, und macht durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit öffentlichen Druck. In El Salvador macht das feministische Kollektiv „Colectiva Feminista para el Desarrollo Local“ (Frauenkollektiv für die lokale Entfaltung, CFDL) in Sochitoto öffentlich auf das Phänomen der Gewalt gegen Frauen aufmerksam und hat gemeinsam mit Polizei, Bürgermeisteramt, Restaurantbesitzer(inne)n, Busunternehmern und anderen ein Präventionsprogramm ins Leben gerufen. Andere Organisationen konzentrieren sich auf die Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Vor allem auf der lokalen Ebene beeindruckt die Überzeugung dieser Akteure, trotz aller Gefahren und Hindernisse mit ihrer Arbeit etwas dazu beizutragen, dass die Gewalt in Lateinamerika verringert wird.
In Zusammenarbeit zwischen oekom e.V. – Verein für ökologische Kommunikation und der Heinrich-Böll-Stiftung entstand das Heft „Lateinamerika – Zwischen Ressourcenausbeutung und ‚gutem Leben‘“ in der Reihe „politische ökologie“ des oekom verlages. (pö 134, September 2013) Spannende Artikel bieten der Leserschaft ein Kaleidoskop an Informationen. Neoextraktivismus und Lithiumboom werden ebenso beleuchtet wie organisierte Kriminalität und die Fallgruben des Freihandels. Leserinnen und Leser erfahren unter anderem, wie süß die Südfrüchte aus Zentralamerika wirklich sind, wie Windenergie Zwietracht säen kann und was Fußballweltmeisterschaft und Olympische Spiele in Brasilien mit der Verschlechterung von Lebensbedingungen der Bevölkerung zu tun haben.
Anmerkungen
(1) Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracias. Download unter www.drogasydemocracia.org
(2) CEPAL (2012): Sí no se cuenta, no cuenta. Información sobre la violencia contra las mujeres. Santiago de Chile.