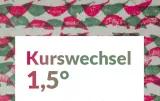Europa wird sich aus der aktuellen Schuldenkrise nicht durch bloße Sparpolitik befreien können. Es braucht nachhaltiges Wachstum, um die öffentlichen Haushalte wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die grassierende Arbeitslosigkeit unter der jungen Generation zu überwinden und den Sozialstaat zu finanzieren.
Spätestens seit dem Report des britischen Ökonomen Nicolas Stern wissen wir, dass der Klimawandel nicht nur ein ökologisches Risiko erster Ordnung darstellt. Auch die ökonomischen Risiken sind gewaltig. Falls das Ruder nicht rasch herumgeworfen wird, werden die hausgemachten „Naturkatastrophen“, die mit dem Anstieg der Treibhausgase in der Erdatmosphäre einhergehen, weiter zunehmen: Sturmfluten, Dürreperioden und Wirbelstürme bedeuten auch eine Vernichtung wirtschaftlicher Werte.
Dagegen schätzt Stern die Kosten für effektiven Klimaschutz auf ca. 1 Prozent der globalen Wertschöpfung pro Jahr. Ihnen stehen enorme Wachstumspotenziale auf dem Feld der „Green Economy“ gegenüber. Investitionen in Klimaschutz sind deshalb volkswirtschaftlich hoch rentabel – und sie können zum Auslöser eines grünen Wirtschaftswunders werden. Das klingt fast wie die Quadratur des Kreises: die Ökologie als Jungbrunnen der Ökonomie. Aber zunächst steckt dahinter eine gewaltige Herausforderung. Es geht um eine Halbierung der globalen CO2-Emissionen bis zur Mitte des Jahrhunderts, was einer Reduktion in den „alten“ Industriemetropolen in einer Größenordnung von 80-90 Prozent entspricht. Diese Ziele sind für sich genommen schon ambitioniert genug – sie werden noch anspruchsvoller angesichts des rapiden Wirtschaftswachstums im globalen Maßstab.
Es gibt gute Gründe für die Kritik einer auf permanentes Wachstum angelegten Wirtschaftsordnung, von der Endlichkeit vieler Ressourcen bis hin zu den psychischen Folgen des „immer mehr und immer schneller“. Aber angesichts einer Weltbevölkerung, die innerhalb weniger Jahrzehnte von heute knapp 7 Milliarden auf mindestens 9 Milliarden wachsen wird, und angesichts des enormen Nachholbedarfs von zwei Dritteln der Menschheit an Konsumgütern und Dienstleistungen ist ökonomisches „Nullwachstum“ keine Option.
Selbst wenn das stürmische Wachstum in Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien durch krisenhafte Verwerfungen gebremst wird, muss man von einer Verdoppelung des Welt-Sozialprodukts innerhalb der nächsten 20 bis 25 Jahre ausgehen. Nicht ob die Weltwirtschaft wachsen wird, ist die Frage, sondern wie sie das tut: Was werden die Energiequellen der Zukunft sein, wie effizient gehen wir mit begrenzten Ressourcen um, welche Rolle können nachwachsende Rohstoffe spielen, wie sehen die Verkehrssysteme der nächsten Generation aus und wie sichern wir eine gute Ernährung für eine wachsende Weltbevölkerung?
Auch die internationale Klimadiplomatie lehrt vor allem eins: Die aufstrebenden Staaten des Südens lassen über alles mit sich verhandeln, bloß nicht über ihre Wachstumschancen. Das gleiche gilt für die USA, die immer noch größte Volkswirtschaft des Globus, und auch Europa wird seine Schuldenkrise nicht durch bloße Umverteilung lösen können. Ohne Wiederbelebung der Wachstumskräfte in den Defizit-Staaten droht eine Spirale nach unten. „Degrowth“, also das Schrumpfen einer Volkswirtschaft, ist in der rauen Wirklichkeit ein soziales Drama, das die Perspektiven ganzer Gesellschaften verdunkelt.
Wachsen mit der Natur
Wie man es auch dreht und wendet – auf Sicht der nächsten Jahrzehnte hängt alles davon ab, dass eine Entkoppelung von ökonomischer Wertschöpfung und Naturverbrauch gelingt. Das bedeutet nichts weniger als eine neue industrielle Revolution, eine völlig neue Generation umweltfreundlicher Technologien, eine Umstellung der Energiebasis von fossilen auf erneuerbare Energien und einen grundlegenden Umbau des Verkehrssystems. Diese kopernikanische Wende von der bisherigen, auf dem Raubbau an den natürlichen Lebensgrundlagen basierenden Produktionsweise zu einer nachhaltigen Ökonomie erfordert zwei grundlegende Operationen. Erstens geht es darum, aus weniger Ressourcen ein Mehr an Wohlstand zu erwirtschaften. Die Potentiale dieser Effizienzrevolution sind vielfach beschrieben worden, beispielhaft von Amory Lovins („Natural Capitalism“) und Ernst Ulrich von Weizsäcker („Faktor Vier“).
In einer zweiten, parallelen Kraftanstrengung geht es darum, fossile Energieträger durch erneuerbare Energien und knappe Ressourcen durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Letztlich muss die Sonnenenergie zur zentralen Ressource einer post-fossilen Ökonomie werden – sei es durch direkte Umwandlung in elektrische Energie oder durch die technische Imitation der Photosynthese, also die Umwandlung von Sonnenlicht in chemische Energie. Sonnenenergie ist eine unbegrenzte Quelle des Lebens. Sie ermöglicht es, der Entropie zu entkommen und die natürlichen Grenzen des Wachstums zu erweitern. Es geht um eine neue Art des Wirtschaftens, das die vielfach noch unentdeckten Produktivkräfte der Natur entfaltet. Die natürliche Evolution hat wahre Wunder hervorgebracht. Sie ist ein einziges Laboratorium für angepasste Biotechnologie. Grüne industrielle Revolution heißt im Kern: lernen von der Natur und wachsen mit der Natur.
Seit dem Beginn der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert hat sich die Produktivität einer Arbeitsstunde etwa um den Faktor 25 erhöht. Das ist vor allem das Ergebnis technischer Innovationen und einer ständigen Verbesserung aller Arbeitsabläufe. Diese Innovationsdynamik gilt es jetzt auf den effektiven Umgang mit natürlichen Ressourcen zu übertragen. Die Steigerung der Ressourcenproduktivität zumindest um den Faktor vier wird zur Überlebensfrage der Industriegesellschaft. Sie würde eine Halbierung des Ressourcenverbrauchs bei gleichzeitiger Verdoppelung des Sozialprodukts erlauben. Ernst Ulrich von Weizsäcker spricht inzwischen vom „Faktor Fünf“ als „Formel für nachhaltiges Wachstum“. Ressourceneffizienz wird zum Treiber für eine Welle technischer Innovationen, die einen neuen Wachstumszyklus der Weltwirtschaft in Gang setzen. Dabei geht es nicht nur um die lineare Optimierung bestehender Techniken und Produkte, sondern um Sprunginnovationen – analog zur Erfindung des Buchdrucks, der Dampfmaschine und der Erzeugung von Elektrizität. Sie verändern nicht nur einzelne Produkte, sondern die Art und Weise wie wir produzieren und konsumieren.
Dass „der Markt“ nicht aus sich heraus die ökologische Wende hervorbringen wird, ist eine Binsenweisheit. Die Politik muss – national und international – die Vorgaben setzen, um die Märkte in eine ökologische Richtung zu lenken. Zentral ist eine Begrenzung der CO2-Emissionen auf globaler Ebene, flankiert durch handelbare Emissionsrechte. Aber ebenso illusionär wie das Vertrauen in die Selbststeuerung der Märkte ist die Vorstellung, staatliche Regulierung könnte die Kreativität der Marktwirtschaft ersetzen, in der Millionen und Abermillionen von Produzenten und Konsumenten eigenverantwortlich handeln. Es geht um einen gigantischen Innovationsprozess in Zeitraffer. Er kann nur erfolgreich sein, wenn eine Vielzahl von Akteuren in Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft in Bewegung kommt. Unternehmen und Verbraucher müssen selbst zu Akteuren der ökologischen Innovation werden.
Von Karl Marx stammt der berühmte Satz: „Der Kapitalismus ruiniert die Springquellen des Reichtums, auf denen er beruht: den Arbeiter und die Natur.“ Das war als Tendenz scharfsinnig beobachtet. Man darf nur nicht den Fehler begehen, daraus ein ehernes Gesetz zu machen. Gerade das Beispiel der „sozialen Frage“ zeigt, dass die destruktiven Tendenzen des Kapitalismus Gegenkräfte auf den Plan rufen, die zu Systeminnovationen führen. Als Antwort auf den Raubbau an der Arbeiterschaft trat im 19. Jahrhundert die Arbeiterbewegung auf den Plan, und mit ihr die Sozialdemokratie als neue politische Kraft. Ihr Projekt war die soziale Zivilisierung des Kapitalismus. Sie erkämpfte ein weitverzweigtes Netz von Institutionen – Gewerkschaften, Genossenschaften, Sozialversicherungen, berufliche Bildung, Arbeitsgesetzgebung, Tarifverträge, betriebliche Mitbestimmung – bis hin zum allgemeinen Wahlrecht. Im Ergebnis stiegen Lebenserwartung und Lebensstandard der arbeitenden Klassen in Europa und Nordamerika (inzwischen auch in weiten Teilen Asiens) auf breiter Front; der Anstieg der Massenkaufkraft führte zur modernen Konsumgesellschaft. Zwar ist die soziale Aufwärtsbewegung der arbeitenden Klassen ein immer wieder umkämpfter Prozess, aber sie ist entgegen aller Unkenrufe über den Absturz der Mittelschicht auch im Zeitalter der Globalisierung nicht außer Kraft gesetzt. Gerade in den neuen Industrieländern steigen Bildungsniveau und Lebensstandard breiter Schichten; gleichzeitig wachsen die Nachfrage nach qualifizierter Arbeit und die Bedeutung des „menschlichen Faktors“ für die Wirtschaft.
Das Neue wächst im Schoß des Alten
Ob die Analogie zwischen sozialer und ökologischer Einhegung des Kapitalismus trägt, muss sich noch erweisen. Aber wer genau hinsieht, findet viele Anzeichen dafür, dass die ökologische Transformation des Kapitalismus bereits begonnen hat. Es geht hier nicht um Spekulationen, sondern um Tendenzen und Kräfte, die bereits in Richtung einer ökologischen Wende aktiv sind. So haben in den letzten Jahren Zahl und politische Reichweite zivilgesellschaftlicher Organisationen enorm zugenommen. Mit ihrer Fähigkeit zur Skandalisierung fungieren sie als Wächtersystem gegenüber transnationalen Unternehmen. Das „Reputationsrisiko“, das damit verbunden ist, Ziel einer internationalen Kampagne zu werden, ist für die Konzerne ein harter ökonomischer Faktor. Kampagnen gegen den Raubbau an den tropischen Wäldern oder gegen ausbeuterische Zustände in den Produktionsstätten von Nike, Adidas & Co haben Unternehmen zur Veränderung ihrer Geschäftspolitik gezwungen. Ein grünes Image ist inzwischen zum Wettbewerbsvorteil geworden.
Auch wenn noch viel Fassadenmalerei („Greenwashing“) betrieben wird: die Veränderungen gehen tiefer. So hat ein Weltkonzern wie Siemens inzwischen sein Geschäftsmodell neu ausgerichtet: hocheffiziente Gaskraftwerke und Generatoren, erneuerbare Energien, Hochleistungsstromnetze, ökologische Gebäudetechnik und öffentliche Verkehrssysteme bilden neben der Medizintechnik das Kerngeschäft des Unternehmens. General Electric, der amerikanische Gegenspieler von Siemens, hat eine neue Division unter dem Markenzeichen „Ecomagination“ aufgebaut, die zum Wachstumsmotor des Konzerns geworden ist. Philips erzielt bereits rund 40 Prozent seines Umsatzes mit „grünen Produkten“ und will die Energieeffizienz seiner Produktpalette um 50 Prozent steigern. Random House, das weltweit größte Verlagshaus, druckt seine Bücher nur noch auf zertifiziertem Papier. Im Einzelhandel spielt die Umwelt- und Sozialbilanz des Sortiments eine wachsende Rolle. Neue Zertifizierungssysteme erfordern die Neuausrichtung der gesamten Zulieferungskette. Das alles spielt sich nicht mehr in exotischen Marktnischen ab, sondern hat die großen Handelshäuser erfasst, vom Otto-Versand bis zu Metro.
Auch die handelnden Personen verändern sich. Eine neue Generation von Managern wächst nach, für die Corporate Social Responsibility, Ökobilanzen und Ressourcenmanagement zum Handwerkszeug ihres Berufs gehören. Mit grünen Produkten schwarze Zahlen zu schreiben ist für sie keine spinnerte Idee, sondern eine zukunftsorientierte Strategie. Auch wenn dieser Wandel noch nicht schnell und breit genug stattfindet, so ist er doch ermutigend – er deutet auf das Neue, das sich im Schoß des Alten entfaltet.
Ein zentrales Problem bei der ökologischen Transformation des Kapitalismus ist der Mangel an global gültigen Regeln und Mindeststandards. In diese Lücke stoßen Initiativen, die auf eine kooperative Regulierung von Märkten zielen. Auch ihre Zahl wächst. Sie setzen da an, wo staatliche Regulierung wegen fehlender internationaler Übereinstimmung noch nicht möglich ist. In der Extractive Industrie Transparency Initiative beispielsweise arbeiten führende Öl- und Gaskonzerne mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Entwicklungsbanken gemeinsam an dem Ziel, die Geldflüsse aus Öl und Gasprojekten in ressourcenreichen Ländern transparent zu gestalten. Bei der Ethical Trading Initiative und der Fair Labor Association geht es den teilnehmenden Unternehmen, NGOs und Gewerkschaften um die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).
Der Finanzmarkt als Seismograf
Etwa seit dem Jahr 2000 ist eine zunehmende Relevanz von Nachhaltigkeits-Indikatoren im Rating von Unternehmen zu beobachten. Pensionsfonds sprechen von einer „fiduciary duty“ (Treuhänderpflicht), ökologische und soziale Kriterien in ihre Anlagestrategie einzubeziehen, um das Risiko für ihre Anleger zu reduzieren. Milliardenschwere Anleger wie US-Pensionsfonds oder der aus Ölgeldern gespeiste norwegische Zukunftsfonds legen ihre Gelder nur noch in Unternehmen an, die soziale und ökologische Mindeststandards erfüllen. Der bislang erfolgreichste Zusammenschluss institutioneller Investoren ist das Carbon Disclosure Projekt (CDP), das sich auf klimarelevante Risiken und Daten konzentriert.
Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist das CDP von 25 auf 650 Investoren gewachsen und hat heute ein Anlagevolumen von sagenhaften 78 Billionen US-Dollar. 80 Prozent der weltgrößten Unternehmen berichten regelmäßig an CDP über ihre Treibhausgas-Emissionen und ihre Aktivitäten zu ihrer Minderung. Die Tätigkeit des CDP hat den Druck auf Börsenaufsicht, Unternehmen und Wirtschaftsprüfer verstärkt, transparente Berichtsstandards zu Klimarisiken zu entwickeln. Das Projekt basiert auf der Erkenntnis, dass hohe CO2-Emissionen ein Risiko für die langfristige Werthaltigkeit von Investitionen bedeuten. Umgekehrt reduzieren höhere Energieeffizienz und die Substitution fossiler Rohstoffe die Krisenanfälligkeit von Unternehmen und steigern ihre langfristige Rentabilität.
Was kann, was muss Politik bewirken?
Mit den neuen Dynamiken in der Unternehmenswelt, dem Auftreten neuer Akteure und neuer Allianzen wird staatliche Regulierung nicht überflüssig – ganz im Gegenteil: um ökologischen Innovationen und Pionierunternehmen zum Durchbruch zu verhelfen, braucht es einen politischen Rahmen, der grüne Investitionen langfristig rentabel macht. Originäre Aufgabe der Politik bleibt, den Märkten „ökologische Leitplanken“ vorzugeben und den Umbau der Infrastruktur voranzutreiben. Die wichtigsten Hebel dafür sind:
-
Eine globale, degressiv gestaltete Deckelung der CO2-Emissionen in Form eines verbindlichen Klimaschutzabkommens;
- die Einbeziehung weiterer Branchen in die Regulierung der CO2-Emissionen (Schifffahrt, Luftverkehr) und die Etablierung eines globalen CO2-Marktes;
- die Umstellung des Steuer- und Abgabensystems von der Besteuerung der Arbeit auf Ressourcensteuern;
- der Aufbau eines gesamteuropäischen Verbundsystems erneuerbarer Energien mit dem Ziel, den Strombedarf bis zur Mitte des Jahrhunderts vollständig aus regenerativen Quellen zu decken;
- der Ausbau der öffentlichen Transportsysteme auf lokaler und transnationaler Ebene und die Förderung der Elektromobilität;
- die ökologische Modernisierung der Städte und die Vorgabe progressiver Standards für die Energieeffizienz von Gebäuden;
- massive Investitionen in Forschung und Entwicklung erneuerbarer Energien und umweltfreundlicher Technologien;
- Informationspflicht hinsichtlich der Ökobilanz von Produkten und Materialien;
- der Transfer umweltfreundlicher Technologien in die Entwicklungsländer, um deren wirtschaftliches Wachstum in ökologische Bahnen zu lenken.
Mit diesen Schlüsselprojekten der ökologischen Transformation sind zugleich die Eckpunkte für einen „European Green New Deal“ beschrieben, der eine neue lange Welle ökologischer Innovationen, Investitionen und Jobs lostreten wird. Europa wird sich aus der aktuellen Schuldenkrise nicht durch bloße Sparpolitik befreien können.
Es braucht nachhaltiges Wachstum, um die öffentlichen Haushalte wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die grassierende Arbeitslosigkeit unter der jungen Generation zu überwinden und den Sozialstaat zu finanzieren. Europa hat das wissenschaftliche, technische und politische Potenzial, um zum Vorreiter für die ökologische Transformation der Industriegesellschaft zu werden und damit zugleich das Fundament für den Wohlstand von morgen zu legen. Lasst uns diese Chance nutzen!