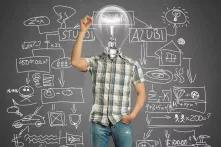Moderatorin Ulrike Plewnia brachte den Anlass des Streitgesprächs auf den Punkt: In diesem Jahr haben sich erstmals mehr junge Menschen für ein Studium als für eine Berufsausbildung entschieden – damit studieren etwa 50% eines Altersjahrgangs. Die Zahl der Studienberechtigten hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt, wie Akademisierungskritiker Julian Nida-Rümelin hinzufügte. Ist das ein Problem? Nein, ist es nicht, wenn man die folgenden Argumente gelten lässt:
- Der demografische Wandel in Deutschland schreit förmlich nach einer hohen Studienanfängerquote von mehr als 45%, wie Barbara Dorn gleich zu Beginn klarmachte. Nur so kann das Fachkräfteangebot an Akademikerinnen und Akademikern in den nächsten Jahren aufrecht erhalten werden.
- Es ist eine Frage der gesellschaftlichen Chancengerechtigkeit, weiterhin hohe Studienberechtigtenzahlen anzustreben: Akademikerinnen und Akademiker genießen nach wie vor sehr gute Bildungs-, Berufs- und Lebenschancen, die ein Studium für junge Menschen offensichtlich attraktiv machen. Diese Möglichkeit darf nicht allein einer privilegierten Gruppe vorbehalten werden, so Kai Gehring. Auch „Arbeiterkinder“ und junge Menschen ohne Abitur müssen eine realistische Chance erhalten, eine Hochschule zu besuchen – wenn sie denn möchten.
- Diese Wahlfreiheit ist ein weiterer Knackpunkt: Jugendliche sollten ihren Bildungsweg weiterhin frei wählen können. „Deutschland braucht keine Bildungsplanwirtschaft“, bekräftigte Kai Gehring. Und was bedeutet die Forderung, den „Akademisierungswahn“ zu stoppen, anderes, als den Hochschulzugang wieder einzuschränken?
- Das Gegenteil muss angestrebt werden: Die Hochschulen sind seit Jahrzehnten chronisch unterfinanziert und kommen aus diesem Grund ihrer Verantwortung, besonders in der Lehre, nicht nach – hier waren sich das Podium sogar einig. Dem Ziel einer soliden Hochschulfinanzierung kann die Kritik der Akademisierungsskeptiker allerdings leicht einen „Bärendienst erweisen“, so Kai Gering.
Neben diesen Gründen, die für eine hohe Studierenden- und Akademikerquote sprechen, machte die Diskussion deutlich, dass die Akademisierung von ihren Kritikerinnen und Kritikern für viele Missstände verantwortlich gemacht wird, die jedoch an anderer Stelle zu beheben wären.
So lautete ein Vorwurf von Julian Nida-Rümelin, dass in Reaktion auf die Empfehlungen der OECD seit Jahrzehnten (!) alle (!!) undifferenziert mehr Studienanfängerinnen und –anfänger forderten und den besonderen Wert der Berufsbildung vernachlässigten. Kai Gehring und Barbara Dorn stellten jedoch klar, dass sie den Chor der OECD-Anhängerschaft nie so einmütig vernommen hätten und dass die Gleichwertigkeit zwischen der beruflichen und der hochschulischen Bildung mittlerweile politischer Konsens sei – zumindest auf dem Papier. Zwar müsse die Gleichwertigkeit auch kulturell noch verankert werden – allerdings käme man diesem Ziel durch die Errichtung von Hürden an den Hochschulen nicht näher, wie Kai Gehring einwendete.
Eine weitere Befürchtung von Julian-Nida-Rümelin war, dass die berufliche Bildung ihren Nachwuchs an die Hochschulen verliert und somit existenziell bedroht sei. Doch auch dieses Bild rückte Barbara Dorn zurecht: Die berufliche Bildung sei nach wie vor attraktiv; Nachwuchsprobleme zeigten sich nur regional und in bestimmten Berufen. Kai Gehring fügte hinzu, dass der Bewerbermangel mancher Ausbildungsberufe, z.B. im Hotelgewerbe, eher durch schlechte Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen bedingt sei. Auch hier sei ein stärker selektiver Hochschulzugang also keine Lösung.
Nicht zuletzt machte Kai Gehring darauf aufmerksam, dass die Debatte um den „Akademisierungswahn“ von einem weitaus wichtigeren Problem ablenke: dem deutschen „Bildungskastensystem“ mit seinen früh einsetzenden Selektionsmechanismen. Hierfür erhielt er Unterstützung aus dem Publikum: Wenn das Bildungssystem nicht so viele Menschen durch Schul-, Ausbildungs- und Studienabbrüche verlieren würde, müssten Berufsbildung und Hochschulen sich vielleicht weniger um junge Menschen streiten.