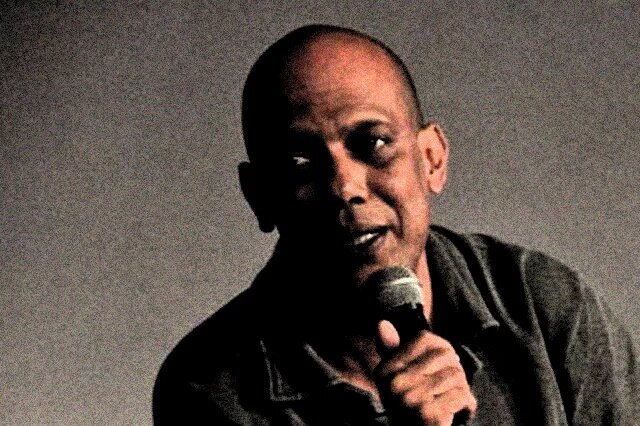
Jede Auswahl ist eine Auswahl, und da ist es das gute Recht eines jeden, sich für Nichtausgewählte einzusetzen, zumal es bei einem Gesamtbudget von gut 6 Millionen Euro, dass die brasilianische Regierung unter geringer Beteiligung privater Sponsoren für die Buchmesse einsetzt, durchaus etwas zu gewinnen und verlieren gibt.
Paulo Coelhos Einsatz für minderberücksichtige Jugendbuchautoren mutet allerdings merkwürdig an – immerhin ist die Liste schon seit März bekannt. Eigentlich fehlen weniger bekannte als eher unbekannte Namen – gerade im Bereich der Literaturkritik und –wissenschaft gibt Frankfurt ein Stelldichein der Immergleichen. Ob die Auswahl rassistisch ist, wie Paulo Lins („Cidade de Deus“) zu verstehen gab, kann man diskutieren – Lins hat dies selbst gegenüber brasilianischen Journalisten relativiert.
Nicht zu diskutieren ist die Frage, ob es in Brasilien Rassismus gibt. Darauf wollte Lins aufmerksam machen, und zwar gerade, weil es ein verschleierter Rassismus ist. Einer der größten Schriftsteller Brasiliens, Joaquim Maria Machado de Assis, war ein Schwarzer. Man feierte ihn durchaus bereits zu Lebzeiten. Die neugegründete Brasilianische Akademie für Literatur ernannte ihn zu ihrem ersten Präsidenten. Das war 1879; in Brasilien herrschte noch immer offiziell die Sklaverei. Ein anderer schwarzer Autor, Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922), Vater und Mutter noch als Sklaven geboren, konnte studieren, Ministerialbeamter werden und in seinen Werken durchaus auch die Vorurteile der Alten Republik kritisieren, bis er sich dem Alkohol ergab.
Es hat nie getrennte Parkbänke oder einen Ku-Klux-Klan gebraucht, um die Schwarzen bis heute als ein stehendes Heer unqualifizierter Schlechtbezahlter zu halten, dass der weißen Mittelklasse billig den Rücken freihält. Erst seit diesem Jahr gibt es gesetzlich verbriefte Mindestrechte für (schwarze) Hausangestellte wie einen freien Tag in der Woche und einen Mindestlohn. Bei allen Sozialindizes – vom Durchschnittseinkommen bis zur Kindersterblichkeit – klafft eine enorme Lücke zwischen Schwarz und Weiß in Brasilien, die schwarze Mittelklasse ist viel kleiner als in den USA. Der Samba, jene schwarze Musik, über die Paulo Lins nun geschrieben hat, wurde lange polizeilich verfolgt, bis ihn Getúlio Vargas in den 1930-er Jahren zur Nationalkultur erklärte, als Teil jenes erfolgreichen Diskurses der Rassendemokratie, der vieles verdeckt. Es hat sich für die Armen und unteren Einkommensschichten – also überproportional für Schwarze - vieles verbessert in den letzten Jahren. Aber vielleicht gerade weil es eine Apartheid nie gab, wird seit einiger Zeit so heftig über Quoten diskutiert, für die Unis oder etwa für den Auswärtigen Dienst.
Aus brasilianischer Perspektive fällt aber in diesen Tagen etwas anderes ins Auge: Das Brasilien, das 2010 zum Gastland der Buchmesse auserkoren wurde, erscheint wie ein Land aus anderer Zeit. Schwer vorstellbar, das Luiz Ruffato seinerzeit eine solche Eröffnungsrede gehalten hätte. Wirtschaftswachstum von 7,5%, vor Selbstbewusstsein strotzend, den Sieg gegen die Armut ebenso zum Greifen nahe wie eine Position unter den Großen der Welt, war Brasilien ein Champion, als Präsident Lula seinem Zögling Dilma Rousseff die Präsidentenschärpe umhängte.
Brasilien im Oktober 2014 ist Brasilien nicht nur fast ohne Wirtschaftswachstum, es ist das Brasilien nach den Juniprotesten. Die Proteste sind vielfältig und vielschichtig gewesen. Sie haben viel zu tun mit dieser Erfolgserzählung, die einfach nicht mit den Alltagserfahrungen der Menschen zusammengeht: Verkehrs- und Dienstleistungschaos, nicht nachlassende Alltagskriminalität, eine brutale Polizei und eine täglich zu erlebende und nachzulesende Korruption und Vetternwirtschaft, die unverhohlene Selbstbedienungsmentalität nicht nur der politischen Klasse. Da richtet ein Land die teuerste WM aller Zeiten aus, aber für die Zukunft der Gesellschaft ist nicht genug Geld da. „Wir wollen Krankenhäuser und Schulen nach FIFA-Standard“ lautete ein Schlüsselsatz der Proteste. Das kostenlose öffentliche Gesundheitswesen ist eine Errungenschaft nur dann, wenn es ausreichend Ärzte und Ausstattung hat und die Leute nicht sterben, bevor sie einen OP-Termin zugeteilt bekommen.
Und so sehr Brasilien seinen Hochschulbereich zumindest quantitativ ausgebaut hat, so fortgesetzt waltet der Skandal im öffentlichen Grundschulwesen, das seine Schüler und Lehrer verurteilt – die einem zu einem Leben als Hilfsarbeiter, die anderen zu unterbezahlter und mangelqualifizierter Dauerfrustration. In Rio de Janeiro streiken seit zwei Monaten die Lehrer der öffentlichen Schulen, sehr zu Recht und doch wieder zum Schaden der Schüler. Wie gegen die Demonstranten im Juni geht die Polizei gegen sie vor mit der Härte, die sie in der Militärdiktatur gelernt hat. Die überfällige Polizeireform gehört auch noch auf die Liste.
Brasilianische Schriftsteller haben in Frankfurt eine Solidaritätserklärung an die streikenden Lehrer in Rio geschickt. Verständlicherweise wollen viele brasilianische Autorinnen und Autoren ihr Schreiben universalisieren, wegbewegen von den üblichen brasilianischen Themen, ob in Kultur oder im Sozialen. In Frankfurt, so scheint es, holt sie das Konkrete ihrer heimischen Gegenwart wieder ein.