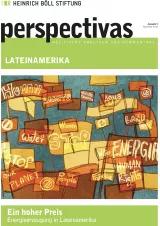Die Regierung von Präsident López Obrador geht ins zweite Jahr. Viele Veränderungen sind auf dem Weg. Aber die Sicherheitslage ist dramatisch schlecht und bedroht – mehr als die stagnierende Wirtschaft – die Zukunft der neuen Regierung und der Menschen.

Seit einem Jahr lebt Mexiko im Zeichen der „Vierten Transformation“. Darunter macht es der neue Präsident Andrés Manuel López Obrador nicht: Nach der Unabhängigkeit von der spanischen Krone 1821, den liberalen Reformen Mitte des 19. Jahrhunderts und der Revolution ab 1910 sollen Gesellschaft und Politik Mexikos nun zum vierten Mal grundlegend verändert werden. Die Voraussetzungen sind gegeben: Er gewann die Direktwahl mit überwältigenden 53 Prozent gegen die Kandidaten der Regierungsparteien der letzten 90 Jahre und weiß eine solide Mehrheit seiner Partei Morena in Bundes- und vielen Landesparlamenten hinter sich.
Am 1. Dezember 2018 ließ López Obrador sich vor der Kathedrale von Mexiko-Stadt von indigenen Schamanen segnen und von Hunderttausenden bejubeln. Vielen Menschen standen die Freudentränen in den Augen. Sie erlebten einen messianischen Moment. Obwohl López Obrador selbst in der früheren Dauerregierungspartei PRI politisch groß wurde und ein altgedienter Politiker ist, sah und sieht die Mehrheit in ihm die Alternative. Dass er persönlich glaubhaft integer und bescheiden ist sowie über viel Charisma verfügt, hilft ihm.
Die Hoffnung auf Veränderung ist so groß wie die Veränderung nottut. Das hat AMLO, wie der Präsident allgemein genannt wird, im Gepäck, als Wegzehrung, aber auch als Ballast. Die Latte hängt hoch, und die Zeit drängt, während viele Probleme altüberliefert sind und tief eingegraben in politische, soziale und mentale Strukturen. Ein Jahr nach Amtsantritt scheint es, als sprängen eher die alten Übel über die Latte als die neue Regierung. Noch stehen zwei Drittel der Mexikaner laut Umfragen hinter ihm. Aber das kann sich schnell ändern.
Die Mexikaner/innen hatten allen Grund López Obrador zu wählen
Nach 16 Jahren „Krieg gegen die Drogen“ kontrollieren Drogenbanden zwei Drittel des Staatsgebietes. Staatliche Behörden, allen voran Polizei und Justiz sind ihnen vielfach in makrokriminellen Netzwerke kooperativ verbunden. Dass einige Kartelle geschwächt sind, hat den mörderischen Disput um die lukrativen Routen und Umschlagplätze nur ausgeweitet und verschärft. Auch die Alltagskriminalität steigt. Der mexikanische Staat hat alle Institutionen, die eine moderne Demokratie braucht, simuliert aber nur Rechtsstaatlichkeit, die allenfalls jene erreicht, die genug Schmiergeld zahlen können. Unverändert gilt rund die Hälfte der Mexikaner/innen als arm.
„Für das Wohl aller: die Armen zuerst“
López Obrador hat Korruption und „Neoliberalismus“ zu den Grundübeln Mexikos erklärt und macht immer wieder deutlich, wem er sich verpflichtet fühlt: den armen Mexikaner/innen, also der Mehrheit der Bevölkerung. Mit der Antikorruptionspolitik macht die Regierung soweit sie kann ernst. Steuersünder werden gestellt, unzulässige Steuergeschenke, vor allem an Großverdiener/innen, rückgängig gemacht. Ausgaben staatlicher Stellen werden streng kontrolliert und reglementiert. Den oberen Gehaltsgruppen wurden die Bezüge sowie allen Behörden generell Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrzeuge, Personal und Sachausgaben gekürzt.
Gleichzeitig hob die Regierung den Mindestlohn um 16 Prozent an. Erfahrungen aus Südamerika der letzten 20 Jahre zeigen, dass substantielle Mindestlohnerhöhungen Armut wirksam mindern können. Ein Großteil des Bundeshaushalts geht zudem seit Januar 2019 in Cash-Transferprogramme. So erhalten alle Mexikaner/innen über 68 Jahre (Indigene: 65) eine Basisrente von 60 Euro. Arbeitslose junge Menschen beziehen bis zu 12 Monate 170 Euro wenn sie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Unternehmen absolvieren. Für bedürftige Schulkinder und Studierende stehen Stipendien bereit. Auf Millionen von Hektar sollen Kleinbauern und arme Landarbeiter/innen für 230 Euro im Monat Obstbäume und Gemüse anpflanzen.
Für die Sozialprogramme standen 2019 rund vier Milliarden Euro bereit, für 2020 hat die Regierung noch 400 Millionen Euro draufgelegt. 2019 wurden bei einigen Programmen die Mittel nicht gänzlich abgerufen, vor allem die Unternehmen beteiligen sich kaum. Kritiker monieren, dass die Regularien nicht transparent und die Programme daher verkappte Klientelpolitik seien. Die Regierung weist darauf hin, dass mit den Direkttransfers korruptionsträchtige Mittlerinstitutionen ausgeschaltet würden, vor allem die in den einzelstaatlichen und kommunalen Regierungen. Gerade hat der Präsident eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, nach der die Sozialprogramme in der Verfassung verankert werden sollen – etwas, das die Arbeiterpartei in Brasilien in 14 Jahren nicht hinbekam.
Umweltpolitik: kein Geld, fossile Energiepolitik, aber ein kämpferischer Minister
Um die genannten Sozialprogramme und das enorme Defizit des staatlichen Erdölkonzerns Pemex zu finanzieren, haben einige Ressorts deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Das betrifft besonders das Umweltministerium und seine nachgeordneten Behörden. Die Entwicklungspolitik der Regierung und des Präsidenten ist klassisch dem verpflichtet, was in Lateinamerika „desarrollismo“ heißt: eine auf nachholende Industrialisierung und energetische Autarkie ausgerichtete Politik mit starkem Staat und einer ausgeprägten Sozialpolitik. Im Erdölland Mexiko bedeutet das, Pemex zu fördern, koste es, was es wolle, und eine neue Raffinerie zu bauen. Wind- und Sonnenenergie werden nicht mehr gefördert. Grundlage der Stromerzeugung sollen Öl, Gas und Wasserkraft sein. Damit bleibt auch die Befürchtung bestehen, dass die Regierung – entgegen des Versprechens des Präsidenten – in naher Zukunft doch auf Fracking setzen wird.
Für Überraschung sorgte hingegen die Ernennung des 74-jährigen Biologie-Professors Victor Toledo, Experte für und Anhänger von indigener Kultur, Spiritualität und Wissen, zum Umweltminister. Gemeinden in Territorien mit sozial-ökologischen Konflikten erhoffen sich nun mehr Gehör bei der Regierung. Toledo hat zwar kaum Geld, nutzt aber seine Position, um immer wieder Korrekturen der Entwicklungspolitik einzufordern. Wie weit sein Einfluss tatsächlich reicht, ist ungewiss. Eine Eisenbahnlinie soll Pazifik und Golf von Mexiko verbinden, auf beiden Seiten sind neue bzw. modernisierte Häfen und Industrieparks vorgesehen. Auch ein Eisenbahnprojekt im Süden Mexikos, der „Maya-Zug“ wurde gegen Bedenken und bereits anfängliche Proteste wegen erheblicher Umweltschäden und sozialer Verwerfungen in großer Eile aufgesetzt. Teile sind bereits ausgeschrieben, bevor Umweltverträglichkeitsprüfungen stattfinden konnten.
Helldunkel nicht nur in der Migrationspolitik
Vertreter/innen der kritischen Zivilgesellschaft analysieren das erste Jahr als ein „Helldunkel“. In die Hoffnung auf Veränderung und die Freude über einen besseren Zugang zur Regierung – in der viele aus der Zivilgesellschaft eine Anstellung gefunden haben – mischt sich zunehmend Sorge. Die One-Man-Show des Präsidenten, der zunehmend volksmoralische Lehren über Anstand und Benimm erteilt, der die Zivilgesellschaft pauschal als wirkungslos, konservativ und letztlich überflüssig schmäht und vielen wichtigen Organisationen wie z.B. Frauenhäusern die Zuschüsse gestrichen hat, passt nicht ins Bild einer modernen, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zugewandten Politik. Genauso wenig wie seine widersprüchliche Sicherheits- und Menschenrechtspolitik, die dem Militär gewichtigen Einfluss auf Politik und Ökonomie gewährt und wichtigen Politiksektoren teilweise brutal den Haushalt kürzt.
Sehr anschaulich wird das Helldunkel im Umgang mit den Migrant/innen aus Mittelamerika. Die neue Regierung verkündete, sie wolle nunmehr im Verbund mit den Regierungen der Herkunftsländer und der USA Ursachen von Flucht und Migration bekämpfen. Migrant/innen sollten als Verfolgte anerkannt und in Mexiko humanitär behandelt sowie Arbeitserlaubnis erhalten, einschließlich entsprechender VISA. Es hieß, ihnen stehe ein Asylverfahren offen und man werde die Durchführungsorganisationen stärken, damit das auch zügig ablaufe. Während die Institutionen vergeblich auf mehr Geld warteten, machten sich Karawanen von Mittelamerikaner/innen nach Mexiko auf. Sie zählten eher Hunderte als Tausende, bebilderten aber ein Szenario, mit dem US-Präsident Trump wirkungsvoll seine Öffentlichkeit vor den Fluten von dunkelhäutigen Kriminellen warnen, erneut sein Mauerprojekt in Stellung bringen und enormen Druck auf die mexikanische Regierung ausüben konnte.
Ein halbes Jahr später erkannte Mexiko sich de facto als „Sicherer Drittstaat“ an. Die US-Behörden können nun die wenigen, die es noch bis in die USA schaffen und dort einen Asylantrag stellen, für die Dauer des Verfahrens nach Mexiko zurückschieben und von dort aus in ihre Heimat deportieren. Die Südgrenze Mexikos sichert nun die neue Nationalgarde. Von humanitären Visa und Arbeitserlaubnis ist keine Rede mehr. Die Regierung AMLO schiebt mehr Mittelamerikaner/innen ab als die Vorgängerregierung. Die mexikanische Migrations- und Asylpolitik ist zu dem zurückgekehrt, was sie überwinden wollte. Denn die wichtigste außenpolitische Maxime des an Außenpolitik uninteressierten Präsidenten lautet: Die Beziehungen zu den USA, von denen Mexiko 80 Prozent seiner Waren bezieht und in die es 70 Prozent seiner Waren exportiert, wo Millionen von Mexikaner/innen leben, viele von ihnen ohne die nötigen Bleibedokumente, darf niemand und nichts gefährden, kein Präsident Trump und keine Migrant/innen-Karawane.
Wirtschaft: kein Wachstum, aber Investitionsabkommen mit Unternehmen
Die Wirtschaft des Landes stagniert derzeit; AMLO hatte durchschnittlich vier Prozent Wachstum für seine sechsjährige Amtszeit versprochen. Das scheint schon jetzt kaum noch erreichbar. Andererseits sind trotz ständiger Repressalien aus Washington die Exporte in das Nachbarland USA gestiegen und es gelang, eine Neuauflage des Freihandelsabkommens USA-Kanada-Mexiko zu verhandeln. Eine der ersten Amtshandlungen AMLOs war es, den Bau des neuen Großflughafens in Mexiko-Stadt zu stoppen. Das habe Investoren verunsichert, heißt es. AMLO hofiert die Unternehmen nach Kräften und hat versprochen, keine Steuern zu erhöhen. Er folgt hier fast allen linken Präsidenten in Lateinamerika: Sie alle haben ihre hochregressiven Steuersysteme im Wesen nicht angetastet. Stattdessen hat AMLO Anfang Dezember im Beisein zahlreicher Großunternehmer überraschend ein Nationales Infrastrukturabkommen verkündet. In den nächsten fünf Jahren will die Privatwirtschaft 40 Milliarden Euro für 147 Projekte wie Straßen, Bahnlinien, Häfen, Flughäfen oder Krankenhäuser bereitstellen.
Die Inflation ist niedrig und offenbar unter Kontrolle. Regierungsangaben zufolge entstanden 2019 mehr als 648.000 Jobs. Der gestiegene Mindestlohn und die Transferprogramme sollen die Kaufkraft der unteren Schichten steigern. Einer repräsentativen Umfrage der Tageszeitung El Universal zufolge haben knapp 28 Prozent mehr Einkommen als vor einem Jahr. Das bedeutet, die wirtschaftliche Lage ist keine unmittelbare Bedrohung für die Fortsetzung der „Vierten Transformation“.
Die Hauptbedrohung: die schwere Sicherheits- und Menschenrechtskrise
Unmittelbar bedrohlich, für die Zukunft der Regierung wie die vieler Mexikaner/innen, ist dagegen die schwere Krise der öffentlichen Sicherheit. Enrique Peña Nieto hat seinem Nachfolger mindestens 40.000 Verschwundene, 37.000 nichtidentifizierte Leichen, die zum Teil seit vielen Jahren in Kühlhäusern lagern, sowie mehrere tausend Massengräber hinterlassen – alles Ergebnisse des Krieges gegen die Drogen seit 2006. Und unter AMLO ist es noch schlimmer geworden. Just am 1. Dezember 2019, dem Jahrestag des Amtsantritts, wurden 127 Menschen in Mexiko ermordet. Das ist neuer Rekord im Rekordjahr, in dem durchschnittlich fast 100 Menschen pro Tag gewaltsam ums Leben kamen und damit mehr als in allen Jahren der Vorgängerregierung.
Im Wahlkampf versprach AMLO eine menschenrechtsorientierte Sicherheitspolitik. Und tatsächlich hat sich auf der symbolischen Ebene viel verändert. Hochrangige Regierungsvertreter/innen wie die Innenministerin Sánchez Cordero haben sich öffentlich für Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit entschuldigt – undenkbar unter allen Vorgängerregierungen. Der Präsident trifft sich immer wieder mit Opferangehörigen. Eine kompetente Kommission unter Beteiligung von Menschenrechtsorganisationen sucht nach den vor fünf Jahren verschwundenen 43 Studenten aus Ayotzinapa. Zuletzt nahm der Staatssekretär für Menschenrechte wieder Gespräche mit Menschenrechts- und Opferverbänden über zusätzliche Wege auf, wie die in Kühlhäusern, Massengräbern und verwundeten Herzen vergrabene Gewaltlast der letzten zwei Jahrzehnte juristisch wirksam und mit internationaler Unterstützung gehoben und bearbeitet werden könne. Alejandro Encinas ist das aktivste Bindeglied der Regierung in die vom Präsidenten gerne als konservativ und wirkungslos geschmähte Zivilgesellschaft.
Rückkehr zum Militarismus?
Auf der anderen Seite verkündete AMLO nur Tage nach Amtsantritt, er werde eine Nationalgarde schaffen, um für innere Sicherheit zu sorgen – eine klassische Polizeiaufgabe. Die Garde solle vor allem aus Militärs bestehen und auch militärisch organisiert sein. Zwar ist sie nach heftigem Streit unter zivile Oberaufsicht gestellt worden, aber wo jetzt „Nationalgarde“ draufsteht, ist Militär drin. Beim Einsatz der Nationalgarde in Städten und Dörfern, sowohl bei Demonstrationen und gegen mittelamerikanische Flüchtlinge als auch im Kampf gegen die hochgerüsteten Kartelle sind Menschenrechtsverletzungen vorprogrammiert, so die Befürchtung von Amnesty International und aller anderen großen und kleinen Menschenrechtsorganisationen.
So hat das Militär nun wieder die Sicherheitspolitik in den Händen. Aber es hat offenbar keine abgestimmte Strategie. Eigentlich ist die Regierung abgerückt von der Jagd auf Drogenhändler. Prävention und Präsenz sollen die Gewalt verringern. Doch dann nahmen Mitte Oktober Sicherheitskräfte in Sinaloas Hauptstadt Culiacán einen der Söhne und Nachfolger des legendären Anführers des Sinaloa-Kartells „Chapo“ Guzmán fest – nur um ihn Stunden danach wieder laufen lassen zu müssen. Das Kartell war vorbereitet und drohte glaubhaft genug damit, in der Stadt ein Massaker anzurichten.
Die Polarisierung liegt in der Geschichte Lateinamerikas selbst
AMLO wird vieler Dinge bezichtigt: Er agiere noch immer im Wahlkampfmodus, sei autoritär, beratungsresistent, populistisch, bei Kritik sehr dünnhäutig und bereite die unzulässige Verlängerung seiner Amtszeit vor wie Evo Morales, dem er schändlicherweise auch noch politisches Asyl gewährt habe, er treibe das Land in die ökonomische Krise und die Unternehmer vor sich her, er missachte die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz, betreibe dieselbe Klientelpolitik wie seine Vorgänger.
Einiges trifft zu, vieles eher nicht. Evo Morales Asyl zu gewähren, setzt eine lange mexikanische Tradition seit den Zeiten des spanischen Bürgerkrieges fort, ist aber auch als – derzeit seltenes – außenpolitisches Signal zu werten: Ohne sich weiter in innere Machtkonflikte einzumischen, wertet die mexikanische Regierung den Putsch in Bolivien als Putsch und positioniert sich an der Seite der Linksregierungen. Dass Alberto Fernández auf seiner ersten Reise als gewählter neuer Präsident Argentiniens Mexiko besucht hat, passt in dieses Bild.
Die Kritik am Präsidenten López Obrador nimmt viel Raum in den Medien ein. In der Summe drückt sie vor allem den Ärger derer aus, die ihre Macht und Privilegien schwinden sehen. Ein teilweiser Elitentausch ist im Gange; Morena, die junge Bewegungspartei, ein Sammelbecken einst linker Kräfte und zunehmend für Opportunisten aus Ex-Regierungslagern, hat die Parlamente des Landes im Sturm genommen. Wie in Präsidialsystemen üblich, werden die obersten Hierarchieebenen ausgetauscht. Morena fehlt es derzeit an (qualifiziertem) Personal, diese Posten alle zu besetzen. Die politische Auseinandersetzung ist von persönlichen Emotionen eingefärbt, mit López Obrador als der Polarisationsfigur. Das reflektiert zum einen, dass die Politik wie die Kommunikation der Regierung auf den Präsidenten zugeschnitten und zugespitzt ist. Die tägliche Pressekonferenz ab sieben Uhr in der Früh ist Ort zugleich der ausgeübten Richtlinienkompetenz des Präsidenten wie seiner Ansichten über die Welt und Gott – Religion und Moral sind in den präsidialen Diskurs eingezogen, ganz wie in vielen Ländern Lateinamerikas. Es heißt, der Präsident treibe die Polarisierung der mexikanischen Gesellschaft voran. Richtiger ist wohl, dass seine Politik den Anliegen der armen Bevölkerungsmehrheit mehr Gehör verschafft, die den Habenden schon seit der Kolonialzeit diametral entgegenstehen. Die Linksregierungen Lateinamerikas seit den späten 1990er Jahren sind in vielem gescheitert, haben es aber vermocht, traditionell beherrschte und über Klientelpolitik ruhiggestellte Bevölkerungsteile an den Staat heranzuführen und ihnen, zum Teil als „neue Mittelschichten“, ein Anspruchsselbstbewusstsein zu verschaffen. Dieses Selbstbewusstsein äußert sich jetzt lautstark gegenüber Links- wie Rechtsregierungen. In den Gesellschaften auf dem sozial ungleichsten Kontinent der Erde hört möglicherweise das „para servirle“, das „stets zu Diensten“, endlich auf zu funktionieren. Damit wird die Polarisierung sichtbar.
Das zweite Jahr wird viel schwerer
Lopéz Obrador hat bei seiner Ansprache am 1. Dezember um Geduld gebeten und Besserung für 2020 versprochen. Bisher ist offen, ob die Vierte Transformation wirklich auf einen politisch-gesellschaftlichen Strukturwandel hinausläuft oder lediglich auf ein strukturelles Weiterso unter anderen ideologischen Vorzeichen. Richtig ist: Wandel braucht Zeit. Richtig ist auch: Diese Zeit hat er nicht, jedenfalls nicht in allen Bereichen. Kurzfristig bestehen Aussichten, dass offene Stellen in den Verwaltungen einigermaßen kompetent besetzt werden und die Ministerien 2020 ihre Haushalte auch sinnvoll ausschöpfen und nicht, wie 2019 etwa in Bildung und Gesundheit, Geld liegen lassen. Und dass einige der Sozialprogramme greifen und mit weiteren Mindestlohnsteigerungen Armut verringert werden kann – wenn die wirtschaftliche Gesamtlage und die USA mitspielen.
Die Sozialprogramme mindern Armut, entziehen den Kartellen aber nicht wie geplant den Nachwuchs. Es ist richtig und mittelfristig alternativlos, bei den Ursachen der Gewalt anzusetzen. Das erfordert aber einen langen Atem, den die akute Krise erstickt. Anderen Erfordernissen ist Trump vor. Zwar kommen die Waffen für die Kartelle aus den USA herübergeschmuggelt, die meisten Konsument/innen der Drogen aus Mexiko leben in den USA und gewaschen werden die Narco-Dollars gerne auf der Wall Street und im Immobilienmarkt in Florida. Aber: Korruption ist ein Struktur- und Mentalitätsproblem zugleich. Es mag nicht ausreichen, Personen auszutauschen, wenn ganze Institutionen von einer über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg eingeübten Herrschaftspraxis durchdrungen sind, die längst die ganze Gesellschaft und den Alltag der meisten Menschen durchsetzt hat.
Aber die Regierung kann hier und jetzt mehr tun. Sie kann dafür sorgen, dass die Abertausenden von Körperresten in Kühlhäusern und Lehmgruben einem Menschen zugeordnet und einer Familie zum Begräbnis übergeben werden. Dafür muss sie die Forensik in den Bundesstaaten stärken und die Opferangehörigen unterstützen. Sie kann beginnen, eine andere, zivile, nicht korrupte Polizei und ermittlungskompetente Polizei aufzubauen bzw. den Bundestaaten und Kommunen dabei helfen, denn dort entscheidet sich die Zukunft der makrokriminellen Netzwerke. Vorschläge dafür liegen auf dem Tisch und finden Widerhall in der Regierung, bisher aber nicht bei López Obrador.
Die mexikanische Gesellschaft lehnt sich gegen den Horror derzeit nicht auf. Aktiv und unüberhörbar wie kein anderer sozialer Akteur gegen die Gewalt sind vor allem die Frauen. Annähernd 3.000 Frauen und Mädchen wurden dieses Jahr bereits ermordet, so viele wie lange nicht. Umstritten ist, wie viele davon als feminicídios zu werten sind, d.h. dass die Frauen und Mädchen sterben mussten, weil sie weiblich sind. Auch alle anderen, alltäglicheren Formen von Gewalt gegen Frauen haben zugenommen. Und die Frauen machen derzeit in Mexiko mobil. Vor allem junge feministische Kollektive zeigen ihre Wut zunehmend nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch auf der Straße. Die Straße, der physische öffentliche Raum – das zeigen die Erfahrungen auf dem Kontinent gerade – ist immer noch der richtige Ort, um Regierungen zum Gespräch zu laden.