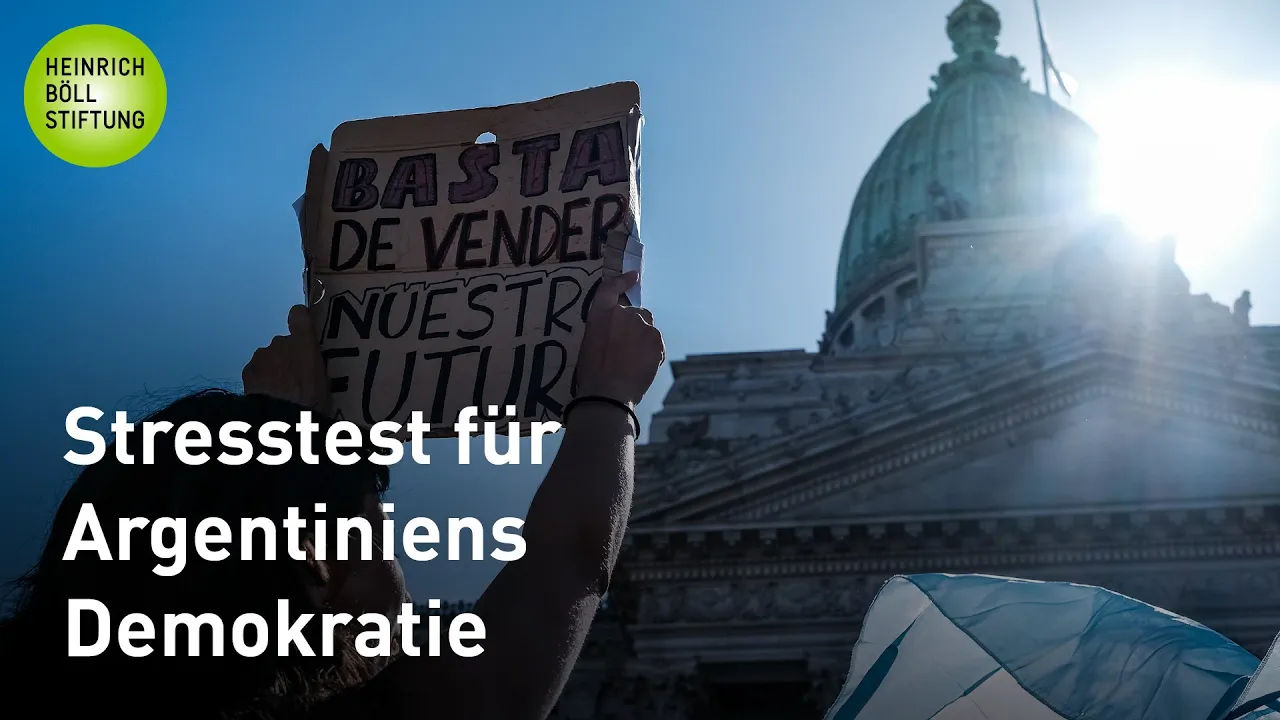Zu den politischen Plänen des rechtslibertären argentinischen Präsidenten Javier Milei gehört nicht nur der radikale Umbau der Wirtschaft, sondern auch die Umdeutung der Geschichte. Die international angesehene Erinnerungs-, Wahrheits- und Gerechtigkeitspolitik zur Aufarbeitung der blutigen Militärdiktatur (1976-1983) soll in ihr Gegenteil verkehrt werden.

Bereits das Wahlprogramm des aktuellen Präsidenten Javier Milei versprach, die Erinnerungs-, Wahrheits- und Gerechtigkeitspolitik aufzukündigen. Neben Milei kandidierte Victoria Villarruel, die aus einer Militärfamilie stammt. Die Zusammensetzung des Kandidaten-Duos für die Präsidentschaftswahl verdeutlichte das: Im Laufe ihrer ersten Monate traf die Regierung folgenreiche Entscheidungen: Institutionen, die für die Aufarbeitung der Militärdiktatur zuständig sind, wurden Mittel gestrichen, Arbeitsfelder abgeschafft und Entlassungen angeordnet. Die Wirkung dieser Politik der Geschichtsumdeutung geht noch viel weiter.
Der radikalste Flügel der rechtslibertären Partei La Libertad Avanza, die auf der argentinischen Regierungsbank vertreten ist, hat sich zum Ziel gesetzt, die Diktatur umzudeuten. Die geheimen und illegalen Repressionsmechanismen in Zeiten der Diktatur (1976-1983) werden verteidigt und die Begnadigung hochrangiger Militärs gefeiert. Verurteilte Täter, die wegen Folter und Mord inhaftiert sind, bekommen offizielle Besuche von Regierungsvertretern. Die Militärdiktatur soll damit in dem sogenannten „Prozess der nationalen Reorganisation“ (Proceso de Reorganización Nacional) wieder salonfähig gemacht werden. Im damals institutionell etablierten Denkschema wurde die Unschuldsvermutung „im Zweifel für den Angeklagten“ umgekehrt und den Verhafteten unterstellt „schon irgendwas angestellt zu haben“ (im Original: „algo habrán hecho“, Anm. d. Ü.). Die Beweislast ihrer Unschuld soll nun wieder den Opfern der Militärdiktatur aufgebürdet werden. Es wird versucht, den Prozess der Aufarbeitung, für Wahrheit und Gerechtigkeit als Exzess zu disqualifizieren. Dadurch werden die Täter*innen zu Opfern stilisiert.
Verurteilungen im Aufarbeitungsprozess der Militärdiktatur
In Argentinien wurden insgesamt 1.187 Personen wegen Verbrechen wie Entführung, Folter und Mord während der Militärdiktatur verurteilt. Ihre Taten hatten sie im Rahmen einer systematischen Terrorkampagne begangen. Heute sitzen davon 508 ehemals Inhaftierte ihre Strafe im Hausarrest ab; 134 Personen sind noch in Gefängnissen. Gegen weitere 500 Personen wurde ermittelt, es kam jedoch entweder zu keiner Anklage oder zu Freisprüchen.
Seit Beginn des Aufarbeitungsprozesses im Jahr 2004 setzen sich verschiedene Gruppen, wie AFyAPPA (Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina) dafür ein, dass ehemalige Mitglieder des Repressionsapparats der Diktatur ihre Strafen nicht absitzen müssen. Mittlerweile haben sich auch neue Gruppierungen mit ähnlichen Zielen wie Puentes para la Legalidad gebildet. Puentes para la Legalidad ist seit 2015 aktiv und setzt sich für „die Verteidigung der Menschenrechte von Personen, die in Argentinien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit inhaftiert sind“ ein. Diese Gruppen sehen in den Gerichtsverfahren Prozesse ideologisch motivierter Rache. Zunächst versuchen sie Straffreiheit für die Angeklagten zu erreichen. Sollte das scheitern, werden die Verfahren an sich in Frage gestellt, um die Verurteilten auf diese Weise freizubekommen. Die derzeitige Vizepräsidentin Argentiniens, Victoria Villarruel, ist eine der prominentesten Fürsprecher*innen dieser Forderungen.
Regierungsbesuche im Gefängnis für verurteilte Mörder der Diktatur
In den vergangenen Monaten seit der Amtseinführung des neuen Präsidenten gab es eine Reihe beunruhigender Ereignisse: Präsident Javier Milei feierte in einer Hommage an den ehemaligen Präsidenten Carlos Menem im Regierungsgebäude Argentiniens die Begnadigungen von 1989 und 1990. Menem hatte während seiner Präsidentschaft hochrangige Mitglieder der Militärdiktatur sowie führende Guerillakämpfer begnadigt. Die Vizepräsidentin Villarruel rief dazu auf, eine „juristische Lösung“ für die rechtskräftig Verurteilten zu finden. Damit verbunden vertrat Innenministerin Patricia Bullrich in einem Interview mit Radio Mitre die Position, dass Personen „ohne triftigen Grund“ im Gefängnis säßen und „die Inhaftierung zu einem Instrument der Rache geworden sei“. Hochrangige Angehörige des militärischen und polizeilichen Repressionsapparats, die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit inhaftiert sind, wurden von Beamt*innen des Verteidigungsministeriums besucht. Schließlich besuchten am 11. Juli im Gefängniskomplex Ezeiza sechs Abgeordnete von La Libertad Avanza (LA), Mileis rechtslibertärem Parteienbündnis, eine Gruppe verurteilter Gefangener, darunter Alfredo Astiz. Alfredo Astiz war ein argentinischer Militär und Geheimdienstoffizier, der während der Militärdiktatur Verbrechen gegen die Menschlichkeit beging. Noch verbüßt er eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen seiner Rolle in der ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), der bekanntesten geheimen Haftanstalten und Folterzentren der argentinischen Militärdiktatur. Dort organisierte er Entführungen von Menschenrechtsaktivist*innen und war beteiligt an der Ermordung von Gefangenen wie den französischen Nonnen Alice Domon und Léonie Duquet. Zu diesen beiden Opfern der Militärdiktatur erklärte der Abgeordnete Beltrán Benedit (LA,) dass sie „ehemalige Kämpfer gegen den marxistischen Umsturz“ waren.
Angriff auf Archive
Die juristische und historische Aufarbeitung der Dokumente, die von den staatlichen Behörden während der Diktatur erstellt wurden, ist von essenzieller Bedeutung für die Rekonstruktion von Ereignissen und Verantwortlichkeiten. Mileis Regierung gefährdet mit einer Reihe von Maßnahmen diese wichtigen Archive. Zum einen wurde das Dokumentenerhebung und -analyse Team des Archivs (Equipos de Relevamiento y Análisis sobre Archivos de las Fuerzas Armadas) aufgelöst. Dieses Team war für die Analyse von Archiven der Streitkräfte zuständig und lieferte entscheidende Beweise für die Aufklärung der Todesflüge sowie anderer Verbrechen der Diktatur. Darüber hinaus löste die Regierung die Koordinierungsstelle zur Dokumentation der Rolle des Geheimdienstes bei Menschenrechtsverbrechen auf. Sie hatte ihren Sitz im Gebäude des ehemaligen Geheimdienstes AFI (Agencia Federal de Inteligencia). Die Leitung für das Nationale Archiv der Erinnerung (Archivo Nacional de la Memoria) wurde nicht besetzt. Neben anderer bedeutender Dokumente ist das Archiv auch für die Archivierung der Dokumente der Nationalkommission über das Verschwinden von Personen (CONADEP) verantwortlich.
Regierungshandeln gegen Gedenkstätten
In Argentinien wurden zwischen 1976 und 1983 an 814 Orten Menschen gefangen gehalten, gefoltert und verschwanden. Viele dieser Orte wurden in Gedenkstätten oder Museen umgewandelt.
Mileis Regierung entzog allen Gedenkstätten im Land die Finanzierung und entließ die Hälfte der Belegschaft der acht Gedenkstätten - Esma, Olimpo, Regimiento de Infantería 9, Virrey Cevallos, Club Atlético, Famaillá, Orletti und Esmi - die dem Sekretariat für Menschenrechte unterstehen. Infrastrukturarbeiten, archäologische Ausgrabungen und Maßnahmen zur Erhaltung von Stätten, die als Beweismittel dienen könnten, wurden gestoppt. Nicht zuletzt duldete Mileis Regierung Zeremonien-artige Treffen in militärischen Einrichtungen wie auch dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Esma, der heutigen Gedenkstätte Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex Esma. Im Mai 2024 stimmten Esma Marine-Absolventen des Jahrgangs 1978 anlässlich des Tags der argentinischen Marine die Marinehymne in den Anlagen der Esma an. Auf allen diesen Versammlungen wurde durchgängig eine Neubewertung der Diktatur gefordert.
Andauernde Suche nach Opfern wird behindert
Die Suche nach heute erwachsenen Männern und Frauen, die im Kindesalter entführt wurden und denen eine neue Identität aufgezwungen wurde, erfordert die Beteiligung des Staates. Diese Verbrechen wirken heute noch nach: Geschätzte 300 Personen wurden ihrer Identität beraubt. Ihre Familienangehörigen suchen seit fast 50 Jahren nach ihnen.
Mileis Regierung entschied, dass die Ministerien für Verteidigung und Sicherheit keine Akten der Streitkräfte, der Polizeibehörden sowie der Sicherheitsbehörden auf Bundesebene an die Nationale Kommission für das Recht auf Identität (CoNaDi) übermitteln sollen. Diese sollten die behördlichen Ermittlungen zur Suche nach entführten Kindern unterstützen. Darüber hinaus wurde eine Änderung der Nationalen Datenbank für Genetische Information sowie die gänzliche Abschaffung der CoNaDI und ihrer gesonderten Untersuchungseinheit verfügt.
Wiedergutmachungszahlungen
Die Wiedergutmachungszahlungen an Opfer der Diktatur sind Bestandteil internationaler Verpflichtungen, die Argentinien seit 1992 als Teil der jeweiligen Regierungspolitik eingegangen ist. Sie haben eine rechtliche Grundlage und wurden von verschiedenen Regierungen fortgeführt. Die Justiz war an der Umsetzung beteiligt.
Eine umfassende Prüfung aller Anträge, die im Rahmen des Wiedergutmachungsrechts für die Opfer des Staatsterrorismus eingereicht wurden, wurde von der Milei Administration angeordnet. Zusätzlich wurde ein Auszahlungsstopp bis zum Ende des Verfahrens verfügt und sechzehn Angestellte des Sekretariats für Menschenrechte, die mit Wiedergutmachungsrecht befasst waren, entlassen.
Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Aufarbeitung der Diktatur
Die Bemühungen um Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit begannen bereits, während noch Verbrechen begangen wurden. Es waren zivilgesellschaftliche Organisationen, wie die Bürgerliche Vereinigung der Großmütter der Plaza de Mayo (Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo) oder die Angehörigen der Verschwundenen und aus politischen Gründen Inhaftierten (Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas), die als erste ein Ende des Terrors und anschließend eine Untersuchung, Bestrafung und Wiedergutmachung forderten.
Dass diese Forderungen schließlich Teil staatlicher Politik wurden, ist auf 40 Jahre Demokratie in Argentinien zurückzuführen. Viele dieser Maßnahmen können nur vom Staat vorangetrieben werden: wie z.B. die Wiederherstellung der Identitäten entführter Kinder und die juristische Untersuchung von Repressionsorganen sowie der Zugang zu Archiven.
Diese Maßnahmen auszusetzen wird einen kaum abschätzbaren Schaden zur Folge haben. Die Relegitimierung diktatorischer Gewalt, einer Form des Staatsterrorismus, zielt darauf ab, Repression zu zulassen. Auch dies wird unermessliche Folgen haben.
Video-Mitschnitt der Veranstaltung vom 27. November 2024