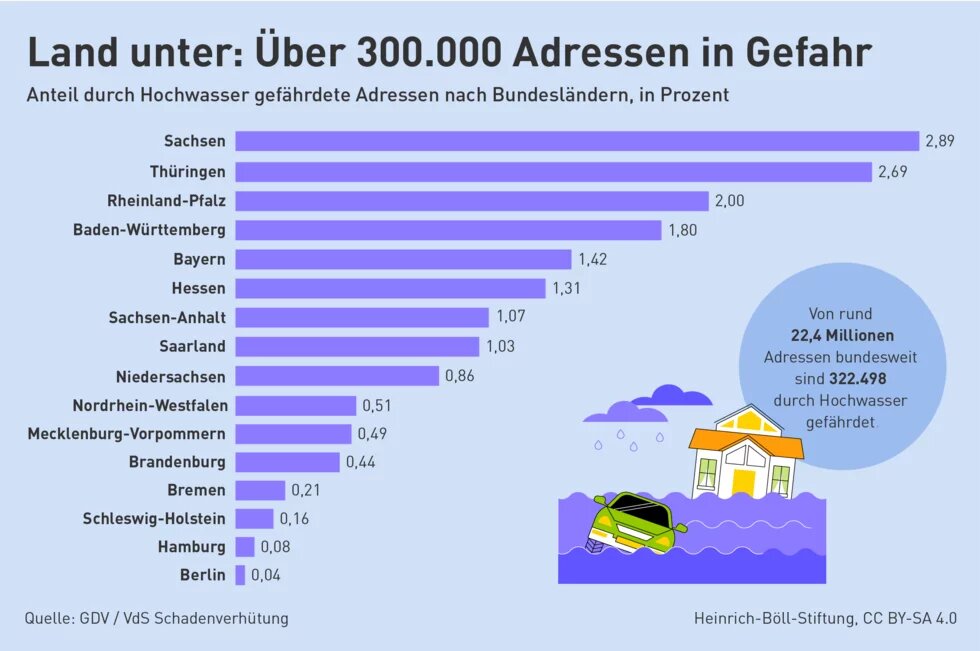
Starkregen und Hochwasser prägen Deutschland – „Jahrhunderthochwasser“ sind keine Seltenheit mehr. Der Klimawandel verschärft die Risiken, fehlende Pufferzonen und urbane Versiegelung erhöhen die Schäden. Warum blau-grüne Infrastruktur und neues Regenwassermanagement dringend nötig sind.

Das Jahr 2024 wird als ein Regenjahr in die jüngere Geschichte eingehen. Immer wieder gab es in Deutschland Starkniederschläge und folgend Hochwasser: zum Jahreswechsel in Bremen und Niedersachsen, zu Pfingsten im Saarland und in Rheinland-Pfalz, im Juni dann in Bayern und Baden-Württemberg und schließlich im September in Brandenburg (die auf tagelangen Regen folgende Flut traf allerdings Österreich, die Slowakei, Tschechien und Polen ungleich stärker). Statt von einer Vielzahl von sogenannten „Jahrhunderthochwassern“ ist inzwischen schon von einem „Hochwasserjahrhundert“ die Rede.
Durch den Klimawandel wird Starkregen häufiger und heftiger. Eine wärmere Atmosphäre nimmt mehr Wasser auf, das dann abregnet. Gefährlich ist dabei nicht der Niederschlag, sondern die enormen Wassermaßen können nicht mehr ordnungsgemäß abfließen, die Infrastruktur zur Entwässerung ist meist nach kurzer Zeit überlastet. Je nach Dauer und Intensität des Regens treten zunächst kleinere Bäche und Flüsse übers Ufer, später auch größere Gewässer. Talsperren, Rückhalte- und Auffangbecken laufen voll und teilweise über.
Beim Ausmaß der Überschwemmungen spielen menschliche Eingriffe eine große Rolle. Flussbegradigungen oder die Bebauung von Auen zerstören natürliche Pufferzonen für Wasser in der Landschaft und führen zu Überflutungen, da sich das Wasser weniger kontrolliert ausbreiten kann. Heftiger Regen kann auch Erdrutsche auslösen, selbst an kleinen Hängen. Große Erdrutsche treten eher in Gebirgslagen auf. Der Regen ist dabei meist nur der letzte Auslöser. Menschliche Einflüsse wie Abholzung von Hängen haben zuvor oftmals im Wortsinne den Boden bereitet.
Wassernotlagen wirken besonders verheerend in Regionen, die eigentlich zu den trockensten der Welt gehören. Dort können übernutzte und ausgetrocknete Böden die Wassermengen kurzfristig nicht aufnehmen. Auch sind Infrastrukturen und Entwässerungssysteme häufig unzureichend oder nicht vorhanden. Zudem liegen Siedlungen meist in der Nähe von Flüssen oder in Überschwemmungsgebieten. Tragisches Beispiel dafür waren die durch den Sturm Daniel im Herbst 2023 hervorgerufenen Starkregen und Überschwemmungen in Nordafrika und dem Nahen Osten. Ein Dammbruch in Libyen forderte dabei mehr als 4.000 Todesopfer, über 40.000 Menschen wurden Binnenflüchtlinge.
Schäden durch Starkregen oder Überschwemmungen führen zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust von Vermögenswerten. Die Folgen sind hohe Kosten für Bürger*innen und Unternehmen, die auf die Infrastrukturen angewiesen sind. Nach wasserbezogenen Katastrophen erholt sich die Wirtschaftsleistung in den zwanzig darauffolgenden Jahren nicht wirklich, zeigen Studien der World Bank.
Wichtigstes Gegenmittel gegen Überschwemmungen ist ein integrales Regenwassermanagement. Es berücksichtigt den Erhalt des lokalen Wasserhaushalts, den Gewässerschutz sowie den Schutz vor Überflutung. Es erfordert eine naturnahe Entwicklung der Gewässer, eine ortsnahe Regenwasserbewirtschaftung mit Versickerung und Verdunstung sowie den Einsatz von Regenwasser für die Gewässer- und Stadtentwicklung.
Besonders im urbanen Raum braucht es dazu mehr natürliche Wasser- und Grünflächen - sogenannte blau-grüne Infrastruktur. Diese verbindet Oberflächengewässer, Grundwasser, Regenwasserbewirtschaftung sowie öffentliche und private Grünflächen. Es geht darum, die Belange der Wasserwirtschaft, des Städtebaus, der Straßen- und Freiraumplanung sowie der Klimavorsorge zu verknüpfen.
Zum Schutz vor Starkregen können auch Eigentümer*innen von Häusern sowie auch Mieter*innen selbst beitragen. Kündigt sich starker Regen an, sind Fenster, Türen und Dachluken zu schließen. Beim Neubau sollten ebenerdige Eingänge zu Häusern vermieden werden. Bereits kleine Schwellen können Wasser vom Zufluss ins Gebäude und zu tieferliegenden Öffnungen abhalten. Kellertreppen und Lichtschächte lassen sich durch Aufkantungen schützen und sollten an eine Drainage oder ein Entwässerungssystem angeschlossen sein. Auf dem eigenen Grundstück kann der schnelle, oberflächige Abfluss von Regenwasser vermieden oder verzögert werden, indem Flächen wie der bekannte „Schottergarten“ entsiegelt und bepflanzt werden.
Angesichts der zunehmenden Häufigkeit von Starkregenereignissen erfordert der Schutz vor Überschwemmungen ein umfassendes Umdenken in der Stadtplanung und im Umgang mit Wasser.



