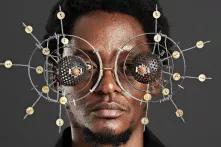Nigeria ist das bevölkerungsstärkste Land Afrikas, eine regionale Großmacht und einer der großen Ölexporteure der Welt. Zugleich ist das Land geprägt von Armut, schlechter Regierungsführung und Gewaltkonflikten. Ein halbes Jahrhundert nach seiner Unabhängigkeit am 1. Oktober 1960 bleibt Nigeria weit hinter seinem Potenzial zurück – warum?
Bislang ist von offiziellen Vorbereitungen für das Unabhängigkeitsjubiläum wenig erkennbar. Das Desinteresse überrascht wenig: In einem von Armut und maroder Infrastruktur geprägten Alltag, haben die meisten Menschen in Nigeria andere Sorgen. Nach monatelanger Unklarheit über den Gesundheitszustand des Präsidenten hat das Land erst seit Februar 2010 überhaupt wieder eine funktionsfähige Staatsführung unter Goodluck Jonathan. Derweil gibt der anstehende Jahrestag Anlass zu Reflektionen. Zeitungsbeiträge und Blogs schwanken zwischen grundsätzlichem Stolz auf die Nation und deutlicher Kritik an deren Realität. Die koloniale Vergangenheit wird dabei durchaus mitgedacht, doch macht kaum jemand im heutigen Nigeria sie verantwortlich für die aktuellen Probleme des Landes.
Aufgrund seiner Größe und seines Ressourcenreichtums hat Nigeria seit 1960 mehr Chancen als die meisten anderen Länder Afrikas gehabt, im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit eigene Wege zu gehen und die Unabhängigkeit zu nutzen. Nigeria hat diese Chancen durchaus zu nutzen versucht, doch bleibt das Resultat ernüchternd.
Die kulturelle Dimension
Manche „Tiefendimensionen“ des kolonialen Erbe in Nigeria wirken bis in die Gegenwart nach, doch würden die wenigsten Menschen sie als Zeichen kultureller Abhängigkeit werten.
An erster Stelle ist das Christentum zu nennen: Fast die Hälfte der Bevölkerung Nigerias, vor allem im Süden und in den zentralen Landesteilen, gehört heute einer christlichen Kirche an. In der Kolonialzeit war die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche eng verknüpft mit dem Zugang zur modernen Bildung, die einer neuen Elite den sozialen Aufstieg ermöglichte. Der islamisch geprägte Norden weist bis heute ein wesentlich niedrigeres Bildungsniveau auf, auch wenn eine relativ kleine muslimische Elite wichtige Positionen in Staat, Militär und Privatsektor kontrolliert.
Kritik an dem mit dem Christentum transportierten westlichen Wertesystem ist durchaus vorhanden. Doch kaum ein nigerianischer Intellektueller – geschweige denn der Mann oder die Frau auf der Straße – lehnt das Christentum als unafrikanische koloniale Innovation ab. Stattdessen gab und gibt es zahllose Versuche, das Christentum als afrikanische Religion zu definieren, unabhängige Kirchen zu gründen und die durchaus empfundene Diskrepanzen zwischen „westlich-christlichen“ und „afrikanischen Werten“ in den ursprünglich kolonial etablierten Kirchen (Anglikaner, Katholiken) durch „Inkulturation“ und eine afrikanisch geprägte Theologie zu bewältigen. Die höheren Ränge der etablierten Kirchen wurden meist schon vor Jahrzehnten nigerianisiert. In den letzten Jahrzehnten entstanden zahllose neue (meist evangelikale) Kirchen, die, bei aller Einbindung in internationale Netzwerke, einen dezidiert „nigerianischen Stempel“ tragen. Die „Winner’s Chapel“ – eine Gründung von Bischof David Oyedepo, die den „Gospel of Wealth and Healing“ schon in ihrem Namen repräsentiert – wurde zu einem erfolgreichen nigerianischen Exportprodukt.
Am Konflikt um die Position zur Homosexualität wird deutlich, wie selbstbewusst nigerianische Christen heute mit den kolonialen Wurzeln ihrer Religion umgehen. Während Anglikaner in Großbritannien und den USA Toleranz üben, lehnen ihre Kollegen in Afrika – und vor allem in Nigeria, das heute die größte einzelne anglikanische Gemeinschaft weltweit stellt – Homosexualität im Priesteramt sowie die Anerkennung homosexueller Partnerschaften strikt ab. Der Konflikt droht die anglikanische Weltkirche zu spalten.
Auch im Umgang mit anderen kulturellen Dimensionen der kolonialen Vergangenheit, zeigt Nigeria seit langem ausgesprochenes Selbstbewusstsein. Der 1997 verstorbene Sänger Fela Anikulapo-Kuti verspottete schon 1973 in seinem Song über den „Gentleman“, der sich im tropisch-schwülen Lagos formell mit Anzug, Krawatte und Hut kleidet, die Restbestände kolonialer Mentalität:
Him be gentleman, him go sweat all over,
him go faint right down, him go smell like shit.
Me I no be gentleman like that, I be Africa man original.
Die „Agbada“, ein lang fließendes Gewand, hat längst den Status einer Nationaltracht erlangt, die von Nigerianern auch im Ausland mit Stolz getragen wird. Die nigerianische Musik- und Tanzkultur ist international anerkannt.
Das „Zweite Welt-Festival der schwarzen und afrikanischen Kunst und Kultur“ (FESTAC), 1977, auf der Höhe des Ölbooms in Lagos veranstaltet, war ein nicht wieder erreichter Höhepunkt staatlich gesponserter kultureller Selbstdarstellung. Heute sind private Akteure aktiver, vor allem in der Unterhaltungskultur. „Nollywood“, die nigerianische Kino- bzw. Video-Industrie, versorgt den großen nationalen Markt und erreicht über Satellitenfernsehen auch andere afrikanische Staaten und die afrikanische Diaspora. Gemessen an der Zahl der produzierten Filme ist Nollywood (nach Bollywood) heute der zweitgrößte Filmproduzent der Welt. Seine Narrativität und Ästhetik sind stilbildend geworden – nicht immer zur Freude des subventionierten afrikanischen „Kunstkinos“.
Der „Fluch der Ressourcen“
Neben Ghana gehörte Nigeria zu den afrikanischen Ländern, die um 1960 ein höheres Pro-Kopf-Einkommen hatten als süd- und südostasiatische Staaten mit vergleichbarer Wirtschaftsstruktur, wie zum Beispiel Malaysia. Warum, fragen viele, ist Nigeria seit 1960 so weit hinter Asien zurückgefallen?
Der britische Kolonialismus hatte in Nigeria eine auf landwirtschaftliche Rohstoffe (Kakao, Palmöl, Erdnüsse, Kautschuk) ausgerichtete Exportwirtschaft etabliert. Allerdings fand keine groß angelegte europäische „Landnahme“ statt; die agroindustrielle Plantagenwirtschaft blieb Ausnahme. Die zahlenmäßig kleine britische Verwaltung, die Millionen von Afrikanern mit Mitteln „indirekter Herrschaft“ zu kontrollieren suchte, hatte sich solchen Plänen nach dem ersten Weltkrieg widersetzt: Sie fürchtete sozial und politisch destabilisierende Folgen.
So blieb die kleinbäuerliche Exportwirtschaft das Rückgrat der nigerianischen Ökonomie. In guten Zeiten wie den 1950er Jahren gelangten etwa Kakaobauern damit durchaus zu Wohlstand. Wirtschaftshistoriker haben argumentiert, dass es eben dieses Überleben kleinbäuerlicher Strukturen war, das die Entwicklung eines dynamischen Kapitalismus in Nigeria verhinderte.
Spätkoloniale Entwicklungspolitik in den 1950er Jahren schuf Grundlagen für einen industriellen Sektor. Doch bestand die typisch neokoloniale Struktur nach der Unabhängigkeit 1960 zunächst fort. Allerdings verlor die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien ihre führende Rolle, während andere europäische Länder, vor allem aber die USA, zu wichtigen Handelspartnern Nigerias aufstiegen. Auch Nigerias Außenpolitik blieb zunächst stark westlich orientiert, symbolisiert durch ein Verteidigungsabkommen mit Großbritannien. Nigeria ab 1960 hatte zunächst nichts von der Radikalität der Unabhängigkeits¬periode, wie sie etwa Ghana unter Kwame Nkrumah kennzeichnete.
Der große Umbruch erfolgte mit dem Öl-Boom der 1970er Jahre. Er eröffnete völlig neue Chancen, aus den kolonial geprägten politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten auszubrechen. Verschiedene Regierungen – ab 1966 fast nur mehr Militärs – versuchten diese Möglichkeiten im Rahmen der politischen und ökonomischen Paradigmen ihrer Zeit zu nutzen. Bis heute wird oft eine Aussage zitiert, die Staatschef Yakubu Gowon auf der Höhe des Ölbooms gegenüber einem ausländischen Journalisten gemacht haben soll: Geld sei nicht mehr das Problem Nigerias – sondern wie man es ausgeben solle.
Dieser Satz, bis heute gern als Symbol der Hybris dieser Jahre kritisiert, war durchaus zutreffend, wenn auch anders als von Gowon gemeint: Nigerias Problem war in der Tat das „Wie“ in der Verwendung der Öleinnahmen. Der Fall Nigeria belegt, dass Entwicklung nicht primär eine Frage der Finanzierung ist (Nigeria hat über die Jahrzehnte mehrere hundert Milliarden US-Dollar Öleinnahmen erzielt), sondern wesentlich eine Frage guter Regierungsführung. Heute erscheinen die 1970er Jahre, in denen die Grundlagen für das postkoloniale Nigeria gelegt wurden, als eine große verpasste Chance.
Innerhalb weniger Jahre wurde aus einem Agrar- ein Ölexportland. Die Militärregierungen investierten die Öleinnahmen in den Ausbau von Infrastruktur (Straßen, Bildung) und Industrien (Fahrzeuge, Stahl, Chemie). Sie verfolgten eine Strategie der „gemischten Ökonomie“: Die „Indigenisierungspolitik“ reservierte gezielt einzelne Wirtschaftssektoren für den nigerianischen Privatsektor, während Auslandsunternehmen in anderen Sektoren eine substanzielle nigerianische Beteiligung aufweisen mussten. Staatliche Großprojekte und Auslandsinvestitionen wurden durch Außenwirtschaftskontrollen geschützt. Bei alledem blieben die „Kommandohöhen der Wirtschaft“ staatlicher Kontrolle vorbehalten.
Politisch sah sich Nigeria bereits als regionale Führungsmacht (vor allem gegenüber Apartheid-Südafrika), mit Anspruch auf einem permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat und womöglich mit einer Perspektive atomarer Bewaffnung.
Die Armut ist geblieben
Fehlentwicklungen waren unübersehbar. Durch Fehlplanungen und Ineffizienz, vor allem aber durch die sprichwörtlich gewordene Korruption, wurden große Teile des Öleinkommens verschleudert. Während die Agrarproduktion verfiel, finanzierten die Öleinnahmen den rasant wachsenden Import von Nahrungsmitteln, Luxusgütern und Ausrüstungsgütern. Nigeria wurde zu einer Nation von Zwischenhändlern und „Contractors“, die Staatsaufträge oft eher schlecht als recht abwickelten, sich vor allem aber ihr „Stück vom nationalen Kuchen“ abzuschneiden versuchten. Statt „nationale Entwicklung“ voranzutreiben, entstand eine parasitäre Elite aus Beamten und Privatunternehmern, die sich auf Kosten des Staats bereicherte – allen voran die wechselnden politischen Führer, darunter viele Ex-Militärs. Der heute geläufige Begriff „Fluch der Ressourcen“ war noch nicht erfunden, aber Nigeria stellt ein Paradebeispiel dieses Phänomens dar.
1982 war die Party vorbei: Die Ölpreise sanken, Nigeria war überschuldet, und Korruption war endemisch geworden. Die Strukturanpassungspolitik der Folgejahre folgte den Rezepten der internationalen Finanzinstitutionen, auch wenn nigerianische Staatschefs sie bisweilen als „hausgemacht“ rechtfertigten. Sie nutzten wenig und werden bis heute oft als die eigentlichen Verursacher der Krise kritisiert, die sie eigentlich hatten bewältigen sollen.
Erst seit Ende der 1990er Jahre, mit dem Ende der Militärdiktatur, marktorientierten Reformen, der Expansion des Dienstleistungssektors (z.B. Bankenreform) und dem Rohstoffpreisboom des neuen Jahrtausends verbesserte sich Nigerias gesamtwirtschaftliche Lage. Aber eine durchgreifende Wende ist ausgeblieben: Nigeria ist weiterhin abhängig vom Ölexport; Antikorruptionskampagnen haben allenfalls begrenzte Wirkungen erzielt; Massenarmut, ein katastrophaler Zustand der Infrastruktur und politische Gewalt bestehen fort. Das Erdöl hat Nigerias koloniale Wirtschaftsstruktur transformiert, aber Nigerias Unterentwicklung ist geblieben.
Eine koloniale Fehlkonstruktion?
Nigeria erreichte seine Unabhängigkeit von Großbritannien ohne einen längeren Unabhängigkeitskampf, der zur Bildung einer nationalen Identität hätte beitragen können. Ethnische, regionale und religiöse Identitäten dominierten die Politik, und sie tun dies bis heute. 1947 bezeichnete Obafemi Awolowo, einer der wichtigsten Politiker der Unabhängigkeitsbewegung, Nigeria als „rein geographischen Ausdruck“. Das Land hat seit der Unabhängigkeit zahlreiche existenzielle Krisen überstanden, doch bleibt die nationale Frage akut – heute vielleicht stärker als noch vor 25 Jahren.
Dass Nigeria eine Fehlkonstruktion sei, ist die heute am weitesten verbreitete Kritik des kolonialen Erbes. Nur: was folgt aus einer solchen Feststellung? Die wenigsten leiten daraus die Forderung nach Auflösung Nigerias als einem einheitlichen Staat ab. Doch die Konstruktion Nigerias als funktionsfähigem Staat ist eine permanente Herausforderung postkolonialer Politik geblieben.
Nigerias heutige Grenzen sind das langwierigste und schwierigste Vermächtnis des Kolonialismus. Sie standen erst 1914 fest, nachdem mehrere unterschiedlich strukturierte Territorien zusammengelegt worden waren. Das Ergebnis war ein Land mit großer Diversität, geprägt vom Gegensatz zwischen einem konservativen, islamisch geprägten Norden und dem wirtschaftlich entwickelteren, zunehmend christianisierten Süden. Dieser Gegensatz prägt Nigerias Politik bis heute, und er wird durch die in der letzten Dekade häufiger gewordenen, religiös begründeten Gewaltkonflikte immer wieder schmerzhaft ins Bewusstsein gerufen.
Durch Einleitung von Verfassungsreformen stellte die britische Verwaltung bereits 1948 die Weichen in Richtung Unabhängigkeit. Großbritannien war durch den Weltkrieg geschwächt und fürchtete die Entstehung einer Unabhängigkeitsbewegung nach indischem oder ghanaischem Vorbild. Die Entkolonisierung Nigerias verlief weitgehend friedlich und konsensorientiert. Ohne den Widerstand der Eliten aus dem Norden, die befürchteten, ihre Region würde dauerhaft vom Süden dominiert werden, wäre Nigeria bereits 1956 – also noch vor Ghana – unabhängig geworden.
Zur Unabhängigkeit 1960 blieben die drei in der Kolonialzeit entstandenen Regionen (mit jeweils einer dominanten ethnischen Bevölkerungsgruppe, aber zahlreichen Minoritäten) erhalten. Sie verfügten über innere Autonomie, und ihre politischen Führer mussten Bündnisse auf nationaler Ebene eingehen, um die Macht in Lagos zu erlangen. Doch bereits 1966 zeigte sich die Fragilität des neuen Staats. Nach einem Militärputsch und Pogromen in Nord-Nigeria erklärte die Südost-Region ihre Sezession als „Biafra“. Der darauf folgende Bürgerkrieg kostete mindestens eine Million Menschen das Leben und endete mit der Kapitulation Biafras im Januar 1970. Die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien, aber auch die Sowjetunion, die neue Verbündete in Westafrika suchte, hatten die Zentralregierung militärisch unterstützt.
Eine fragile Perspektive
Aus der Krise ging eine neue föderale Struktur hervor, mit zunächst 12 und heute 36 Bundesstaaten. Diese Abkehr von der kolonialen Verwaltungsstruktur ist zum Angelpunkt eines dezidiert nigerianischen Modells des Managements ethnisch-regionale Diversität geworden. Die neue föderale Ordnung hat die Bedeutung ethnisch-regionaler politischer Loyalitäten in der nigerianischen Politik zwar nicht verringert (sondern geradezu institutionalisiert), doch verleiht sie ihnen einen neuen Aktionsrahmen: Große ethnische Blöcke wurden aufgespalten; die neuen Bundesstaaten erlaubten ethnischen Minoritäten mehr Selbstbestimmung.
Die Funktionsweise des nigerianischen Föderalismus bleibt ohne Berücksichtigung des Faktors Ölexport allerdings unverständlich. Die Einnahmen gehen zunächst an die Bundesregierung, die sie wiederum teilweise an die von diesen Transfers fast vollständig abhängigen Bundesstaaten weiterleitet. Der nigerianische Staat ist ein Umverteilungsmechanismus für Ölgelder geworden. Seit der Rückkehr zur Demokratie 1999 wird die Zentralregierung in Abuja von der „People’s Democratic Party“ (PDP) gestellt, einem Sammelbecken regionaler politischer Größen, deren gemeinsames Interesse im Zugriff auf die Öleinnahmen besteht. Mit sogenannten „zoning“-Mechanismen versucht die PDP die Teilung der Macht und der Öleinnahmen zwischen den Regionen des Landes sicher zu stellen.
Allerdings ist die Ölproduktion auf einige wenige Bundesstaaten im Süden des Landes konzentriert, die als Minoritätengebiete jahrzehntelang politisch marginalisiert waren. Ergebnis waren Aufstände in weiten Teilen der Förderregion seit Ende der 1990er Jahre, die zwischenzeitlich substanzielle Teile der Ölproduktion lahmlegten. Einzelne Gruppen in den Ölregionen fordern eine Sezession, und auch im Igbo-sprachigen Südosten, 1967-70 das Kerngebiet Biafras, sind Forderungen nach Abspaltung wieder lauter geworden. Zwar erhalten die Ölförderregionen heute höhere Anteile an den Einnahmen, und die 2009 ergangene Amnestie hat die Gewalt in der Region verringert. Doch bleibt eine dauerhafte Befriedung fraglich, da die militanten Gruppen in der Grauzone zwischen politischer Aktion und Kriminalität operieren und dem Staat und seinen Institutionen wenig Vertrauen entgegenbringen.
Zerrissen von inneren Disparitäten und Konflikten, bleibt Nigeria in seinen kolonialen Grenzen gefangen. Eine Auflösung des Landes wäre mit dramatischen Folgen – Gewalt, Chaos, wirtschaftlichem Zusammenbruch weiter Landesteile – verbunden; sie wird allenfalls von radikalen Minderheiten befürwortet. Seit dem Bürgerkrieg hat Nigeria durch politische Reformen und das Management seiner ethnisch-regionalen Diversität versucht, dieses koloniale Erbe zu bearbeiten. Es war darin insofern erfolgreich, als das Land nicht zerfallen ist. Das ist mehr, als manche Skeptiker erwartet haben. Und es bedeutet nicht zuletzt eine Perspektive für Millionen von Nigerianerinnen und Nigerianern, die in anderen Landesteilen als ihren Heimatregionen leben, und für die Nigeria – bei all seinen Problemen – ein großes Land voller Möglichkeiten bleibt.
Axel Harneit-Sievers ist Historiker und Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Afrika. In den Jahren 2002-06 leitete er das Nigeria-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Lagos, seit 2007 das Regionalbüro Ostafrika / Horn von Afrika der Heinrich-Böll-Stiftung in Nairobi (Kenia).