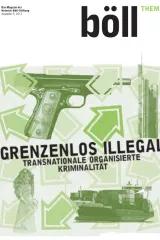Weit weg von Deutschland erscheint vielen das brisante Phänomen 'Organisierte Kriminalität' (OK), das sich aber auch in der Bundesrepublik längst festgesetzt hat. Auch wenn Deutschland als stabile und wehrhafte Demokratie betrachtet wird, führen bürokratische Hürden immer wieder zu Schwierigkeiten bei der Bekämpfung der OK. ➤ Aktuelle Artikel, Publikationen und andere Veröffentlichungen zu Außen- und Sicherheitspolitik.
Und trotz des Blutbades im Sommer 2007 spielen manche Landeskriminalämter die Brisanz des Problems organisierter Kriminalität immer noch herunter. Ein Beispiel: 2010 wurde im Rahmen eines milliardenschweren Geldwäsche-Falls publik, dass die Ndrangheta in Deutschland Wahlzettel von ihrer Klientel gesammelt und gefälscht hatte, um den von ihr abhängigen Politiker Nicola Di Girolamo aus der Berlusconi-Partei in den römischen Senat zu hieven. Stellungnahmen von Polizeibehörden, besorgte Kommentare aus der deutschen Politik? Fehlanzeige. Diese Strategie des Schweigens und Verschweigens fällt inzwischen auch im Ausland auf. «Omerta auf Deutsch», titelte 2010 das französische Magazin L’Express bissig einen Bericht über die Mafia in Deutschland. Die Journalisten hatten bei ihrer Recherche den Eindruck gewonnen, dass es in Allemagne ein Schweigegelübde gebe – bei den zuständigen Ermittlungsbehörden.
Mexiko ist nah, Afghanistan ist nah, Russland ist nah. Und all die anderen Staaten, die aus deutscher Sicht so gern als «klassische» Länder der organisierten Kriminalität gesehen werden. Expertisen des Bundeskriminalamts (B KA) oder des Bundesnachrichtendienstes (BND) aus den vergangenen Jahren zeigen eindeutig: In Deutschland, bei uns, gibt es längst dieselben Deliktbereiche der organisierten Kriminalität wie in den «klassischen» OK-Ländern – Waffen- und Drogenhandel, Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zigarettenschmuggel, Schutzgelderpressung, Geldwäsche, Terrorfinanzierung. Aus den Berichten der Behörden geht auch unmissverständlich hervor, dass sich OK-Gruppen vernetzt haben, dass die organisierte Kriminalität transnational agiert, grenzenlos. So stellte der BND schon 2006 in einer vertraulichen Studie zur Ndrangheta fest: «Längst sind länderübergreifende Kooperationen mit anderen Strukturen der organisierten Kriminalität nicht mehr Ausnahme, sondern Regel.»
Und die deutschen Experten wissen längst, dass die internationalen Netzwerke der organisierten Kriminalität, ob aus Italien, Russland, China oder Südamerika, keine archaisch strukturierten Banden mehr sind – sondern riesige Wirtschaftsunternehmen, globale Konzerne. Deren kriminelle Protagonisten agieren in Anzug und Krawatte, als Manager der organisierten Kriminalität bringen sie die schmutzigen Milliarden weltweit in Umlauf, um sie zu waschen. In Geldtransfers oder Geschäften mit der legalen Wirtschaft, die durch die Globalisierung der Finanz- und Wirtschaftswelt immer und überall laufen können. Allein der Gesamtumsatz aller italienischen Mafia-Organisationen, so der BND im Jahr 2006, beziffere sich auf 100 Milliarden Euro jährlich. Die Geldwäsche werde verstärkt in Europa sowie weltweit betrieben.
Beinahe folkloristisches Flair
Und sie läuft auch und besonders in Deutschland, vor der eigenen Haustür. Wie nah die organisierte Kriminalität ist, wie tief sie mitunter schon den Alltag bei uns durchdrungen hat, zeigt in skurriler Weise der Dialog zwischen einem Mafioso in Stuttgart und seinem Clan-Chef, den italienische Ermittler vor einiger Zeit belauscht haben: Ob er das Haus in einer bestimmten Straße kaufen solle, fragte der Mafioso. Der Boss antwortete wütend: «Mensch, uns gehört doch schon die ganze Häuserzeile.» Es gibt immer noch viele Bürger – und auch Medien –, die derartige Vorgänge wie Filmszenen betrachten, als Fiktion, mit einem Hauch des «Paten», fast mit einem folkloristischen Flair.
Der freie Markt, das hat spätestens die globale Finanz- und Wirtschaftskrise drastisch gezeigt, kontrolliert sich selbst kaum oder gar nicht. Davon profitiert die transnationale organisierte Kriminalität sehr stark, das hat ihre weitgreifende Expansion ermöglicht und beschleunigt. In allen Staaten, auch in Deutschland. Die Beiträge in diesem Heft haben eines jedoch deutlich aufgezeigt: Sie kann sich in jenen Ländern besonders erfolgreich festsetzen, die politisch instabil sind, die ihre Kontrollmacht und -aufgabe zu lasch ausüben, deren Gesetze zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität defizitär sind oder nicht konsequent genug angewandt werden – und in denen die Strafverfolgungsbehörden sich dem Problem nicht bewusst und engagiert genug stellen.
Deutschland, so betonen Politiker/innen gerne, sei eine stabile und wehrhafte Demokratie. Also ist dieser Staat, so der Schluss, auch wehrhaft und wachsam, was die globale organisierte Kriminalität angeht. Doch das ist, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit. Fakt ist: Seit Deutschland sich dem von den USA 2001 erklärten «Krieg gegen den Terror» angeschlossen hat, leidet die OK-Bekämpfung allein schon an personell-finanziellen Defiziten. Die Verfolgung radikaler, gewaltbereiter Islamisten steht im Vordergrund. Auch in rechtlicher Hinsicht. Häufig greift der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, häufig wird dieser Straftatbestand angewandt. Ein durchaus wirksames Mittel, wie jüngere Islamisten-Verfahren zeigen. Mafia-Ermittler beklagen indes, oft hinter vorgehaltener Hand, dass der Straftatbestand der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung als Hebel zur OK-Bekämpfung zu selten genutzt werde. Obwohl hinter bestimmten Delikten die Mafia stehe und nicht etwa nur einzelne, für sich agierende Drogenhändler.
Deutschland – ein Paradies für Geldwäscher
Besonders gravierend ist jedoch ein Defizit, das beträchtliche Zweifel an einer konsequenten Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Deutschland aufkommen lässt: Das Geldwäschegesetz stellt Ermittler gegen Netzwerke organisierter Kriminalität per se schon vor schwere Hürden. Sie müssen erst die kriminelle Vortat nachweisen, die zur Geldwäsche führt. Gerade bei inzwischen transnational agierenden OK-Organisationen ein äußerst schwieriges Unterfangen. Hinzu kommt aber: Deutschland hat die bereits seit vielen Jahren bestehende Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union bis heute faktisch nicht umgesetzt. Betreiber von Spielbanken, ein Dorado für mafiöse Geldwäscher, sind zwar schon länger verpflichtet, genau hinzusehen und Anzeigen wegen des Verdachtes der Geldwäsche zu erstatten, wenn Spieler am Roulettetisch mit großen Summen agieren. Die Realität sieht aber ganz anders aus, wie regelmäßig die Berichte der Financial Intelligence Unit (FIU) des Bundeskriminalamts dokumentieren: Anzeigen von Kasinos gingen nur in verschwindend kleiner Zahl an Ermittlungsbehörden. Dabei zeigen entsprechende Listen in Spielbanken wie Baden-Baden aus früheren Jahren, dass Mafiosi mit hohen Summen aufgefallen waren. Ergo: Bundesländer, die von staatlichen Kasinos eine opulente Abgabe erhalten, haben jahrelang auch von schmutzigen Geldern profitiert.
Derweil sind Immobilienmakler und Versicherungsagenten von einzelnen Bundesländern erst jetzt zur intensiveren Kontrolle verpflichtet worden. In Baden-Württemberg etwa fällte die Landesregierung pikanterweise erst Ende 2009 den entsprechenden Beschluss, als der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger unmittelbar vor seinem Wechsel als EU-Kommissar nach Brüssel stand. Kein Wunder also, dass die OECD die Bundesrepublik im Jahr 2010 für ihre zu lasche Bekämpfung von Geldwäsche gerügt hat.
Die transnationale organisierte Kriminalität wird nicht erst dann gefährlich, wenn Mafiamorde geschehen. Sie agiert primär hinter den Kulissen dieser Gesellschaft, sucht den Einfluss auf zentrale Bereiche des Staates, auch die Politik – was die Mafia in ihren Stammländern strategisch mache, spiegele sie im Ausland, sagen Experten wie der italienische Duisburg-Chefermittler Nicola Gratteri. Die transnationale organisierte Kriminalität nutzt die wirtschaftliche Struktur in Deutschland genauso wie die Defizite in ihrer Bekämpfung. Fakt ist, dass dieses Land ein Operationsraum verschiedenster Organisationen ist. Und ein Paradies für mafiöse Geldwäscher, solange nicht konsequent dagegengehalten wird. All diese Strukturen bedrohen eine Demokratie.
Entscheidend ist daher, dass verantwortliche Politiker/innen, Polizeibehörden und auch Teile der Medien die eigene «Omerta» durchbrechen. Damit auch in der Bevölkerung das Bewusstsein für dieses brisante Problem wächst und damit die wehrhafte Demokratie nicht zur wehrlosen Demokratie mutiert.
Rainer Nübel ist seit 2000 Mitglied der Reportageagentur Zeitenspiegel und Mitarbeiter des Magazins stern. Er ist Co-Autor mehrerer Sachbücher, darunter "Wir können alles" und wurde dafür 2008 ausgezeichnet als «Journalist des Jahres» in der Kategorie "Regionale Autoren". Weiterhin ist er Lehrbeauftragter an zwei Hochschulen in Baden-Württemberg.