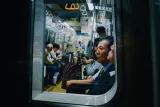Zehn Jahre nach Petersburg trifft sich die internationale Außenministerkonferenz zu Afghanistan am 5. Dezember 2011 in Bonn. Es geht um die politische Zukunft Afghanistans. Vor allem muss es in Bonn handfeste Garantien an die afghanische Regierung und die Zivilgesellschaft geben, dass die zivile Hilfe auch nach einem Abzug der internationalen Truppen weitergehen wird.
Zu Beginn des Einsatzes gingen Militärs und Politiker davon aus, dass der Kampf gegen Al Qaida maximal zwei bis drei Jahre internationaler militärischer Präsenz in Afghanistan erfordern würde. Das erwies sich als Irrtum.
Auch als absehbar war, dass sich der Einsatz länger hinziehen würde, wurde keine umfassende zivile und politische Strategie entwickelt. Es blieb bei einer Dominanz des Militärischen. Die offensive Aufstandsbekämpfung im Rahmen der „Operation Enduring Freedom“ (OEF) konnte die Taliban aber nicht entscheidend schwächen. Stattdessen forderte sie eine hohe Zahl an zivilen Opfern und zerstörte viel Vertrauen in die internationalen Truppen vor Ort.
Unter der Dominanz des Militärischen litten zudem das zivile und politische Engagement. Der zivile Wiederaufbau Afghanistans wurde lange Zeit stiefmütterlich behandelt – es fehlte an Mitteln, Personal, Kohärenz. Viele Projekte sollten schnelle Wirkung zeigen – und hinterließen oft keine nachhaltigen Erfolge. Obwohl es in den vergangenen Jahren auch Fortschritte gegeben hat - wirtschaftlich steht Afghanistan heute deutlich besser da als vor zehn Jahren, in vielen Regionen hat es einen Modernisierungsschub gegeben, im Bildungsbereich und bei der Gesundheitsversorgung gibt es deutliche Fortschritte, ebenso bei der Elektrifizierung und der Wasserversorgung. Doch von einer funktionierenden Staatlichkeit ist Afghanistan in den meisten Gebieten bis heute weit entfernt.
Als folgenschwerstes Versäumnis entpuppte sich aber das Fehlen einer politischen Strategie. Es gab lange Zeit kein Konzept zur Integration der bisherigen Unterstützer des Taliban-Regimes im Rahmen des zivilen Aufbauprozesses. Außerdem wurde die Rolle Pakistans für die Lösung des afghanischen Konflikts völlig unterschätzt.
Erst Präsident Obama hat Ende 2009 die notwendige Konsequenz gezogen und erklärt, dass der Konflikt nicht militärisch zu gewinnen sei und dass eine politische Lösung gefunden werden müsse. Er leitete damit einen Strategiewechsel in der westlichen Afghanistanpolitik ein, der auf der Londoner Konferenz 2010 von der Internationalen Gemeinschaft festgeschrieben wurde. Mit dem neuen Ansatz wurde eine politische Lösung, d.h. im Kern die Einbindung aufständischer Gruppen in die zukünftige politische Architektur Afghanistans, und der zivile Wiederaufbau ins Zentrum gestellt. Zudem wurde mit dem Beschluss, die Übergabe der Sicherheitsverantwortung und den Abzug der internationalen Kampftruppen bis 2014 zu vollziehen, ein klarer zeitlicher Rahmen gesteckt.
Der mit der Londoner Konferenz Anfang 2010 eingeschlagene Weg, eine politische Lösung zu erzielen, muss trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge fortgesetzt werden. Es wird nicht einfach werden, den afghanischen Friedensprozess zum Erfolg zu führen. Aber es gibt zu einer solchen politischen Lösung keine Alternative.
Was kann, was muss nun die Bonner Konferenz für die Zukunft Afghanistans bringen? Die Erwartungen an die Petersberg-Konferenz in Bonn sind groß, besonders bei den Menschen in Afghanistan. Es sollten aber auch keine falschen Hoffnungen geweckt werden.
Die Bonner Konferenz muss deutlich machen, dass dieser politische Prozess inklusiv angelegt ist. Das gilt gerade gegenüber der afghanischen Zivilgesellschaft. Nur durch eine starke Zivilgesellschaft kann es einen soliden Frieden geben. Besonders die Rechte von Frauen dürfen in Bonn nicht unter den Tisch fallen. Der Zugang zum Bildungssystem und zu öffentlichen Ämtern darf ihnen zukünftig nicht verwehrt bleiben. Es war der Fehler der ersten Bonner Petersberg-Konferenz 2001, dass nicht alle politischen Parteien und sozialen Gruppen in die Konfliktlösung mit einbezogen wurden. Dieser Fehler sollte nicht wiederholt werden. Eine Friedenslösung kann zudem nur dann erfolgreich sein, wenn transparente und inklusive Mechanismen der Konfliktbearbeitung gefunden werden, die auch die Nachbarstaaten in der Region, insbesondere Pakistan, einbezieht. Darüber hinaus müssen die Reintegrationsangebote für ehemalige Aufständische ausgebaut und gründlich weiterentwickelt werden.
Vor allem aber muss es in Bonn handfeste Garantien an die afghanische Regierung und die Zivilgesellschaft geben, dass die zivile Hilfe auch nach einem Abzug der internationalen Truppen weitergehen wird. Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt und braucht auch über das Jahr 2014 hinaus verlässliche internationale Unterstützung. In Afghanistan darf nicht das passieren, was oft in Konfliktregionen nach dem Abzug der Militärs zu beobachten ist: Sind die internationalen Truppen weg, so verschwindet häufig auch die Entwicklungsunterstützung durch die internationale Gemeinschaft. Ein solches Szenario würde die langfristige Stabilisierung des Landes und der gesamten Region aufs Spiel setzen. Wichtig sind deshalb klare Zusagen durch die internationalen Geber auch über das Jahr 2014 hinaus. Selbstverständlich muss dabei auch die Effizienz des Einsatzes der Mittel auf den Prüfstand.
Die Bonner Konferenz muss in diesen zentralen Bereichen Fortschritte bringen. Dabei ist klar: Der Weg zu einem Frieden in Afghanistan bleibt lang und schwierig. Von heute auf morgen wird es keinen belastbaren Frieden geben. Doch der Abzug der internationalen Kampftruppen bleibt wichtig und ist eine notwendige Voraussetzung für eine politische Lösung des Konfliktes.
Frithjof Schmidt ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.