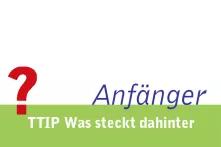Es geht neben Standards und Zöllen auch um Arbeits- und Menschenrechte. Beispielsweise haben die USA bestimmte Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO – englisch International Labour Organization – nicht unterzeichnet.
Dazu gehören das Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung oder das Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit. Auch das Abkommen zur Koalitionsfreiheit, also das Recht der Beschäftigten, sich frei zu organisieren, etwa in Gewerkschaften haben die USA nicht ratifiziert; gemäß dem nationalen Recht der USA haben Arbeiter/innen und Angestellte jedoch trotzdem das Recht, sich gewerkschaftlich zu betätigen.
Ähnliches gilt in anderen Bereichen: Auch wenn die USA etwa das Übereinkommen über das „Verbot von Diskriminierung in der Arbeitswelt" nicht ratifiziert haben, gibt es trotzdem innerhalb der USA Vorschriften [http://www.eeoc.gov/laws/statutes/titlevii.cfm], die z. B. die Diskriminierung nach Merkmalen, wie z.B. Hautfarbe, Geschlecht, Religion, nationaler und sozialer Herkunft oder politische Meinung verbieten.
Europäische Gewerkschafter/innen befürchten, dass der insgesamt relativ schwache Arbeitnehmer/innen-Schutz in den USA Auswirkungen auf die eigenen Standards haben könnte, so dass es zu einer Aushöhlung gewerkschaftlicher Einflussmöglichkeiten in der EU kommen könnte. Die ILO-Abkommen sind nicht die einzigen internationalen Verträge, die zwar von europäischen Staaten oder der EU selber, aber nicht von den USA ratifiziert wurden. So beispielsweise auch die UNESCO-Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt, in der eine diverse Kulturlandschaft als Allgemeininteresse der internationalen (Staaten-)Gemeinschaft (PDF) sowie als Gemeinwohlinteresse der einzelnen Staaten völkerrechtlich anerkannt wird, welches die Staaten je für sich oder in Zusammenarbeit mit anderen Staaten als legitimes (Regelungs-)Ziel verfolgen dürfen. Die USA war dem Abkommen entschieden entgegengetreten, aus Bedenken es könne sich als Handelshemmnis erweisen (PDF, S. 57).
Auch Datenschutz ist ein kontroverses Thema in den transatlantischen Beziehungen: Die EU sieht durch den NSA-Skandal eine Verletzung der Rechte ihrer Bürger/innen. "Eine Mehrheit im Parlament für die Ratifizierung von TTIP kann nicht garantiert werden, sollte für den Datenschutz und den rechtlichen Schutz europäischer Bürger keine Lösung gefunden werden", erklärte der EU-Parlamentarier Elmar Brok (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament. Mit den USA müsse ein Dialog geführt werden, wie man eine Balance zwischen Freiheit und Sicherheit beim Datenschutz finden könne. Eine Lösung könne sein, EU-Bürger/innen mit unter den für US-Bürger/innen geltenden Rechtsschutz zu stellen und damit US- und EU-Bürger/innen gleichzustellen, so Brok. Bisher gelten in den USA beim Datenschutz für Ausländer/innen niedrige Schutzstandards als für US-Bürger/innen.
Lesen Sie hierzu auch den Artikel "Datenschutz ist nicht verhandelbar" aus unserem TTIP-Dossier von Jan Philipp Albrecht.
Aktualisierte Version vom 25. Februar 2016.