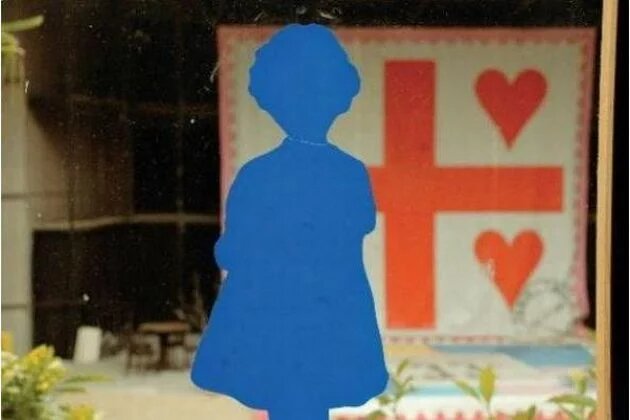
Georgien erlebt eine politische Krise: Im Streit verließen die Freien Demokraten die Koalition. Sie setzten sich am vehementesten und professionellsten für eine Annäherung an EU und NATO ein. Steht die Westorientierung Georgiens in Frage?
Seit zwei Jahren ist die Koalition "Georgischer Traum" im Amt. Nun entluden sich die Spannungen innerhalb des heterogenen Sechs-Parteien-Bündnisses in einem Bruch mit der pro-westlichen Partei der „Freien Demokraten“. Vorausgegangen waren Korruptionsermittlungen im Verteidigungsministerium und die Festnahme von Mitarbeitern. Verteidigungsminister Irakli Alasania, zugleich Chef der Freien Demokraten, bezeichnete dies als politisch motiviert und als Angriff auf die euro-atlantische Ausrichtung Georgiens. Er zielte damit auf Premierminister Irakli Garibaschwili, der Alasania sogleich entließ. Alasanias Verbündete, Außenministerin Maja Panjikidze und Alexander Petriaschwili, Staatsminister für euroatlantische Beziehungen, traten daraufhin zurück. In der Koalition bleiben jedoch Justizministerin Tea Zulukiani und die liberal ausgerichteten Republikaner, die einen Minister und den Parlamentspräsidenten stellen.
Damit verliert die georgische Regierung ihr außenpolitisches Gesicht. Die Minister waren nicht nur wegen ihrer Ressorts am stärksten präsent im Ausland. Insbesondere Alasania verfügt über weitreichende Kontakte in Europa und den USA. Er stand für das starke Engagement Georgiens bei internationalen Einsätzen wie in Afghanistan oder der EU-Mission in Zentralafrika. Erst in der vergangenen Woche hatte er in Berlin mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen über die künftige Kooperation beim ISAF-Nachfolge-Einsatz in Afghanistan gesprochen.
Machtkampf in der Koalition
Alasania und Panjikidze warnten die Regierung vor einer Aufgabe der Westorientierung. In Washington und Europa wird die Entwicklung in Georgien mit Sorge beobachtet. Doch der Bruch innerhalb der Koalition ist weniger die Folge eines Streits über die internationale Ausrichtung, als ein sehr früher Einstieg in den Wahlkampf für die Abstimmung über das Parlament 2016.
Zudem waren die Spannungen im Sechs-Parteien-Bündnis "Georgischer Traum" von Grund auf angelegt. Dessen Anführer, der Milliardär Bidsina Iwanischwili, setzt auf unbedingte Loyalität, darin nicht unähnlich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Iwanischwilis oberstes Ziel war die Ablösung des damaligen Präsidenten Michail Saakaschwili und seiner Partei „Vereinte Nationale Bewegung“. Dies gelang.
Iwanischwili zog sich danach wie angekündigt vom Posten des Premierministers zurück und überließ das Amt dem 32-jährigen Irakli Garibaschwili. Ihm hängt der Makel an, Ziehsohn Iwanischwilis zu sein. Auch erwartet Iwanischwili, dass Minister und Abgeordnete weiter seinem Rat folgen. Wer ausschert, erfährt öffentlich Missbilligung. Zu spüren bekamen dies Präsident Giorgi Margwelaschwili und eben Alasania. Der Verteidigungsminister arbeitete seine Agenda weitgehend unabhängig ab, ist laut Umfragen der beliebteste Politiker Georgiens und erfuhr Anerkennung im Ausland. Dagegen blieb Garibaschwili blass. Für Stirnrunzeln sorgt seine harsche Rhetorik gegen Saakaschwilis Partei und nun gegen Alasania. Wohl mehr aus Prestigegründen denn aus Sicherheitsbedenken leistet sich Garibaschwili inzwischen umfangreichen Personenschutz, wie man dies zuvor von Saakaschwili kannte.
Wie begründet der Verdacht der Korruption im Verteidigungsministerium ist, muss eine unabhängige Untersuchung ergeben. Doch die Justiz ist eine große Schwachstelle im politischen System Georgiens. Unter Saakaschwili war die Staatsanwaltschaft allmächtig und zugleich der Politik hörig. Die neue Regierung bemüht sich um Reformen. Doch die alten Staatsanwälte blieben mangels anderer geeigneter Juristen im Amt. Bereits vor einem Jahr gab es Ermittlungen und Festnahmen im Landwirtschaftsministerium. Sie erwiesen sich im Nachhinein als wenig haltbar, kosteten aber dem Minister das Amt.
Keine grundsätzliche Änderung des außenpolitischen Kurses
Doch wie wird sich der Ausstieg der Freien Demokraten auf die Außenpolitik der Regierung auswirken? Ohne sie dürfte die Außenpolitik konservativer ausfallen. Aber nichts deutet bislang darauf hin, dass die Regierung den außenpolitischen Kurs grundsätzlich ändern will. Auch Alasania und seine Mitstreiter hatten sich für eine Annäherung an Russland ausgesprochen.
Viel ist darüber spekuliert worden, ob Iwanischwili Georgien im Auftrag des Kremls auf pro-russische Linie bringen will. Insbesondere Saakaschwilis Mitstreiter werfen ihm das vor. Doch bleiben die Belege über die vermeintlichen Verbindungen Iwanischwilis zu Putin vage. Am konkretesten ist noch der Hinweis auf den Besitz von Aktien des russischen Energiekonzerns Gazprom, den Iwanischwili bestätigte.
Dabei verfügte Saakaschwili über eine hervorragende Quelle in Russland. Sein Mitstreiter, neoliberaler Vordenker und Sponsor, Kacha Bendukidze, war wie Iwanischwili in Russland als Geschäftsmann erfolgreich. Wie bedeutend er war, belegt seine Teilnahme an jener Oligarchen-Runde im Jahr 2000, bei der Putin den schwerreichen Geschäftsmännern erklärte, sie dürften weiter ihrem Business nachgehen, müssten sich aber aus der Politik heraushalten. Iwanischwili selbst erwähnte im Interview, er habe mit dem russischen Ministerpräsidenten Dimitri Medwedjew studiert.
Iwanischwili sprach sich für eine offenere Politik gegenüber Russland aus, zeigte sich jedoch enttäuscht, als die Regierung in Moskau nicht sogleich darauf einging. Ministerpräsident Garibaschwili setzt ebenso auf moderate Töne gegenüber Russland, beschwört aber in einem fort die West-Orientierung seiner Regierung.
Bedenklich für die internationalen Beziehungen Georgiens ist, dass die Regierung außenpolitische Kompetenz verliert, während die Herausforderungen wachsen. Zusammen mit den drei Ministern gehen auch Vizeminister im Außen- und Verteidigungsministerium und wohl auch Ministeriumsmitarbeiter, die mit Alasania und dessen Mitstreitern verbunden sind.
Wachsende Herausforderungen
Russland und die beiden von Georgien abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien hatten zunächst verhalten auf die Annäherungsangebote der georgischen Regierung reagiert. Dann aber hoben die russischen Behörden das Embargo auf zahlreiche georgische Produkte wie Wein, Mineralwasser und Früchte auf. Auch blieben russische Politiker zurückhaltend mit Drohungen gegenüber Georgiens Schritten in Richtung EU.
Doch die internationale Anspannung infolge der Ukraine-Krise erschwert es der georgischen Regierung, ihren Annäherungskurs in beide Richtungen fortzusetzen. Für helle Aufregung sorgte in Tiflis das Bekanntwerden eines Entwurfs über einen "Integrations- und Assoziationsvertrag" zwischen Russland und Abchasien Mitte Oktober. Außenministerin Panjikidze und andere Politiker interpretierten den Vertrag als eine Annexion Abchasiens durch Russland, die womöglich noch weiter gehe als bei der Krim. Allerdings besteht Abchasien auf seiner Unabhängigkeit und legte inzwischen einen eigenen Entwurf vor, der von einer strategischen Partnerschaft mit Russland spricht. Auch weisen Experten darauf hin, dass der russische Vertragsentwurf viel Symbolik enthält, teils Aussagen des EU-Assoziierungsvertrages mit Georgien übernimmt, ebenso einen Paragrafen 5 über den Bündnisfall, so wie er im Washingtoner Vertrag der NATO steht.
Problematisch könnte allerdings die Lage an der abchasisch-georgischen Grenzlinie werden. Es sollen vier von fünf Übergängen geschlossen werden, was den Georgiern im abchasischen Bezirk Gali das Leben erheblich erschweren würde. Ansonsten ist die Lage um Südossetien und Abchasien dermaßen zementiert, dass von dort im Moment kaum Unruhe ausgehen dürfte.
Achtung vor russischer Softpower
Zieht man aber in Betracht, mit welchen "Softpower"-Methoden Russland auf der Krim und in der Ostukraine handelt, so sollte die georgische Führung noch dringlicher Lösungen für die innenpolitischen Probleme suchen.
Das drängendste Problem ist und bleibt die hohe Arbeitslosigkeit und die schwierige soziale Lage vieler Menschen in Georgien. Die Koalition "Georgischer Traum" setzte bislang nur ansatzweise ihre vielfältigen Versprechen um.
Hört man sich in Georgien um, so ist bei vielen eine Ernüchterung über die Annäherung an den Westen zu spüren. Es gibt wenig Hoffnung, dass die NATO und die EU zu Hilfe eilen würden, sollte es eine russische Aggression geben. Auch sehen die Menschen kaum Vorteile im EU-Assoziierungsabkommen. Ohnehin stehen viele den erzkonservativen Werten der christlich-orthodoxen Kirche näher als den westeuropäischen Lebensvorstellungen. Ausdruck dafür ist der enorme Respekt für die Orthodoxe Kirche und der Aufwind für erzkonservative Politiker, die der Kirche eng verbunden sind. Nationalistisch, orthodox und auch pro-russisch orientierte Gruppen versuchen, diese Stimmung weiter zu schüren. Es ist gut möglich, dass nicht Saakaschwilis Partei von der Schwäche der Regierungskoalition profitiert, vor allem nicht, solange sie sich nicht mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt. Profitieren könnten stattdessen Politiker, die auf Populismus, Nationalismus, Nähe zur Kirche und eine Abkehr von Westeuropa setzen. Ein Beispiel wäre die eigentlich unbeliebte, aber unermüdliche Politikerin Nino Burdjanadze.
Hohes Konfliktpotenzial ist im Umgang mit den ethnischen und religiösen Minderheiten in Georgien enthalten. Hier geht es zum Beispiel um die armenische Bevölkerung vor allem in Samzche Dschawacheti. Die Unzufriedenheit ist nicht nur wegen der sozialen Lage und der Isolation groß. Die Menschen fühlen sich auch benachteiligt, weil sie zuerst als Sicherheitsrisiko wahrgenommen und entsprechend streng von Polizei und Sicherheitsdiensten behandelt werden. Mangels Arbeit in der Heimat verdienen viele von ihnen ihr Geld in Russland. Gerüchte über eine massenhafte Vergabe russischer Pässe an Armenier in Georgien erwiesen sich aber bislang als falsch. An dieser Stelle ist eine besonnene Politik auch mit dem Nachbarland Armenien nötig.
Die muslimische Minderheit in Georgien wird ebenfalls an vielen Stellen benachteiligt. Mangelnde Perspektiven führen auch in Georgien dazu, dass sich junge Männer dem Kampf in Syrien anschließen. Ein inzwischen weltweit bekanntes Beispiel ist Tarchan Batiraschwili, der als Omar al Schischani ein wichtiger Kommandeur in Syrien ist. Seine Herkunft aus dem Pankisi-Tal lässt Erinnerungen an einen Konflikt zwischen Russland und Georgien wach werden. Während der Tschetschenien-Kriege fanden viele Flüchtlinge, aber auch Kämpfer bei ihren Verwandten im Pankisi-Tal Zuflucht. Russland warf Georgien damals und über die Jahre bis heute vor, Terroristen nicht nur zu beherbergen, sondern auch zu unterstützen. 2001 drohte Russland mit einem Einmarsch im Pankisi-Tal, der abgewendet wurde, weil die USA die georgische Regierung dabei unterstützte, die Kämpfer aus dem Pankisi-Tal zu vertreiben.
Weniger Unterstützer in der EU
Um grenzübergreifende Verbindungen von Kämpfern aus dem russischen Nordkaukasus und Georgien zu kontrollieren und zu unterbinden, bot Georgien nach Angaben Alasanias der russischen Führung eine Sicherheitskooperation an. Indirekt bestätigte Russland, dass dies zumindest während der Winterspiele im nahen Sotschi auch umgesetzt wurde. Eine weitere Sicherheitskooperation zwischen beiden Staaten wäre über die Region hinaus von Bedeutung.
Angesichts der Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten findet die Lage im Südkaukasus derzeit wenig Aufmerksamkeit. Auch verlor Georgien mit dem Amtsende von EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle sowie der Ablösung der Außenminister Schwedens und Polens, Carl Bildt und Radoslaw Sikorski, drei vehemente Unterstützer in der EU. Allerdings könnte eine Chance im Aufbau neuer Kontakte sowie einer neuen Kommunikationsstrategie liegen. Georgien könnte sich bemühen, sich als besonnener und zuverlässiger Partner zu profilieren.

