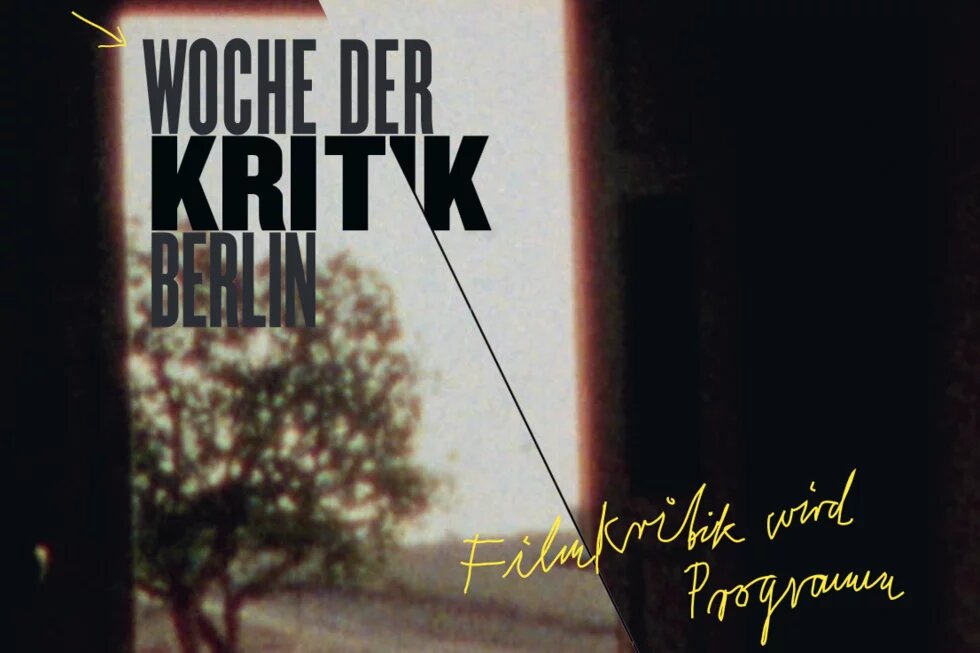Vom 5. bis zum 12. Februar findet anlässlich der Berlinale die erste Woche der Filmkritik statt. Wir sprachen mit der Filmkritikerin Dunja Bialas über die Abgrenzung zur Berlinale, die Herausforderungen aktivistischer Filmkritik und darüber, was einen guten Film ausmacht.
Frau Bialas, Was ist das Besondere an der Woche der Kritik?
Vielleicht ist es erst einmal besonders, dass sie dieses Jahr überhaupt stattfindet. Vor fünfzig Jahren, 1964, gab es einen ersten Versuch, eine Woche der Kritik bei der Berlinale zu etablieren. Es stand damals die Forderung im Raum, die junge Kritikergeneration bei der Programmauswahl zu beteiligen, und einer der Initiatoren war der spätere Forums-Begründer Ulrich Gregor, der selbst auch Kritiker ist und übrigens dieses Jahr den Ehrenpreis der deutschen Filmkritik erhält, zusammen mit seiner Frau Erika Gregor. Die Woche der Kritik war eine ganz klare Gegenveranstaltung zur Berlinale. Aus ihr entwickelte sich später das Internationale Forum des Jungen Films.
Bezeichnend ist, dass die Berlinale anders als die großen A-Festivals die Filmkritiker nie so richtig teilhaben lassen wollte. In den internationalen Jurys findet sich kein einziger Kritiker, aber Food-Aktivisten werden hier mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Kritiker scheinen für die Berlinale nur insofern eine Rolle zu spielen, als diese berichterstattend tätig sein sollen, ansonsten will man sie draußen halten und schon gar nicht mitgestalten lassen.
Insofern unterscheidet sich die Woche der Kritik bereits in der Akzeptanz des Festivals, auf das sie Bezug nimmt, von ihren internationalen Geschwistern: die Semaine de la Critique in Cannes gibt es seit 1961 und ist mit ihrem Alternativprogramm und in ihrer Unabhängigkeit dennoch beim großen Festival integriert, ähnliches gilt für Venedig, Locarno und auch Rotterdam, wo dieses Jahr seit einer Pause von über zehn Jahren erstmals wieder die “Critic’s Choice” stattfand. Die Berlinale hingegen hält sich uns auf Distanz, auch wenn Dieter Kosslick uns nach außen hin toleriert. Die Hilfestellungen, die wir von der Berlinale erhalten haben, sind minimal.
Die Filmkritikerin Dunja Bialas ist Jury-Mitglied der Berliner Woche der Kritik. Sie schreibt für das Online-Filmmagazin Artechock und ist Vorstandsmitglied des Verbands Deutscher Filmkritik e.V. Darüber hinaus setzt sie sich aktiv in der Münchener Film- und Kinoszene ein.
Worin bestand die Motivation solch ein Filmfest erstmalig zu organisieren?
Wir finden, dass Filmkritik stärkeren Bezug zu einer inhaltlichen Gestaltung haben sollte. Wir nennen das “aktivistische Filmkritik”, eine Filmkritik, die sich einmischt, die den Schreibtisch verlässt, die Diskurse anstößt, die sich auch gesellschaftlich auswirken sollen. Es ist ein Irrglaube, zu denken, Filmkritik hätte nichts mit den sozioökonomischen Verhältnissen zu tun. Wir wollen die Zusammenhänge beleuchten und dies in der Öffentlichkeit machen, als handelnde und dialogisierende Personen. Deshalb haben wir für die Woche der Kritik auch ein Format gewählt, das die Debatten gleichberechtigt zu den Filmen stellt.
Unter welchen Aspekten haben Sie die Filme sowie die Schwerpunkte ausgewählt?
Wichtig war es uns, Filme auszuwählen, die das Potenzial mit sich bringen, Diskurse anzustoßen, Denkräume zu öffnen, Widerspruch hervorzubringen. Daneben waren natürlich auch die kinematographischen Qualitäten wichtig. Anders als andere Kritikerwochen haben wir uns jedoch keine formalen Beschränkungen auferlegt, wie erster oder zweiter Film, nur Dokumentarfilm oder eine wie auch immer bestimmte Premierenregel. Gerade letztere lehnen wir bewusst ab. Was uns nicht hindert, nun auch drei Weltpremieren im Programm zu haben, zwei Hochschulproduktionen und den großen Film eines international anerkannten Regisseurs aus Québec, A DIARY OF AN OLD MAN von Bernard Emond. Auch das freut uns natürlich sehr.
Welche Filme haben es schwer Anerkennung beim Publikum zu finden?
Die Frage nach der Anerkennung beim Publikum ist ziemlich heikel, denn sie verbindet sich meist mit dem, was beliebt ist. Und dann zeigt sich meist: Beliebt ist, was gefällt. Man kann sich aber auch ein Publikum in einer gewissen Weise erziehen, ohne dass dies jetzt didaktisch gemeint wäre. Ein Publikum kann sich auch an das Sperrige, Nichtunterhaltsame sehr gut gewöhnen und daran Gefallen finden. Das zeigt zum Beispiel der Publikumspreis von Rotterdam sehr gut, wo es dieses Jahr der fast dreistündige Dokumentarfilm LA VIE DE JEAN-MARIE über einen Pastor unter die Top 5 geschafft hat. Und dies ist bestimmt eine Anerkennung der Leistung des Dokumentarfilmers Peter van Houten durch ein für lange Jahre im guten Sinne erzogenen Publikums.
Anerkennung kann aber auch ganz einfach heißen, dass die Leute ins Kino gehen, weil sie einen gewissen Film sehen wollen. Da haben es dann die Filme leichter, die eine große Marketing-Maschine vor sich hertreiben, die breit in der Presse besprochen werden und auf die man vielleicht schon durch eine Vorberichterstattung aufmerksam geworden ist. Die Filme mit den großen Namen. Kleine Produktionen haben es zunehmend schwer, auch weil das Film- und Freizeitangebot insgesamt immer größer wird, sich in diesem Kampf um Aufmerksamkeit zu behaupten: die Besprechungen werden zurückgefahren, oft mit dem Hinweis auf das Interesse der Leser. So finden die kleinen, unabhängigen Filme dann nur noch ganz schwer zu einem Publikum, und dieses sieht den immer gleichen Film. Ob das aber schon mangelnde Anerkennung ist, nur weil man etwas nicht kennt nicht zu besuchen?
[gallery]
Welche Thematik sollte ihrer Meinung nach filmisch mehr Beachtung finden?
Wenn man Filme nach Thematiken befragt, kann man leicht in die inhaltistische Falle tappen. Vermutlich gibt es mittlerweile zu jedem Thema Filme, es gibt entsprechend viele Themen- oder Spartenfestivals, die sich den Problemen von gesellschaftlichen Randgruppen widmen oder Spezialinteressen befördern. Außerdem gibt es geradezu Wellen: zuerst wurde der Autismus fürs Kino entdeckt, vor allem das Asperger-Syndrom ist da ganz beliebt, dann kamen die Filme auf, die sich mit dem Altern und geriatrischen Fragen befassten. Auch Krebs oder andere schwere Schicksalsschläge sind schon lange kein Tabu mehr für das Unterhaltungskino. Im Dokumentarfilmbereich haben wir es mit einer unfassbar weiten Palette an Themen zu tun, das bringt vielleicht auch die Digitalisierung mit sich, mittlerweile gibt es zu vermutlich jedem Thema einen entsprechenden Film.
Vielleicht sollte man daher vom Thematischen wegkommen und fragen: Was sollte im Film insgesamt mehr Beachtung finden? Dann kommt man ganz schnell auf eine formale Ebene, die oft unterrepräsentiert ist. Es ist dann gar nicht mehr so wichtig, was erzählt wird, sondern vielmehr: wie wird hier erzählt? Film ist ein künstlerisches Medium, und die Gestaltung der behandelten Themen ist letztendlich das Entscheidende. Insofern würde ich Ihre Frage gerne so beantworten: Wir brauchen mehr Filme, die sich ihrer Form ganz bewusst sind, in denen sie sich nicht reflexartig wie von selbst ergibt.
Was unterscheidet die Woche der Kritik inhaltlich von der Berlinale? Gibt es eine konkrete Abgrenzung?
Die große inhaltliche Abgrenzung ist, dass wir nicht das klassische Filmgespräch suchen, sondern eine Debatte anstoßen wollen, die über ein Filmgespräch hinausgeht und auch gesellschaftliche oder ökonomische Zusammenhänge beleuchtet. Dabei geht es aber nicht immer nur allein um die Filmwirtschaft. Filme erzählen uns ja auch etwas über den Zustand der Gesellschaft, über unsere kollektive Psyche. Bei unserem Doppelfeature zum Thema “Lust”, den beiden Teilen der Romantic Comedy DON’T GO BREAKING MY HEART von Johnnie To, die im durchkapitalisierten Hongkong spielt, wird zum Beispiel im Zuge einer leichten und hochgradig unterhaltsamen und Lust bereitenden Liebesgeschichte auch ganz viel über die Gesellschaft gesagt. Während Kosslick durch sein “Kulinarisches Kino” die Kinobesucher zum Toscana-Wein und guten Essen hinführen möchte, wollen wir, dass unsere Besucher anfangen, anders über die Filme und die Gesellschaft nachzudenken als sie das gewohnheitsmäßig tun. Und dadurch vielleicht ein Bewusstsein erlangen, das man ganz allgemein als politische Haltung bezeichnen könnte.
Was macht für Sie persönlich einen gelungenen Film aus?
Gelungen ist ein Film, wenn er mich anspricht, wenn er mich packt. Im besten Fall: Wenn er einen Glücksmoment hervorrufen kann, einen Moment kinematographischer Offenbarung. Bescheidener formuliert, ist ein Film dann für mich gelungen, wenn er eine bewusste Form zeigt, das muss dann aber keineswegs eine perfekte Form sein. Sondern einfach adäquat zu dem, was er erzählt, wo er sich ansiedeln will, was sein eigener Anspruch ist. Auch das halte ich dann oft für sehr gelungen, wenn ein Film bzw. sein Autor oder seine Autorin genau weiß, was der Film sein soll und dies auch umgesetzt wurde.
Worin liegt der Wandel beziehungsweise die Herausforderung in der Filmkritik heute?
Die große Herausforderung der Filmkritik ist heute, sich überhaupt als solche zu behaupten. Gerade im Internet werden Kritiken schon so genannt, wenn sie vor allem den Inhalt wiedergeben und dann noch eine Empfehlung an den Leser abgeben. Filmkritik sollte den Zusammenhängen nachgehen, zwischen Film und Gesellschaft, Film und Produktionsmittel und auch sagen dürfen, wenn eine große Produktion nicht gelungen ist. Oft stehen dieser unabhängigen Filmkritik aber Abhängigkeiten des Mediums gegenüber Geldgebern oder Anzeigenkunden entgegen. Und dann stecken die Filmkritiker schließlich selbst auch in der finanziellen Misere und müssen sich nach weiteren Jobs umsehen, um überhaupt überleben zu können. Auch das schafft Abhängigkeiten, wenn man seinen Auftraggeber nicht verprellen möchte, weil man “unliebsame” Texte schreibt. Die große Herausforderung der Filmkritik heute ist also ihre Diskursfähigkeit und ihre Unabhängigkeit.
Wird es eine nächste Woche der Kritik geben?
Wir hoffen sehr, dass die Woche der Kritik Anklang – oder Anerkennung! – beim Publikum findet. Wir finden, dass die Woche der Kritik darüber hinaus aber eine inhaltliche Notwendigkeit im Bezug auf die Berlinale darstellt, insofern ja: Es wird eine nächste Woche der Kritik geben.
Interview: Linda Lorenz, Heinrich-Böll-Stiftung.
Die Heinrich-Böll-Stiftung ist Kooperationspartnerin der Woche der Kritik. Hier das gesamte Programm mit Informationen zu den Filmen.