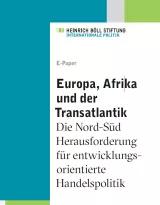Europa, Afrika und der Transatlantik
Politische Verhandlungen zur Vertiefung globaler Wirtschaftsintegration vollziehen sich nicht nur auf multilateraler Ebene, sondern in den letzten Jahrzehnten wieder verstärkt in regionalen Gruppierungen. Wir begegnen hier paradoxen Abläufen. Entwicklungsländer werden von Industrieländern in deren umfassende Handels- und Investitions-Abkommen eingebunden, während sie untereinander nur lose in regionalen Wirtschaftsgemeinschaften verknüpft sind.
Zwölf Jahre lang bot die Aushandlung der Economic Partnership Agreements (EPA) der Europäischen Union mit den Afrika-, Karibik- und Pazifik-Staaten (AKP) ein Beispiel für solch komplexe Nord-Süd-Abkommen. Nachdem 2014 die Verhandlungen für drei EPAs mit afrikanischen Ländergruppen abgeschlossen wurden, steht nun die Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) zwischen der EU und den USA auf der Tagesordnung, die – obwohl als reines Nord-Nord-Abkommen geplant – ihrerseits Auswirkungen auf Entwicklungsländer haben wird.
Die Parallelität dieser beiden Prozesse bewirkt, dass die Zukunft der Wirtschaftsintegration innerhalb Afrikas heute in neuen Zusammenhängen global zur Verhandlung steht. Was wird das zusammengesetzte Ergebnis beider Prozesse sein, sofern man das bereits absehen kann? Das ist in der Literatur bisher nicht behandelt worden, obwohl es von enormer geopolitischer Bedeutung sein wird.
Um zu verstehen, wie hoch der Einsatz gerade für Afrika sein wird, muss die in der Handelstheorie etablierte Unterscheidung zwischen reiner Güterhandelsliberalisierung und tiefergehender Wirtschaftsintegration herangezogen werden (shallow and deep integration).
Produktdetails
Inhaltsverzeichnis
1. Dimensionen der Regionalisierung
2. Das Paradox der Tiefenintegration
3. Regionalgemeinschaften in Afrika
4. Wirtschaftspolitische Spielräume (policy space)
5. Die EPA-Ergebnisse
- Zum Format der abgeschlossenen EPAs
- Der Inhalt der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
- Politische Gesamteinschätzung
6. Der Transatlantik
Anhang