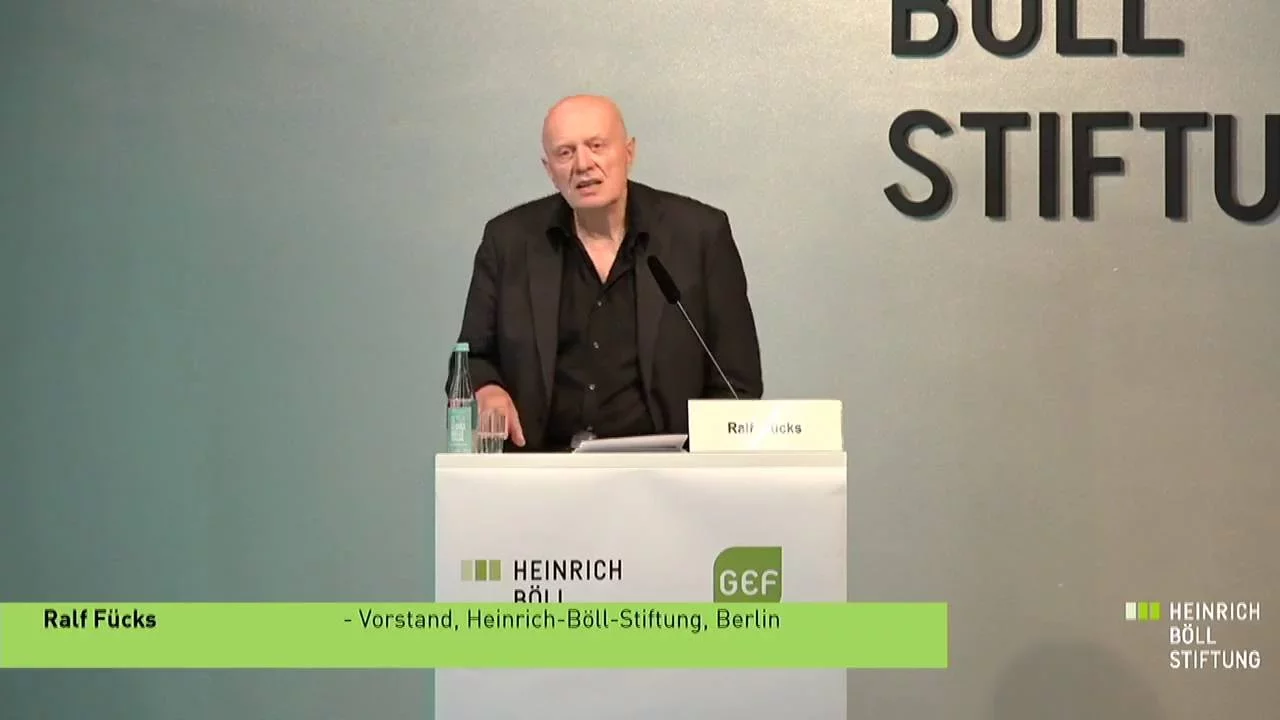Expert/innen sind sich einig, dass die Ursachen und langfristigen Folgen der Flüchtllingsproblematik kaum auf nationaler Ebene gelöst werden können. Ob Brüssel künftig eine prominentere Rolle in der Krise spielen kann, wurde während der europapolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung am 26. Mai in Berlin diskutiert.
In den Diskussionen der Expertinnen und Experten wurde schnell offenkundig, dass weitreichende Gemeinschaftslösungen wie eine solidarische Umverteilung von Flüchtlingen angesichts der politischen Realitäten faktisch aussichtslos sind. Neue europapolitische Impulse erhofften sich viele stattdessen von einer bislang kaum definierten "Koalition der Willigen", die neben kooperationsbereiten Staaten auch Städte, Organisationen der Zivilgesellschaft und Unternehmen umfassen könnte. Beim als notwendig erachteten Lastenausgleich auf europäischer Ebene wurden Strafzahlungen für unwillige Staaten weitgehend abgelehnt. Stattdessen gab es Vorschläge für eine stärkere Betonung positiver finanzieller Anreize, um aufnahmewillige Kommunen direkt zu unterstützen und die einheimische Bevölkerung davon zu überzeugen, Flüchtlinge nicht nur als Belastung zu betrachtet. Es blieb allerdings offen, ob sich diese Ideen, die im Kleinen durchaus erprobt sind, auch im politisch anspruchsvolleren europäischen Umfeld umsetzen lassen werden.
Begrüßung von Ralf Fücks. Alle Mitschnitte in unserer Youtube Playlist.
Als bislang sträflich vernachlässigtes Instrument der EU wurde die internationale Diplomatie identifiziert. Viele Tagungsgäste forderten, dass Europa größere Anstrengungen unternehmen solle, um eine effektivere internationale Zusammenarbeit bei der Bewältigung der globalen Flüchtlingskrise zu organisieren. Die Vorzüge und Nachteile des umstrittenen Flüchtlingsabkommens mit der Türkei wurden dabei auch an diesem Abend kontrovers diskutiert. Dabei überwogen bei vielen die Zweifel, ob das gegenwärtig vor dem Scheitern stehende Abkommen tatsächlich als Modell künftiger diplomatischer Initiativen dienen sollte. So auch der Tenor der Eröffnungsrede von Roderick Parkes vom Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien (EUISS) in Paris.
Flüchtlingskrise oder Krise der EU?
Dass die Flüchtlingskrise für die Europäische Union eine ernste Herausforderung darstellt, die in vielerlei Hinsicht als Katalysator europäischer Widersprüche wirkt, wurde von den Tagungsgästen nicht bezweifelt. Allerdings waren viele Expertinnen und Experten der Ansicht, dass es sich um eine weitgehend selbst verschuldete Krise handele, die in ihrem Ausmaß durch eine frühzeitige Reaktion der europäischen Staaten hätte begrenzt werden können. Rosa Balfour vom German Marshall Fund of the United States in Brüssel plädierte deshalb dafür, nicht von einer "Flüchtlingskrise", sondern von einem "Kurzschluss" zu sprechen, der die politische Handlungsfähigkeit der EU lahmgelegt habe. Die innenpolitische Angst einzelner Regierungen vor populistischen Bewegungen und Wahlniederlagen habe die kollektive Entscheidungsfindung in Brüssel auf unvorhersehbare Weise beeinflusst und zu unkoordinierten nationalen Alleingängen geführt. Es sei z.B. bis heute unklar, warum die europäischen Regierungen im August 2015 die bereits geltenden Mechanismen, also z.B. die Massenzustrom-Richtlinie zum vorübergehenden Schutz von Vertriebenen, nicht umgesetzt habe. Eine entschlossene Reaktion hätte die Krise in einem völlig anderem Licht erscheinen lassen, da die Flüchtlingszahlen selbst in ihrer damaligen Höhe keine existentielle bzw. systemische Gefahr für die EU darstellten, so Balfour. Stattdessen sei das Chaos mit den heute sichtbaren Folgen ausgebrochen.
Rosa Balfours Analyse der Dimension der Flüchtlingskrise für die EU wurde von vielen Tagungsgästen geteilt. Monica Frassoni, Co-Vorsitzende der Europäischen Grünen Partei, erinnerte daran, dass Staaten wie die Türkei oder der Libanon sehr viel mehr Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hätten. Die europäischen Probleme seien also nicht auf eine übergroße Belastung, sondern auf den Widerwillen zurückzuführen, gemeinsame politische Lösungen zu finden. Rebecca Harms, Vorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, nahm die EU-Institutionen vor scharfer Kritik in Schutz. Die Europäische Kommission habe das Problem lange vor den Mitgliedstaaten erkannt und entsprechende Vorstöße gemacht. Diese hätten es allerdings lange ignoriert bzw. auf die unmittelbar betroffenen südlichen EU-Mitglieder abgeschoben. Auch heute würden ambitionierte Lösungsvorschläge der EU durch nationale Alleingänge verhindert, so die Kritik von Harms. Dies beträfe nicht nur mittelosteuropäische Länder wie Polen oder Ungarn. Auch Frankreich und Großbritannien zeigten nur wenig Bereitschaft zu einer stärkeren Kooperation. Dass hier auch Deutschland nicht völlig unschuldig sei, ließ Ralf Fücks, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, bei seiner Eröffnung der Tagung anklingen: Die aus humanitärer Sicht zu begrüßende Öffnung der Grenzen durch die deutsche Regierung im vergangenen Jahr habe als unilateraler Akt ohne europapolitische Absprache zur heutigen Situation beigetragen.
Nationale Perspektiven prägen das Bild
Wie unterschiedlich die Interpretationen der Flüchtlingskrise tatsächlich ausfallen, wurde noch einmal von den Schilderungen der internationalen Tagungsgäste bestätigt. Steffen Angenendt von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin erläuterte in seiner Darstellung der deutschen Asyl- und Flüchtlingspolitik, dass sich die Bundesregierung neben humanitären Gründen auch aufgrund der guten Wirtschafts- und Haushaltslage für eine großzügige Aufnahme von Flüchtlingen entschlossen habe. Prinzipiell habe sich an den Zielen dieser Politik nichts geändert, die Bundesregierung lehne Obergrenzen für die Aufnahme weiterhin ab und wolle die europäischen Binnengrenzen offen halten. Die rot-grüne Regierung in Schweden sei dagegen durch die politischen Realitäten zu einer abrupten Kehrtwende in ihrer großzügigen Asylpolitik gezwungen worden, berichtete Pernilla Bäckman vom Swedish Institute for European Policy Studies in Stockholm. Das Land habe in Relation zur Bevölkerungsgröße die meisten Flüchtlinge in Europa aufgenommen, was Sorgen um die Zukunft des schwedischen Sozialstaats und Ängste vor soziokulturellen Integrationsproblemen ausgelöst habe. Viele Schweden seien enttäuscht, dass sich andere EU-Staaten einer Lastenteilung verweigert, sondern Schweden stattdessen kritisiert hätten, es wirke als "Magnet" (oder "pull-factor") für neue Flüchtlinge in Europa.
Zu den Ländern, die eine Asyl- und Flüchtlingspolitik nach schwedischem Vorbild entschieden ablehnen, gehört auch Polen. Die polnische Regierung widersetze sich einer Europäisierung der Krise und verfolge in puncto Flüchtlingsumverteilung eine "Politik des Nichthandelns", so Piotr Buras, Direktor des Büros des European Council on Foreign Relations (ECFR) in Warschau. Stattdessen würden die Bekämpfung der Fluchtursachen und die Sicherung der europäischen Außengrenzen unterstützt. So habe Polen Grenzbeamte nach Mazedonien und Ungarn geschickt und Bereitschaft für eine stärkere humanitäre Hilfe für Flüchtlinge vor Ort signalisiert. Diese Politik sei im Übrigen auch von den liberalen Vorgängern der aktuellen konservativen Regierung verfolgt worden und stoße in der Bevölkerung auf große Zustimmung, so Buras.
Die Flüchtlingskrise hat eine globale Dimension
Die letzte Diskussion der Tagung konzentrierte sich auf die die außereuropäische Perspektive der Flüchtlingskrise, die in den europäischen Debatten oftmals vernachlässigt wird. Katharina Lumpp, Vertreterin des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Deutschland, erklärte, dass es sich letztlich um eine globale Krise handle, deren Hauptlast keineswegs von den reichen Ländern im Westen getragen werde. 80 Prozent aller internationalen Flüchtlinge lebten heute in Entwicklungsländern. So habe z.B. der Libanon bei einer Bevölkerungsgröße von 4,5 Millionen Einwohnern über eine Million syrische Flüchtlingen aufgenommen. Kathleen Newland vom Migration Policy Institute in Washington zufolge, wollen die USA in diesem Jahr 75.000 ausgesuchten und sorgfältig überprüften Flüchtlingen die Umsiedlung in die USA ermöglichen. International sei dies das größte staatliche Umsiedlungsprogramm. Angesichts des Ausmaßes der Krise und im Kontext einer restriktiven Asylpolitik sei es allerdings nur ein "Tropfen auf den heißen Stein", so Newland. Wichtiger sei die finanzielle Hilfestellung: In der Syrienkrise habe die US-Regierung etwa 4 Milliarden US-Dollar für die Flüchtlingshilfe ausgewiesen. Etwa ein Viertel der Gesamtbudgets internationaler Institutionen wie des UN-Flüchtlingshilfswerks und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz würden ebenfalls von den Vereinigten Staaten getragen.
Aboubakr Jamai vom IAU College in Aix-en-Provence in Frankreich berichtete schließlich von der Situation in seinem Heimatland. Marokko nehme nicht nur viele Migrant/innen aus Subsahara-Afrika auf, sondern gehöre aufgrund großer wirtschaftlicher und demographischer Probleme auch zu den wichtigen Herkunftsländern von Migrant/innen. Die Regierung unterstütze diese Auswanderung vor allem aufgrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit. Viele Marokkaner seien auf die Geldüberweisungen aus Europa angewiesen. Einer Studie zufolge würde das marokkanische BIP ohne diese finanzielle Unterstützung um 7 Prozent einbrechen und eine Million Marokkaner würden in absolute Armut stürzen, so Jamai.
Derzeit sind nur zweitbeste Lösungen erkennbar
Wie könnte eine Asyl- und Flüchtlingspolitik aussehen, die nicht nur die divergierenden europäischen Interessen, sondern auch die komplexen internationalen Rahmenbedingungen angemessen in Betracht zieht? Die Rückkehr zu einer Politik der offenen Grenzen und einer "Willkommenskultur", wie sie im September 2015 in Deutschland, Österreich und Schweden zu beobachten war, erwartete niemand. Doch betreibe Europa derzeit eine reine Abschottungspolitik, die nationale Interessen voranstellt und die Genfer Flüchtlingskonvention praktisch ausgehebelt hat, so die allgemeine kritische Einschätzung. Viele der Expert/innen teilten die Einschätzung, dass eine nach sicherheitspolitischen Aspekten organisierte Überwachung der europäischen Außengrenzen auch weiterhin im Vordergrund stehen wird.
Eine anspruchsvollere Strategie müsste einen realistischen Mittelweg finden, der Migration nicht länger als Bedrohung betrachtet und die Einreise von Flüchtlingen nach Europa stattdessen effektiv steuert und reguliert, so der Tenor vieler Beiträge. Künftig müsse es darum gehen, legale Einwanderungswege nach Europa zu schaffen, um die irreguläre Migration zu verringern. Anstatt besonders betroffene Länder wie Griechenland praktisch mit dem Problem allein zulassen, müssten die Belastungen in der EU solidarisch geteilt werden. Angesichts der politischen Stimmungslage in Europa waren sich die Fachleute allerdings darin einig, dass konzeptionell zusammenhängende europapolitische Pläne derzeit auf EU-Ebene kaum umgesetzt werden können. Piotr Buras ließ z.B. keinen Zweifel daran, dass Polen die Umsiedlung von Flüchtlingskontingenten innerhalb Europas und nach Europa, wie sie bereits beschlossen bzw. von der EU-Kommission vorgeschlagen wurde, kategorisch ablehnen werde. Als Alternative wurde deshalb immer wieder eine "Koalition der Willigen" ins Spiel gebracht, die nicht nur kooperationsbereite Staaten, sondern auch einzelne Städte, Unternehmen und Organisationen aus der Zivilgesellschaft umfassen könnte. Monica Frassoni zufolge hätten z.B. Barcelona und Paris entgegen der Position der eigenen Regierungen ihre Bereitschaft erklärt, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Diese vermeintlich nahe liegende Umgehung der nationalstaatlichen Ebene wurde allerdings von einigen Stimmen aus rechtlichen, politischen und praktischen Gründen eher skeptisch beurteilt. Eine "Koalition der Willigen" werde ohne staatliche Koordination kaum effektiv sein können, so das Argument.
Bei den Vorschlägen für eine finanzielle Lastenteilung wurden Strafzahlungen für aufnahmeunwillige EU-Staaten von vielen Teilnehmer/innen abgelehnt. Stattdessen wurden mögliche positive Anreize erörtert, die Staaten und vor allem Kommunen zu einer freiwilligen Aufnahme von Flüchtlingen bewegen sollen. Piotr Buras und Steffen Angenendt schlugen z.B. vor, Städte und Gemeinden für ihre Aufnahme mit Beträgen zu kompensieren, die nicht nur die pro-Kopf-Kosten der Flüchtlinge decken, sondern zusätzliche Investitionen in die lokale Infrastruktur ermöglichen würden. Gerade in strukturschwachen Gegenden könnte der einheimischen Bevölkerung so das Gefühl vermittelt werden, direkter Nutznießer einer aktiven Flüchtlingspolitik zu sein.
Das EU-Türkei-Abkommen: Modell einer neuen Flüchtlingsdiplomatie?
Ob sich diese Ideen europapolitisch umsetzen lassen, musste in der Diskussion letztlich offenbleiben. Rebecca Harms empfahl angesichts der "deprimierenden Situation" in Brüssel, sich auf die humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge vor Ort zu konzentrieren und dabei auch intensiver mit Aufnahmeländern wie Jordanien und dem Libanon zu kooperieren. Viele Expertinnen und Experten meinten, dass die EU viel stärker auf die Instrumente der Diplomatie setzen sollte, um internationales Engagement zu organisieren und andere Länder, z.B. die Golfstaaten, zu einer großzügigeren Asylpolitik und umfangreicheren Umsiedlungsprogrammen zu bewegen.
Aktuell beschränkt sich dieser Ansatz auf das umstrittene Abkommen mit der Türkei, das auch während dieser Tagung kontrovers diskutiert wurde. Viele Gäste übten scharfe Kritik an den rechtsstaatlichen Mängeln und den humanitären Folgen des Abkommens. Auch die politischen Mängel wurden hervorgehoben. Rosa Balfour fühlte sich an Europas Flüchtlingspakt mit Gaddhafi von 2010 erinnert, der dem libyschen Diktator faktisch erlaubt habe, die EU zu erpressen. Dies drohe sich nun zu wiederholen. Im Gegenzug habe sich Europa lediglich eine Atempause verschafft, ohne nachhaltigen Lösungen näher gekommen zu sein. Balfour war aufgrund ihrer ernüchternden Analyse der Ansicht, dass die EU in der Flüchtlingsfrage künftig besser auf die Zusammenarbeit mit autoritären Regierungen verzichten sollte.
Diese kategorische Ablehnung des Abkommens wurde allerdings nicht von allen Fachleuten geteilt. So wollte Ralf Fücks den Dialog und die Zusammenarbeit mit autoritären Regierungen nicht grundsätzlich ausschließen, auch wenn er den konkreten Inhalt des EU-Türkei-Abkommens als ungenügend einschätzte. So sei das vereinbarte Umsiedlungsprogramm aus der Türkei nach Europa nicht geeignet, um den Anreiz zur Öffnung neuer illegaler und gefährlicher Routen nach Europa zu senken. Roderick Parkes zufolge ist eine derartige Verlagerung der Flüchtlingsrouten jedoch bislang nicht zu beobachten. Parkes stimmte mit anderen Expert/innen darin überein, dass das Abkommen dahingehend erfolgreich sei, dass es aktuell die Zahl der Flüchtlinge, die in Europa ankommen, spürbar gesenkt habe. Der Vertrag komme beiden Seiten zugute und werde zudem von allen EU-Staaten unterstützt, was angesichts der zuvor diskutierten Probleme nicht geringgeschätzt werden sollte. Steffen Angenendt erinnerte schließlich an die möglichen Folgen des aktuell drohenden Scheiterns des Abkommens. Griechenland würde aufgrund der erneut rasant ansteigenden Flüchtlingszahlen unter erheblichen Druck geraten und müsste von den anderen EU-Staaten sehr viel stärker als bisher unterstützt werden.
Alles in allem spiegelten die Diskussionen der Konferenz die politische Großwetterlage wider: Viele nationale Perspektiven, die nicht einfach in Einklang zu bringen sind. Und trotzdem gab es eine Reihe von Lösungsansätzen, die es wert sind gemeinsam zu verfolgen - im Sinne einer humanitären Lösung für diejenigen, die vor Krieg und Gewalt flüchten müssen.
Dieser Beitrag ist Teil unseres Dossiers "Grenzerfahrung - Flüchtlingspolitik in Europa".