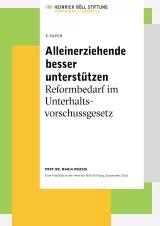Die Notlagen Alleinerziehender sind seit geraumer Zeit bekannt, und dennoch ist es bisher nicht gelungen, ihre Lebenssituation durch Reformen zu verbessern. Zwei Vorschläge der Familienpolitischen Komission.
Jede fünfte Familie mit Kindern in Deutschland wird von Alleinerziehenden betreut und versorgt. Diese Familien sind in einem hohen Maße von Armut bedroht. Obwohl 70 Prozent dieser Eltern erwerbstätig sind, reicht in vielen Familien das Einkommen nicht aus.
Kindergeldzuschlag für Alleinerziehende – um das Armutsrisiko von Alleinerziehendenfamilien effektiv zu verringern
Ein Blick auf die Leistungen für Familien dokumentiert, dass sie Armut zwar reduzieren, insgesamt aber breit streuen. So mindert z.B. die Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende, die kürzlich beschlossen wurde, das Armutsrisiko kaum; diese Reform erreicht nur die Alleinerziehenden, die ein nennenswert hohes zu versteuerndes Einkommen haben.
Unmittelbar wirksamer wäre ein Kindergeldzuschlag in Höhe von monatlich 100 Euro, der nicht mit dem Unterhalt verrechnet werden muss; dadurch kann das hohe Armutsrisiko von fast 41 Prozent bei Kindern von Alleinerziehenden wirkungsvoll gesenkt werden. Auch Erhöhungen des Kindergeldes kommen bei Alleinerziehenden, die von Hartz IV leben oder Unterhaltsvorschuss bekommen, nicht an.
Aufhebung der vollen Anrechnung des Kindergelds beim Unterhaltsvorschuss – um Kinder in Alleinerziehende finanziell besser abzusichern
Die volle Anrechnung des Kindergeldes auf den Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussrecht aus dem Jahr 2008 ist problematisch. Der Unterhaltsvorschuss soll den Kindesunterhalt ausgleichen, der nicht gezahlt wurde oder der zu niedrig ist. Da der Vorschuss vom unterhaltspflichtigen Elternteil wieder zurückgefordert werden kann und ihm oder ihr zur Hälfte das Kindergeld zusteht, wurde bis Ende 2007 konsequenter Weise diese Hälfte des Kindergeldes vom Unterhaltsvorschuss abgezogen. Diese Regelung entsprach dem Kindesunterhaltsrecht.
Seit dem 1.1.2008 wird das Kindergeld in voller Höhe auf den Vorschuss angerechnet; seitdem wird also auch der Kindergeldanteil des betreuenden Elternteils abgezogen. Dies ist – im Zusammenhang mit den Grundsätzen des Kindesunterhaltsrechts betrachtet – eine Regelung, die in sich widersprüchlich ist. Denn der Unterhaltsvorschuss ist ein Vorschuss auf den nicht gezahlten Kindesunterhalt mit Regressregeln; er wird unabhängig vom Einkommen des betreuenden Elternteils gewährt und ist nicht bedürftigkeitsgeprüft.
Es kann deshalb rechtssystematisch nicht begründet werden, warum der betreuende Elternteil die ihm zustehende Hälfte des Kindergeldes einsetzen muss, obwohl er die Betreuung leistet und den Vorschuss bei regulärer Zahlung des Unterhaltes gar nicht in Anspruch nehmen müsste. Die Erhöhung des Kindergeldes zum 1.1.2009 hat sich für den betreuenden Elternteil so ausgewirkt, dass er oder sie weniger Unterhaltsvorschuss bekam. Jede weitere Kindergelderhöhung kommt also bei ihm oder ihr gar nicht an.
Die volle Anrechnung des Kindergeldes auf den Unterhaltszuschuss sollte deshalb so schnell wie möglich rückgängig gemacht werden. Im Jahr 2016 hätte sich damit die Unterhaltsvorschussleistung auf 240 Euro für Kinder bis zu sechs Jahren und 289 Euro für Kinder zwischen sechs und (unter) zwölf Jahren erhöht.