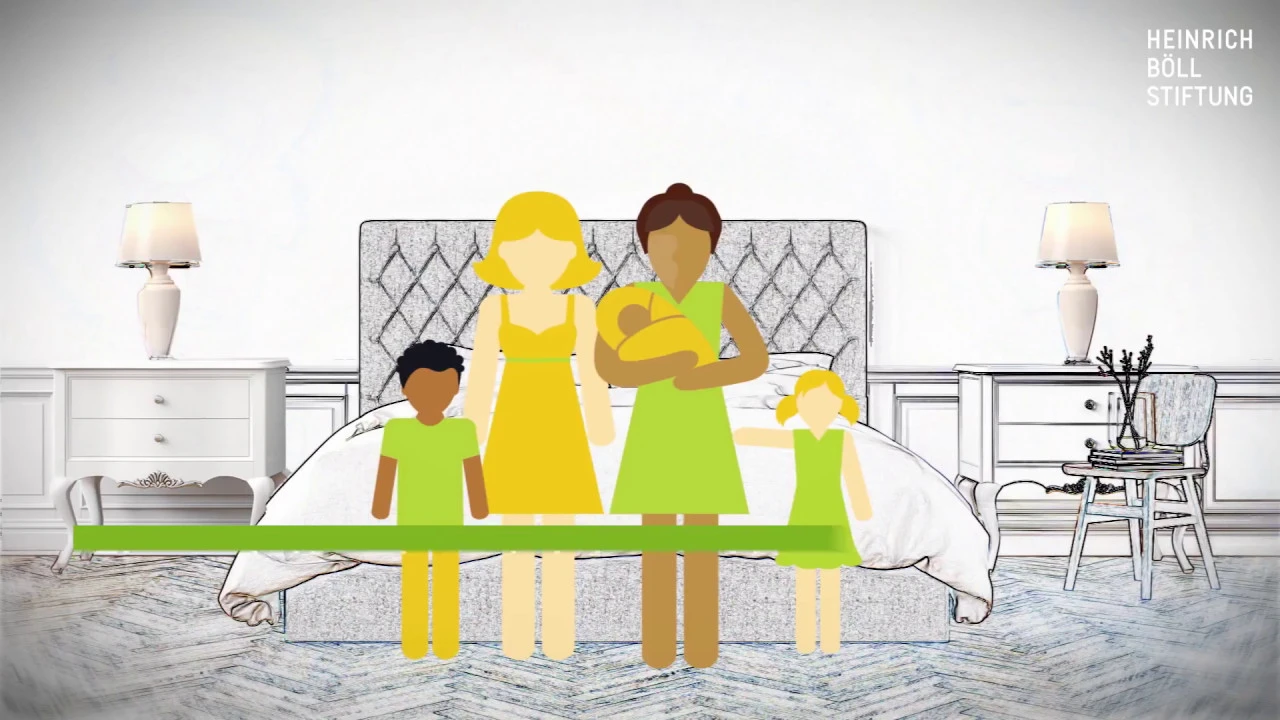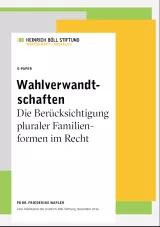Die heutige Vielfalt der Lebensformen steht einem relativ engen Recht gegenüber. Die Familienpolitischen Komission schlägt deswegen vor: Ehe für alle, ein Pakt fürs Zusammenleben und die Ausweitung des kleinen Sorgerechts.
Familie ist bunt; sie reicht heute von der klassischen Ehe über nichteheliche Lebensgemeinschaften mit und ohne Kinder, Ein-Eltern- oder Patchwork-Familien, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften bis hin zu familiären Netzwerken, die über Generationengrenzen hinweg gelten und auch Menschen ohne verwandtschaftliche Bindung einschließen.
Verantwortung wird nicht ausschließlich innerhalb der Ehe gelebt oder in einer Liebesbeziehung übernommen: Freundinnen und Freunde etwa, oder Nachbarn und Nachbarinnen helfen sich gegenseitig und stehen füreinander ein. Auch Alten-WGs, die sich stetig entwickelnden neuen Lebens- und Wohnformen, z.B. in Genossenschaften oder Mehrgenerationenhäusern, beruhen oft auf sozialen, nicht auf verwandtschaftlichen Beziehungen der Bewohner/innen.
Diese Vielfalt der Lebensformen steht einem relativ engen Recht gegenüber, das bei weitem nicht auf alle Gemeinschaften anwendbar ist. Nichteheliche Lebensgemeinschaften werden von der Rechtsordnung fast durchgehend als Beziehungen zwischen Fremden behandelt, gleichgültig, wie lange sie bestehen.
Obwohl auch in den neuen Verantwortungsgemeinschaften ein Teil der Betreuungs-, Sorge- und Pflegearbeit für Kinder, kranke oder alte Menschen übernommen wird, werden diese vom Staat sozialrechtlich nur dann zur Kenntnis genommen, wenn es seinen fiskalischen Interessen dient, wie z. B. bei der Anrechnung des Einkommens in einer Bedarfsgemeinschaft. Wer aber Pflichten hat, sollte auch garantierte Rechte haben.
Derzeit ist die Rechtslage für diejenigen, die weder Ehe noch Lebenspartnerschaft eingehen wollen, sehr unübersichtlich und inkonsistent. Ein vereinfachtes Rechtsinstitut soll hier Abhilfe schaffen, die Freiheit der Lebensentwürfe und der Verantwortungsübernahme zu ermöglichen, und zwar in allen sozialen Lagen. Diese vielfältigen Sorge- und Solidarbeziehungen müssen im Alltag unterstützt, rechtlich abgesichert und soziale Schieflagen vermieden werden.