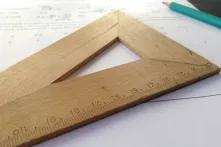Wie verlaufen Radikalisierungsprozesse bei Jugendlichen und was kann die Schule dagegensetzen? Um Feindbilder nicht ungewollt zu verschärfen, muss Schule ihr Handeln im Konflikt neu reflektieren. Ein engagiertes Plädoyer aus der Praxis.

Dieser Beitrag ist Teil unseres Dossiers Schule und Zivilgesellschaft.
Autoritäre Lehrkräfte waren vermutlich zu keiner Zeit für die Mehrzahl ihrer Schülerinnen und Schüler wirkliche Autoritäten. Eine Neuauflage von Schule, in der sich Bildung und Erziehung im Sinne von Aufzucht vereinen, ist nicht in Sicht – trotz unablässiger Bemühungen „neuer“ gesellschaftlicher Kräfte, die sich gegen das „Gutmenschentum“ und die vermeintlich „wirren Ideen“ der „Alt-68er“ in Stellung bringen.
Indes gehört mittlerweile die Generation der „68er“-Lehrkräfte selbst zu einer aussterbenden Spezies innerhalb der Bildungslandschaft. Sie ist insofern nichts als ein Pappkamerad, der von rechten Demagogen in Stellung gebracht wird.
In der Regel treten heute nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Eltern selbstbewusster auf. Sie organisieren sich in Elternräten, fordern Mitspracherecht ein und können zu unangenehmen Diskussionspartnern auf Elternabenden und während der Lernentwicklungsgespräche werden.
Die Einforderung von Fleiß und Disziplin seitens der Schule wird oft skeptisch zur Kenntnis genommen. Eigene Verfehlungen in der Schule werden hingegen dem Nachwuchs gegenüber als tolle Auftritte verklärt, bei denen die Lehrer/innen angeblich stets als „Loser“ zurückblieben. In der Tendenz kommt dabei eine abwertende Botschaft gegenüber der Schule rüber.
Eingewanderte Ehrfurcht
Ungeachtet dessen gibt es sie aber noch, die ehrfürchtigen Eltern. Man findet sie unter anderem innerhalb bestimmter Communities, die von einer Migrationsgeschichte geprägt sind, in denen Armut und Krieg die persönliche Entwicklung determiniert haben. Sie kommen aus Regionen, in denen Bildung als ein Privileg gilt, welches einen Ausweg aus eigentlich ausweglosen Lagen verspricht.
Eine verinnerlichte und angesichts der in der neuen Wahlheimat vorgefundenen Bedingungen zugleich diffuse Haltung, die zudem von Kommunikationsblockaden gekennzeichnet ist, lässt Schule hier immer noch als ehrwürdige, nichthinterfragbare Institution erscheinen, der man seinen Nachwuchs vertrauensvoll aushändigt.
Diese Ehrfurcht aus Verunsicherung führt unter anderem dazu, dass solche Eltern weniger Präsenz gegenüber der Schule zeigen. Das jedoch kann von Seiten des Schulpersonals durchaus als Desinteresse wahrgenommen werden.
Die Schule kann im Empfinden der betroffenen Kinder und Jugendlichen so zu einer Macht werden, welche sich der elterlichen Einflussnahme fast vollständig entzieht und von deren Seite daher weder Schutz noch Unterstützung zu erwarten ist. Reglementierungen können dann den Anschein von Willkür bekommen, wenn die Betroffenen nicht die Möglichkeit haben, das Vorgehen der Schule innerhalb der Familie angemessen zu reflektieren – und gegebenenfalls auch gegen ertragenes Unrecht vorzugehen.
Familienkulturen im Kontrast
Vor diesem Hintergrund bringen Kinder sich mit gänzlich unterschiedlichen familiären Voraussetzungen in den Schulalltag ein. Hier eine Familienkultur, die als verschlossenes System gegenüber äußeren Lebensbereichen in Erscheinung tritt und nach innen einen unbedingten Zusammenhalt einfordert, dort eine Familienkultur, die geprägt ist von Ein-Eltern-Haushalten und Patchwork-Familien, deren Lebensalltag durch die Anforderungen der Arbeitswelt und die Erwartungen der Konsumindustrie zunehmend von Intimitätsverlust begleitet wird.
Ein Aufeinanderprallen dieser unterschiedlichen familiären Lebensbereiche im Lebensbereich Schule kann auf der Ebene des Meso-Systems zwischen der Schule, den Jugendlichen und deren Familien für große Spannungen sorgen.
Gleichzeitig bildet sich auf Seiten der Eltern – unabhängig vom kulturellen Hintergrund – eine Verunsicherung in Bezug auf ihr Erziehungsverhalten heraus. Das gilt entsprechend auch für die Lehrkräfte. Aus Angst, auf Verfehlungen der Schülerinnen und Schüler falsch zu reagieren, wird häufig zu spät oder gar nicht gehandelt.
Damit werden den jungen Menschen Entscheidungsspielräume eingeräumt, ohne sie gleichzeitig zu befähigen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Dieser Verlust von Rahmensetzung führt auf Seiten der Kinder und Jugendlichen zu weiteren Verunsicherungen. Sozialverhalten kann dann kaum noch modellhaft erlebt, folglich auch nicht verinnerlicht werden.
Rollenunklarheiten
Da eine Zusammenarbeit von Eltern und Schule längst keine Selbstverständlichkeit ist, kommt es nicht selten dazu, dass Elternhaus und Schule sich gegenseitig die unbeliebte autoritäre Rolle zuschieben wollen. Die Schule wird zudem mit kaum zu erfüllenden Erwartungen seitens der Eltern konfrontiert: Sie soll nämlich neben fachlichen Inhalten auch die Grundregeln des sozialen Zusammenlebens vermitteln –was innerhalb der vorgegebenen Unterrichtsziele in der dafür zur Verfügung stehenden Zeit, nach PISA und Inklusion, mit dem jetzigen Personalschlüssel kaum mehr möglich erscheint.
Es kommt zu einer Unschärfe der Rollen von Elternhaus, Schule und Schüler/innen und zu einer Überforderung auf allen Seiten. Verantwortungsbereiche werden scheinbar abgegeben, in der Realität jedoch aufgegeben, indem sich Lehrkräfte und Eltern zunehmend aus ihren oftmals ohnehin unklaren Rollen zurückziehen.
Für die Schülerinnen und Schüler wird vor allem der Verantwortungsbereich der Eltern zunehmend undeutlicher. Die Schule reagiert darauf nicht selten mit abwertender Haltung gegenüber den Eltern und manchmal auch mit unangemessener Einmischung in deren Belange. Letzteres kommt durch eine deutlich ansteigende Zahl von Meldungen seitens der Schulen bei den Sozialdienststellen und Beratungseinrichtungen zum Ausdruck. Eine Zusammenarbeit mit den Eltern ist an diesem Punkt bereits stark blockiert.
Da die Schule ohne ein deutliches (transparentes) Regelsystem nicht funktionieren kann, kommt es vor dem Hintergrund der skizzierten Gemengelage gelegentlich zu großen Krisen, die von den Schülerinnen und Schülern unterschiedlich erlebt und kompensiert werden.
Konfliktpotenziale
In diesem Kontext systemischer Verschränkungen zwischen den Lebensbereichen Schule und Familie taucht seit ca. drei Jahren das Phänomen des (religiös begründeten) Extremismus vermehrt im Unterricht und auf den Schulhöfen in Erscheinung. Er bietet sich als Kompensationsmöglichkeit an.
Die Hinwendung zu totalitären Ideologien und streng reglementierenden Milieus wird zu einem verlockenden Angebot, zumal wenn diese sich feindselig gegenüber den bisher erfahrenen Lebensbereichen (Schule, Familie) zeigen.
Nach meiner Erfahrung gilt dies vor allem für junge Menschen, die entweder aus Haushalten kommen, in denen tradierte, nicht hinterfragbare Werte und Moralvorstellungen über Generationen hinweg vermittelt wurden (häufiger Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte), oder aber, in einem scheinbaren Gegensatz dazu, aus Haushalten, in denen kaum über Werte und Moral gesprochen wird (eher Kinder aus Ein-Eltern-Haushalten). Beide Familienmuster haben gemein, dass die jungen Menschen nur mangelhaft Dialogfähigkeit erlernen konnten.[1]
Was die Radikalisierung vorantreiben kann
Schule und Eltern stehen in dem Fall vor einer weiteren Herausforderung, die die bisherigen Herausforderungen durch verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler überschattet. Oftmals verschwinden die eigentlichen Probleme und persönlichen Krisen, die zu einer Radikalisierung dieser jungen Menschen beigetragen haben, aus dem Blickwinkel der Pädagoginnen und Pädagogen.
Die Betroffenen werden nur noch (mehr) mit ihren Verhaltensweisen und ihrem äußeren Erscheinungsbild identifiziert und dementsprechend behandelt, als hätten sie keine Ressourcen ausgebildet. Ihre Lebensgeschichte vor der Konvertierung gerät aus dem Blick. Das jedoch ist eine Bestätigung für das radikale Milieu, welches eben genau danach trachtet, die Jugendlichen von ihrer Geschichte und damit von ihren sozialen Bindungen und Erfahrungen abzutrennen.
So wird der verweigerte Handschlag eines Schülers gegenüber seiner Lehrerin plötzlich medienwirksam zum Politikum stilisiert, anstatt das Ganze als Momentaufnahme seiner Entwicklung zu betrachten. Das kann den Nebeneffekt nach sich ziehen, dass der betroffene Schüler innerhalb seiner Peergroup (in diesem Fall sogenannte „Salafisten“) zum Helden wird und dieses Milieu bei manch anderen Schüler/innen eine gewisse Attraktivität erlangt.
Solche und andere Begebenheiten – wie die plötzliche Verschleierung junger Konvertitinnen – werden dann zum Anlass von Klassenkonferenzen, zu denen meine Kolleg/innen und ich gelegentlich als „Experten“ hinzugebeten werden. Nicht mit am Tisch sitzen der betroffene junge Mensch und seine Eltern. Meistens wissen diese noch nicht einmal von der Klassenkonferenz.
Das Netzwerk-Konzept
Es ist für mich weniger die Frage, ob es sinnvoll ist, Eltern oder gar andere Schülerinnen und Schüler zu so einer Konferenz hinzu zu bitten. Vielmehr geht es mir darum, solche Konferenzen – insbesondere im Zusammenhang mit beobachtbaren Radikalisierungsverläufen – insgesamt in Frage zu stellen.
Ich plädiere für soziale Netzwerke zugunsten der Betroffenen, welche sich bewusst um diese herum gruppieren. Das Netzwerk kann aus Lehrkräften und Sozialarbeiter/innen bestehen, die zu den Betroffenen eine vertrauensvolle und verbindliche Beziehung haben, und – wenn nur irgend möglich – aus Familienangehörigen sowie aus Peers (Sport-Trainer/in etc.).
Dazu ist die Kommunikation zwischen Schule und Familie auf Augenhöhe unumgänglich! Können diese Kräfte nicht eingebunden werden, dann wirken sie gegeneinander, also destruktiv, und treiben den jungen Menschen in seiner Desorientierung vor sich her. Das aber verstärkt den Radikalisierungsprozess noch weiter.
Mit dem Aufbau solcher Netzwerke kann unsere Beratungseinrichtung bereits sichtbare Erfolge nachweisen. Dabei haben sich folgende Grundsätze, die sich aus der praktischen Arbeit in sogenannten Familienklassen[2] ergeben haben, für solche Netzwerke bewährt:
- Wir zeigen den Betroffenen gegenüber, dass wir uns zuständig fühlen, wenn’s sein muss, auch gegen deren Widerstand.
- Wir lassen uns auf keinen Machtkampf ein! Es geht um die Herstellung von Dialogfähigkeit auf allen Seiten.
- Wir demonstrieren Handlungs- und Kompromissbereitschaft.
- Wir nehmen uns Zeit, aber wir bleiben am Konflikt dran.
Drümmer und Mohr beschreiben eindrucksvoll, dass eine Auswertung der Klassenkonferenzen aus dem Jahre 2010 in einer Bremer Schule ergeben hat, „dass in diesem Jahr 86 Klassenkonferenzen stattgefunden hatten mit nahezu keinen spürbaren Verhaltensverbesserungen der entsprechenden Schüler/innen. Mit den positiven Erfahrungen der Gesprächsführung in Bezug auf die Familienklassengespräche setzt seit Sommer 2011 folgende bewusste Entwicklung im Lehrerkollegium ein: ‚Weg von den Klassenkonferenzen hin zu pädagogischen Gesprächen‘, an denen alle beteiligten Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler mit den Eltern teilnehmen, um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen… Hier finden tatsächlich Gespräche auf Augenhöhe statt.“[3]
Es geht leider auch anders! Zum einen ist es immer noch so, dass in Schulen Radikalisierungsprozesse oft erst sehr spät thematisiert werden. In ihrer Verunsicherung sind Lehrkräfte und Eltern unbewusst vereint, jedoch im faktischen Erleben meist als getrennt voneinander. Sie reagieren überfordert, indem sie entweder wegschauen oder überreagieren. Oftmals, so meine Wahrnehmung, folgt das Eine auf das Andere. Oder, noch schlimmer, die einen reagieren so und die anderen so.
Feindbilder helfen nie
Die Verunsicherung im Umgang mit dem Phänomen „Radikalisierung“ wird zudem befeuert durch Experten und Expertinnen, die von einer „Generation Allah“ sprechen. Leider dienen belehrende Werke wie die des Kollegen Ahmad Mansour[4] kaum als Handlungsanleitung für betroffene Familien oder Schulpersonal.
Zudem sind Kampfbegriffe, die den religiösen Fanatikern bereits eine Hegemonie über die (migrantische?) Jugend zuschreiben, eher geeignet, Verunsicherungen zu verstärken und, im schlimmsten Fall, Spaltungen in der Gesellschaft noch zusätzlich zu befördern.
Ein in der Konsequenz repressiver Versuch, der „Generation Allah“ Einhalt zu gebieten, fand kürzlich an einem Hamburger Gymnasium statt. Dort wurden einige Schülerinnen, die zum muslimischen Glauben konvertiert sind und dies durch das Tragen von Kopftüchern demonstrierten, gemeinsam mit ihren Eltern zu einem verpflichtenden Gespräch einbestellt.
Anwesend war zudem eine muslimische Sozialarbeiterin, die außerhalb der Moschee auf das Tragen eines Kopftuches verzichtet und dem Schulpersonal als Vorbild diente. Die jungen Mädchen wurden aufgefordert, sich wegen ihrer Kleidung der Versammlung gegenüber zu rechtfertigen.
Das Ergebnis war vorauszusehen: Die Eltern stellten sich hinter ihre Töchter, und die Schülerinnen wurden bestärkt in ihrer Meinung, dass Muslime und Musliminnen ausgegrenzt würden. Die Sozialarbeiterin verlor in den Augen der Schülerinnen an Ansehen. Ansonsten hat sich am Verhalten der Schülerinnen nichts verändert, und um die Autorität der Lehrkräfte steht es vermutlich schlechter als zuvor.
Das Individuum wiederentdecken
Ich habe mit einigen betroffenen Eltern über den Vorfall gesprochen. Selbst völlig verunsichert über das Verhalten ihrer Kinder, und ganz und gar nicht einverstanden mit der Radikalisierung einiger dieser Schülerinnen, fühlen sie sich von Seiten der Schule im Stich gelassen. Niemand hatte zuvor versucht mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Böse Zungen behaupten, dass Lehrkräfte unbelehrbar seien – es sei denn, sie hätten den Eindruck, einen Experten oder eine Expertin vor sich zu haben. Ich mag keine bösen Zungen. Vielmehr glaube ich an die pädagogische Expertise der Lehrkräfte. Um sich darauf besinnen zu können, wäre es nur nötig, sich von den aufgeregten Debatten des Mainstreams ein wenig zu lösen und das bedürftige Individuum im Schüler bzw. in der Schülerin wieder zu entdecken.
[1] Siehe auch: Gerland, Michael (2016), „Auf den Kontext kommt es an - Die Verschränkungen sozialer Systeme und ihr Einfluss auf die Genese des Fanatismus“, Bei: Wissensportal der Deut. Gesellschaft für System. Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF).
[2] „Familienklassen“ sind Projekte die sich aus dem systemischen Ansatz der „Multifamilientherapie (MFT)“ entwickelt haben. Ich selbst habe so ein Projekt an einer Hamburger Schule über mehrere Durchgänge angeleitet. Siehe hierzu auch: Asen, Eia und Scholz, Michael, „Praxis der Multifamilientherapie“, Heidelberg, 2009 sowie: Behme-Matthiessen, Ulrike und Pletsch, Thomas (Hg.), „Handbuch Familienklasse – Multifamiliencoaching im Unterricht“, Aachen, 2012.
[3] Siehe, Drümmer, Doris und Mohr, Lisa in: Behme-Matthiessen / Pletsch, 2012, S. 146ff.
[4] Siehe: Ahmad Mansour, „Generation Allah. Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen“, Berlin, 2015.