Am 25. Januar jährt sich der Beginn der ägyptischen Revolution von 2011, auf die eine bis heute andauernde Konterrevolution gefolgt ist. Immer mehr politische und kulturelle Akteure landen im Gefängnis oder fliehen ins Exil. Im aktuellen Beitrag unserer Serie „Blick zurück nach vorn“ leuchtet Alia Mossallam die inneren Räume der Revolution aus, wo Angst und Mut, menschliche Größe und Monstrosität ganz nah beieinanderliegen.
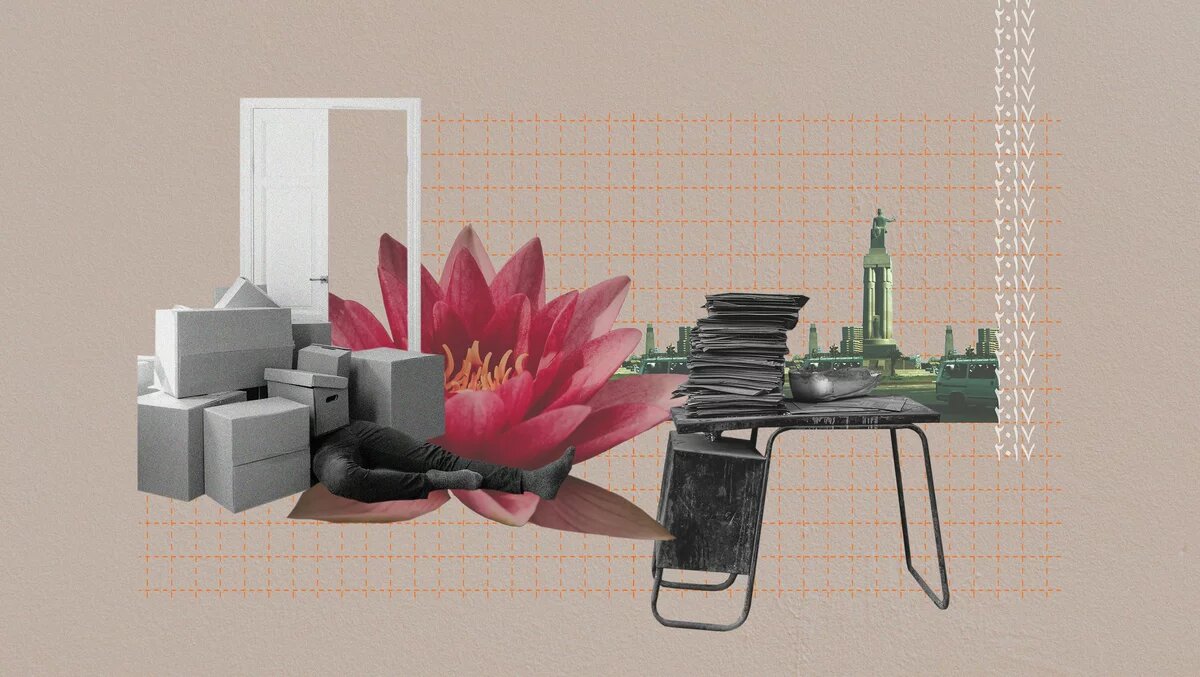
Wir waren 2017 noch nicht lange in Berlin, mein Mann und ich, als unser Freund Asef Bayat, ein Soziologe, auf den wir große Stücke halten, uns fragte, welche Pläne wir für die kommenden Jahre hätten. Wir haben keine Pläne, sagten wir und lachten. Ich hatte gerade ein zweijähriges Forschungsstipendium erhalten, das mir die Arbeit an meinem ersten Buch ermöglichte. Wir waren ursprünglich davon ausgegangen, nicht länger als ein Jahr in Deutschland zu bleiben. Bevor wir nach Berlin kamen, hatte ich sogar versucht, eine kürzere Stipendienlaufzeit zu vereinbaren. Wir wollten ein Jahr lang alles „hinter uns lassen“, mehr nicht – bis sich die Verhältnisse in Ägypten beruhigt hätten.
So erklärten wir es Asef. Er warnte uns. Er sagte, wir seien drauf und dran, in die gleiche Falle zu tappen wie er und viele andere Menschen, 1979, nach der Iranischen Revolution. Nichts schien damals von Dauer zu sein, sagte er. Man glaubte, alles würde sich zum Besseren wenden, dass man einfach nur abwarten müsse. Manche Leute, sagte Asef, leben schon seit Jahrzehnten in diesem Zustand des Vorläufigen, manche auch im Ausland, ohne je richtig angekommen zu sein, ohne sich Möbel gekauft zu haben, und manche, sagte er, warten nach wie vor darauf, dass sich die Verhältnisse ändern, damit sie endlich zurückkehren können.
Was Asef da schilderte, klang wie ein Fluch. Er hörte sich so besorgt an, als wären wir verwunschen oder als hätten wir die Augen vor der Wahrheit verschlossen. „Ihr dürft dem nicht nachgeben, das Vorläufige wird nämlich von Dauer sein“, sagte er, und dann stiegen wir in den Bus, und die Türen schlossen sich mit dramatischer Wucht.
Stillstehen
Wenn ich mir die Anfänge der Revolution in Ägypten vor Augen führe, denke ich vor allem an die Parolen, die 2011 zum ersten Mal aufkamen. In einigen Fällen erinnere mich auch noch sehr genau an den jeweiligen Moment, manchmal war es so, als entstünden sie spontan und kollektiv aus dem Moment heraus. Eine der Parolen lautete Ithbat: „Stillstehen“.
In der Nacht des 25. Januar waren wir auf dem Tahrir-Platz. Nach vielen Jahren war es uns zum ersten Mal gelungen, den Platz in großer Zahl zu besetzten, und wir beschlossen, die Nacht dort zu verbringen. Gegen Mitternacht war es ruhiger geworden, die Protestierenden machten Pläne für einen Sitzstreik, der mindestens ein paar Tage andauern sollte. Die meisten Journalist/innen und Menschenrechtsbeobachter/innen hatten den Platz bereits verlassen. Plötzlich ging die Straßenbeleuchtung aus. Dann kamen die Gummigeschosse und das Tränengas, und alle stürmten los. Wir versuchten zu fliehen, mein Mann und meine Freunde und ich, weg von dort, woher die Schüsse kamen, aber wir wussten nicht, wohin wir rannten. Sehr schnell waren wir nicht, weil wir uns untergehakt hatten, um uns nicht zu verlieren.
Dann, inmitten des Durcheinanders, erhob sich in der Ferne zaghaft eine Stimme: „Ithbath, ithbat!“ Andere stimmten mit ein, und es dauerte nicht lange, bis auch viele andere Menschen „Ithbat!“ riefen. Die Parole breitete sich über den ganzen Platz aus, bis auch ich mich traute, stehenzubleiben und mit einzustimmen. Ich hielt mir die Ohren zu und weinte vor Angst, immer wieder öffnete sich mein Mund und rief inmitten des donnernden, tausendstimmigen Chors: „ITHBAT! ITHBAT! ITHBAT!“ Das ging eine Weile so weiter, bis irgendwann alle wieder verstummt waren. Die einende Kraft der donnernden Stimmen hatte den Menschen die Kraft gegeben, Widerstand zu leisten, anstatt vor der Polizei wegzulaufen.
Das arabische Wort ithbat geht auf die Grundform thabat zurück, die unter anderem auch „Standhaftigkeit“ bedeutet, wie etwa in der Redewendung al thabaat ‘ala al-mabda, „seinen Prinzipien treu bleiben“. Wenn man etwas als thabit bezeichnet, will man damit sagen, dass es beständig, unverwüstlich ist. Und all diese Konnotationen waren in diesem Moment präsent. Als ich das Wort hörte und aussprach, setzte ich alles daran, noch die letzte Faser meines Körpers zum Stillstand zu bringen, obwohl ich große Angst hatte und instinktiv fliehen wollte. Ich hielt mir die die Ohren zu und hörte das Echo meiner Stimme, die im Chor mit den Stimmen der anderen Menschen skandierte.
In Berlin zu sein, fühlt sich manchmal so an, als wäre das Gegenteil passiert. Als hätte ich dem Impuls wegzulaufen nicht widerstehen können. Als hätte ich die Zelte abgebrochen, um mich mit meiner Familie in Sicherheit zu bringen, auf der Suche nach Glück vielleicht und um nicht die ganze Zeit von dem Gefühl verfolgt zu werden, dass ich schuld war an der „Zukunft, die nicht kam“, wie es auf einem Graffiti in Kairo heißt. Ständig habe ich das Gefühl, eine Gruppe von Menschen sich selbst überlassen zu haben, die immer kleiner wird. Sie müssen die Stellung halten und auf sich achtgeben, sie müssen kämpfen, damit wir die Räume, die wir erobert haben, nicht wieder verlieren. Indem wir das Land verlassen, einer nach dem anderen, werden diejenigen, die bleiben, immer verwundbarer.
Gebet über die Angst
2013, nach der blutigen Erstürmung des Protestlagers auf dem Rab’a-al-Adawiyya-Platz[1], schrieb der Dichter Mahmoud Ezzat ein Gedicht mit dem Titel „Gebet über die Angst“ („Salat al khuf“). Der Titel nimmt Bezug auf ein in Kriegszeiten entstandenes islamisches Gebet, das Ängste zerstreuen soll. Auf YouTube findet sich ein mehrsprachig untertiteltes Video des Mosireen-Kollektivs, in dem eine Stimme dieses Gedicht rezitiert, während Aufnahmen einiger der blutigsten Gräueltaten, die das ägyptische Militär seit 2011 begangen hat, zu sehen sind.
In dem Gedicht wird immer wieder der unbedingte und verzweifelte Wunsch geäußert, aus der „Prüfung“ – dem Kampf – hervorzugehen, ohne sich zu verlieren.
Siegen wir?
Oder lassen wir uns zur Schlachtbank führen?
Ist die Frage schändlich?
Oder ist es schlimmer zu schweigen?
Haben wir den Weg frei gemacht?
Oder ist er zerstört?
Kann Ungerechtigkeit jemals in blühende Gärten führen?
Kann Unterdrückung jemals ein Tor zur Gerechtigkeit sein?
fi ‘adl babuh al dhulm? – Kann Unterdrückung jemals ein Tor zur Gerechtigkeit sein?
fi ‘adl babuh al dhulm? – Zu welcher Gerechtigkeit gelangt man durch die Türen der Unterdrückung?
Die Frage nach Türen und Wegen stellte sich immer wieder aufs Neue. In der Nähe meiner Kairoer Wohnung hatte jemand die Worte an die Wand gesprüht: „Das Tor zu einem Ausweg ohne Risiko ist verschlossen.“ Die Worte spielen darauf an, dass die Herrschenden der arabischen Welt im Jahr 2011 die Möglichkeit hatten, zurückzutreten und zu fliehen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Flucht ohne Rechenschaft war dem Graffiti zufolge aber keine Option mehr. Die Jahre vergingen, und irgendwann mussten auch wir uns die Frage stellen, durch welche Türen wir gehen würden, denn jetzt waren auch wir gefangen. Saßen wir fest, weil wir die politischen Herrscher und ihre Institutionen mit uns eingeschlossen hatten, ohne zu ahnen, wie lang ihre Reißzähne waren und wie tief ihre Wurzeln reichten? Der Weg in die Freiheit war vielen von uns verschlossen, wir konnten nicht fliehen, und was viel wichtiger ist: Wir wussten nicht, wie wir unseren Alltag bestreiten sollten, ohne die ganze Zeit im Kampfmodus zu verharren, beschwert vom Gefühl der Niederlage und immer wieder eingeholt von dem Gefühl der Schuld, nicht stark genug gewesen zu sein, nicht ausreichend Widerstand geleistet zu haben gegen den Schrecken, der uns noch bevorstand.
Erspar uns diesen Anblick
klar wie gleißende Gebirgsluft
zwischen Blindheit und Licht
Doch sind es nur Illusionen
Bring uns unbeschadet hier raus
Die Füße auf den Schultern
Bring uns unbefleckt hier raus
Ohne Blut an den Händen
Erlöse uns von allem
Tausende von uns
Hunderte von uns
Eine von unsFühre uns wieder hinaus, nackt
Wie alles begann
Ohne Minister, ohne Gefolge
Ohne Orden an der Brust
Führe uns hinaus, unverbraucht
Wie damals, als wir auf die Straße gingen
Kinder wir alle
Ohne jede AngstErlöse uns jetzt
Erspar uns diese Prüfung
Die Schlacht macht uns Angst
Erspar uns diese Prüfung
Die Schlacht macht uns Angst
Weitergelebt zu haben, während andere Menschen getötet wurden, kann man sich nur schwer verzeihen. Und dann ist da dieses nagende Gefühl, dass das Töten hätte verhindert werden können, auch wenn man nicht weiß, wie.
Wo fängt Faschismus an? Und wie? Faschismus beschränkt sich nicht auf einen einzigen Ort, er ist expansiv, breitet sich in uns aus, macht uns alle zu Monstern, auch wenn nicht wir diejenigen gewesen sind, die bei einem der vielleicht größten Massaker in der ägyptischen Geschichte tausende von Menschen auf dem Rab’a-al-Adawiyya-Platz umgebracht haben. Während der Rest fast ausnahmslos schwieg und dabei zusah, hat das Militärregime die Anhänger der Muslimbruderschaft als seine wichtigsten Gegner ausgelöscht. Ihr Tod ist die schwarze Leere, die sich zwischen uns gefressen hat.
Im ersten Jahr der Revolution hatten wir ein klares Ziel vor Augen: das Ende des Polizeistaats – als Bedingung für soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde. 2011 hatten wir unser Ziel erreicht, aber dann scheiterte die politische Neuordnung des Landes durch den Obersten Militärrat. Alternativen zu denken, war schwierig. Jeder neue Schritt stellte das Vertrauen in die Sache auf die Probe. Fragen waren weniger riskant als Antworten, Angst war greifbarer als Mut, und nun bestand der Kampf darin, einer Vision treu zu bleiben, die größer war als alles Politische.
Im November 2011 bekam ich das Gespräch zweier Männer mit, die langsam in Richtung Mohammed-Mahmoud-Straße gingen, auf der es gerade zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden, bewaffneten Polizisten und dem Militär kam. Was hier seinen Ausgang nahm, nannte man später die „zweite Revolution“. Einer der Männer sagte: „Ich habe Angst…“ Und sein Freund antwortete: „Angst ist ganz normal.“ Und dann: „Angst und Mut schließen sich nicht aus. Im Gegenteil. Denk an Moses. Moses hatte immer Angst, aber er war auch sehr mutig. Angst und Zutrauen kommen von hier“, sagte er und schlug sich mit der Faust auf die Brust. Sein Freund lächelte. Arm in Arm gingen die beiden weiter in Richtung Mohammed-Mahmoud-Straße.
Ein Kampf, aufrechterhalten von den Sofas der Freundschaft
Du wirst erleben, wie Heimatländer zerschlagen werden,
Menschenmengen auseinandergetrieben,
und wieder einmal wird die Welt staunend dabei zusehen,
und das Leben wird weitergehen, als wäre nichts geschehen.Also komm, komm vorbeispaziert,
und bis du da bist, bis wir weitermachen,
breite ich auf unserem Wohnzimmersofa
Liebe und Süßes für dich aus.
aus dem Lied: „Al Kanaba“ („Die Couch“) von Kaharib, 2019
Erinnerung an eine Revolution – oder die Tatsache, sie überlebt zu haben – machen einem das Herz nicht ausschließlich schwer. Wenn ich mir mein Leben vor der Revolution in Erinnerung rufe (vor allem die Jahre zwischen 2000 und 2010, in denen ich politisch aktiv war), dann habe ich eine Frau vor Augen, die mutiger war, weil es sich zu lohnen und weil der Einsatz nicht allzu hoch zu sein schien. Heute bin ich verbittert, aber auch von einem Gefühl der Hoffnung erfüllt.
Zwischen 2000 und 2010 machte sich in allen Bereichen der ägyptischen Gesellschaft ein Erstarken bürgerschaftlichen Engagements bemerkbar. Die Menschen solidarisierten sich mit Palästina, traten für unabhängige Gewerkschaften ein, unterstützten die Vernetzung der Bäuerinnen und Bauern, kämpften für das Recht auf Landbesitz, wandten sich immer entschiedener gegen die Folterpraktiken in den ägyptischen Gefängnissen und den damaligen Präsidenten Hosni Mubarak.
In jenen Jahren konnte man den Eindruck gewinnen, dass die gesellschaftlichen Räume, die wir als „unsere“ Räume beanspruchten, immer größer wurden. Und in dem Moment, da auch die politische Opposition immer größer wurde, entwickelte sich ein Verständnis dafür, wer dieses „Wir“ eigentlich war. Damit einher ging ein Mehr an Solidarität, die Gemeinschaft weitete sich aus, wir begriffen, dass unsere Aufgabe als Bürgerinnen und Bürger darin bestand, über das hinauszugehen, was uns gestattet war. Wir beanspruchten die besagten Räume nicht nur, wir schufen sie erst. Die Stadt gehörte uns, und es lohnte sich, für sie zu kämpfen.
Egal, wofür wir uns einsetzten – alle, die an unserer Seite kämpften, wurden unsere Freundinnen und Freunde, und für den kurzen, aber umso größeren Moment, in dem unsere Träume Wirklichkeit wurden, wurden unsere Freund/innen unsere Familie. Ich engagierte mich nicht nur deshalb politisch, weil ich an die Möglichkeit einer anderen Welt glaubte und weil ich davon überzeugt war, dass wir diese Welt anstreben mussten und auch konnten. Ich engagierte mich deshalb, weil ich mir diese Welt zusammen mit meinen Freund/innen, meiner Familie und den Menschen, die ich liebte, erträumte, weil wir auf die Straße gingen und uns organisierten, weil wir schrieben und kreativ waren, um genau diese Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Ohne all diese Menschen um mich herum hätte ich nicht gewusst, von was für einer ich Welt ich träumen soll.
Das Wichtigste auf dieser Reise waren die Menschen. Was mich mit ihnen verband, war der Traum von einer möglichen Welt. Von einer Welt, die vielleicht zu schön war, um Wirklichkeit werden zu können. Aber wir waren naiv genug, es wenigstens zu versuchen. Was wir erlebten, hat uns für immer verändert, wie jede Gemeinschaft, wie alle Menschen, die sich an einer Revolution beteiligt haben. Die alles getan haben für die Möglichkeit einer im Glanz der Gerechtigkeit erstrahlenden Welt. Damals hat sich gezeigt, dass uns die Ungerechtigkeit überlegen ist, aber so kann und wird es nicht ewig weitergehen.
Der inhaftierte Aktivist Alaa Abdelfattah hat einen Artikel geschrieben, in dem er davon berichtet, wie er im Gefängnis eine halbe Stunde mit seinem neugeborenen Sohn Khaled verbringt. Der Text schließt mit einem Satz, in dem der Name des Jungen – Khaled heißt „ewig“ – mehrfach wiederholt wird:
„Khaled ist die Liebe, Khaled ist die Traurigkeit, Khaled ist der Platz, Khaled ist der Märtyrer, Khaled ist das Land; ihr Staat dagegen währt nur eine Stunde dieser Ewigkeit, nur eine Stunde.“
In Ägypten lebt es sich heute weitaus gefährlicherer als vor der Revolution. Folter ist allgegenwärtig, immer wieder verschwinden Menschen, die Gefängnisse sind voller junger Menschen, deren Phantasie grenzenlos ist, die einen Anspruch haben auf eine bessere Welt. Unsere Freiheiten wurden massiv beschnitten. Und trotzdem wird weitergekämpft, nicht nur auf der Straße, nicht nur gegen das Regime. Sondern auch im Widerstand gegen eine patriarchalische Gesellschaftsordnung und in dem Versuch, den hässlichen Methoden des Staats auf den Grund zu kommen, journalistisch, literarisch, künstlerisch. Vielleicht hat der Militärstaat die Regierungen der Welt auf seiner Seite, vielleicht verfügt er über Geld und Munition, Gefängnisse und ausgeklügelte Folterpraktiken. Aber wir haben Generationen von Menschen, die die Wahrheit kennen, die Wahrheit über die Schlechtigkeit dieses Staates und die unermesslichen Möglichkeiten, auf dir wir einen flüchtigen Blick erhaschen konnten – für einen kurzen Moment, der die Ewigkeit in sich trug.
Im März 2020, als ich während des ersten Corona-Lockdowns meinen Schreibtisch neu organisierte, fielen mir die Briefe eines guten Freundes in die Hände. Alaa Abdelfattah hatte mir zwischen 2014 und 2019 aus dem Gefängnis geschrieben. Im März 2019 wurde er freigelassen, nach einer fünfjährigen Haftstrafe wegen Teilnahme an einer Demonstration. Er war nur wenige Monate in Freiheit, bevor er wieder entführt und ohne nachvollziehbare Anklage inhaftiert wurde. Wenn ich seine Briefe lese, fühlt es sich so an, als würde ich mit Alaa sprechen. Seine Klugheit übersteigt den politischen Moment bei Weitem. Ein Absatz aus seinem Brief vom 24. Februar 2014 hat mich besonders beeindruckt:
Wir müssen lernen, damit aufzuhören, uns für Dinge, die uns passieren, schuldig zu fühlen, und wir müssen uns von dem Gefühl befreien, dass wir dem Schicksal ausgeliefert sind. Wenn wir akzeptieren, dass wir, so lange wir immer versuchen gut zu sein und Gutes zu tun, grundsätzlich ohne Schuld sind, und dass wir den Zug des Schicksals nicht verpassen, bloß weil wir uns einen Fehltritt leisten oder nicht pünktlich sind, dann wird unsere Fähigkeit, das Leben zu lieben, immer größer werden. Es macht mich wütend, wenn die Leute sagen: Wenn wir am 11. Februar den Tahrir-Platz nicht geräumt hätten, wäre dieses oder jenes passiert. Die Vorstellung, dass es den einen Moment, die eine Entscheidung gibt, die den Lauf der Geschichte verändert, ist ein romantischer Gedanke, einer von der übelsten Sorte, ein Gedanke, der lähmt, Schuldgefühle verursacht und Fanatismus und Intoleranz befördert. Wir werden eine weitere Möglichkeit finden, eine dritte, eine hundertste, wir werden fast unendlich viele Möglichkeiten finden müssen. Sonst wäre es kein Kampf.
Für den Augenblick sind wir besiegt, und der Augenblick gehört ihnen und ist gefährlich. Aber kein Augenblick währt ewig – der Kampf und der Sinn für die Möglichkeiten dagegen schon.
Autorin: Alia Mossallam interessiert sich als Kulturhistorikerin und Autorin für Lieder, die Geschichten erzählen, und für Geschichten über die weniger bekannten Befreiungskämpfe hinter welthistorischen Ereignissen. Derzeit ist sie EUME Postdoc-Fellow der Alexander-von-Humboldt-Stiftung zu Berlin.
Übersetzung aus dem Englischen: Gregor Runge, geb. 1981, hat unter anderem am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert. Er übersetzt seit 2007 Texte aller Art, seit 2013 auch Literatur. Er hat unter anderem E.M. Forster, Christopher Isherwood und Yrsa Daley-Ward übersetzt. Im Februar 2021 erscheint im Arche Verlag seine Übersetzung von Hilary Leichters Roman „Temporary“ (dt.: Die Hauptsache).
Kuration: Sandra Hetzl (*1980 in München) übersetzt literarische Texte aus dem Arabischen, u.a. von Rasha Abbas, Mohammad Al Attar, Kadhem Khanjar, Bushra al-Maktari, Aref Hamza, Aboud Saeed, Assaf Alassaf und Raif Badawi, und manchmal schreibt sie auch. Sie hat einen Master in Visual Culture Studies von der Universität der Künste in Berlin, ist Gründerin des Literaturkollektivs 10/11 für zeitgenössische arabische Literatur und des Mini-Literaturfestivals Downtown Spandau Medina.
Dieser Beitrag ist Teil unserer Serie „Blick zurück nach vorn“ . Anlässlich von zehn Jahren Revolution in Nordafrika und Westasien schildern die Autor/innen dabei aus verschiedensten Kontexten, was sie hoffen, wovon sie träumen, was sie sich fragen und woran sie zweifeln. In ihren literarischen Essays wird deutlich, wie wichtig die persönlichen Auseinandersetzungen sind, um politische Alternativen zu entwickeln, und was jenseits der großen Ziele erreicht wurde.
Mit dem anhaltenden Kampf gegen autoritäre Regime, für Menschenwürde und politische Reformen beschäftigen wir uns darüber hinaus in multimedialen Projekten: In unserer digitalen scroll-story „Aufgeben hat keine Zukunft“ stellen wir drei Aktivist/innen aus Ägypten, Tunesien und Syrien vor, die zeigen, dass die Revolutionen weitergehen.
[1] Rab’a al-Adawiyya ist ein Platz im Kairoer Stadtteil Nasr-City. Unterstützer/innen des ehemaligen Präsidenten Mohammed Mursi, der einen Monat zuvor durch einen Militärputsch abgesetzt worden war, hielten hier einen Sitzstreik ab. Der Sitzstreik, an dem vor allem Muslimbrüder teilnahmen, wurde am 14. August 2013 durch das Militär gewaltsam aufgelöst. Dabei kamen mindestens 1.000 Protestierende ums Leben, mehr als 2.000 wurden verletzt. Laut Human Rights Watch wurden noch nie in der Geschichte der Menschheit so viele Demonstrierende an einem einzigen Tag getötet.


