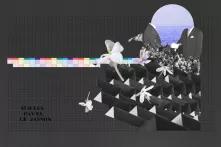In einem brillanten wie persönlichen Essay über die Geschichte der Bidoon*-Literatur zeigt Mona Kareem, warum Literatur nicht entlang nationaler Grenzen gedacht werden kann.
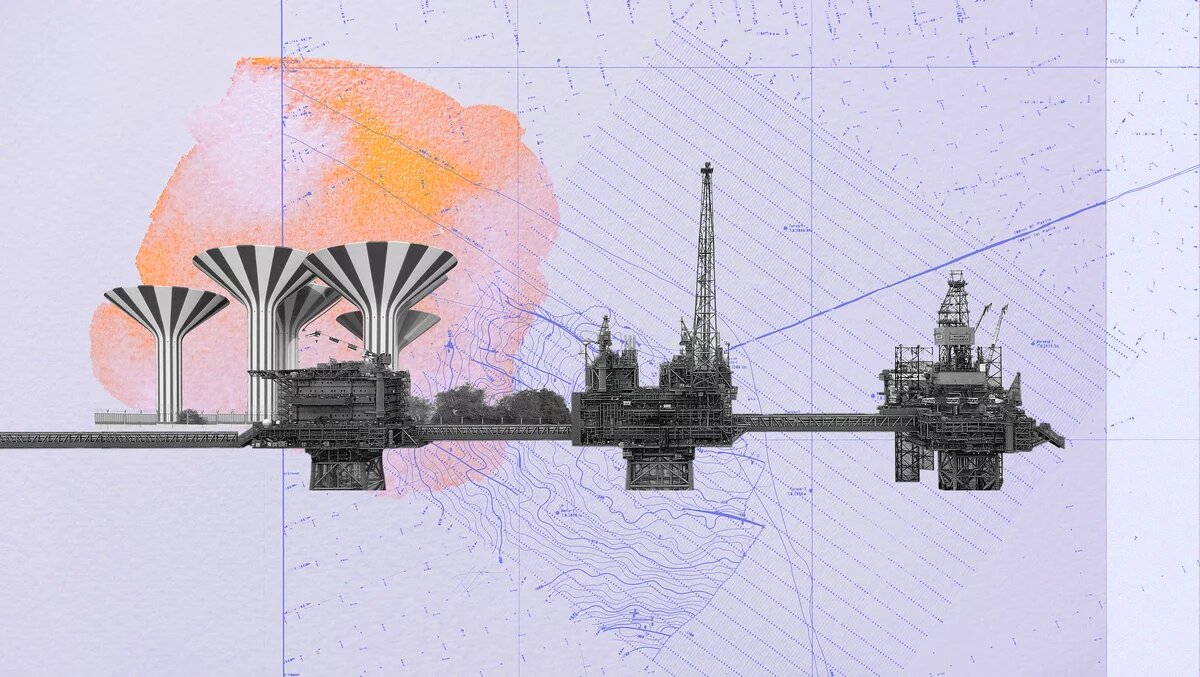
1.
Da wären wir, wieder im Exil. Weder sind wir die erste arabische Generation, die sich diesem Labyrinth überlässt, noch die letzte. Mal nennt man uns Migranten, mal sind wir Geflüchtete, mal heißen wir Randgruppen. Man lädt uns ein, vom Rand aus über den Rand zu berichten: „Na? Wie ist das Wetter bei euch so, am Rand?“ Sie stecken uns in Anthologien, die vielleicht von Stiftungsmumien gelesen werden, höchstens aber in den Ghettos der Nahost-Studien. Sie behandeln unsere Gedichte und Romane wie Belegstücke, wie Geständnisse von der dunklen Seite des Tunnels. Manchmal geht die Sache weiter, dann bemüht man einen „-“, einen Bindestrich, der eine nebulöse Brücke zwischen ihrer und unserer Identität schlagen soll: „arabisch-amerikanisch“. Doch ist diese Brücke keineswegs dazu gedacht, dass wir sie überqueren. Es ist ihnen wichtig, sie zu bewachen, und der Tag wird kommen, an dem sie einen einen Elektrozaun drüber ziehen.
Zehn Jahre lang lebe ich nun schon in den Vereinigten Staaten. Noch immer habe ich nicht die Staatsbürgerschaft, noch immer reise ich mit einem Flüchtlingspass, der nur zwölf Monate gültig ist und den zu verlängern jedes Mal drei Monate dauert, denn: Reisen ist schließlich Luxus. Man nennt mich, ohne mit der Wimper zu zucken, eine „arabisch-amerikanische“ Autorin, und ich habe keine Ahnung, wann sich diese Verwandlung meiner Einstufung von „arabische Exilautorin“zu „arabisch-amerikanische Autorin“ vollzogen haben soll. Ansonsten aber bin ich in Kuwait geboren und habe dort meine ersten einundzwanzig Jahre verbracht, und in dieser Zeit habe ich zwei Gedichtbände veröffentlicht, fünf Jahre lang für die lokale Presse geschrieben und im Grunde keinen Bereich ausgelassen, in dem ich mich nicht ausprobiert hätte: Schauspiel, Theaterkritik, Literaturübersetzung, politische Organisation, ob nun feministisch, global oder „bidoonisch“, Geige-, Laute- und Klavierspiel, und wäre meine Stimme nicht so fiepsig und ganz und gar unerträglich, ihr hättet mich wahrscheinlich in glitzernden Shopping Malls und an den verpesteten Stränden Kuwaits singen hören. Ich habe in kürzester Zeit ein Riesenleben gelebt, mit Höhen und Tiefen, und all das, ohne eine Bezeichnung oder Kategorie, die ich tragen kann.
Im Jahr 2011, als die „Bidoon“-Bewegung auf den Straßen geboren wurde, entstand auch etwas, das man „Bidoon-Literatur“ nennt. Zuvor hatten die Anthologien und Lexika zu „kuwaitischer Literatur“ unsere Existenz immer ignoriert. Anthologien, deren einziger Zweck es war, zu belegen, dass man tatsächlich über eine Literatur verfügte, ergo auch eine Nation, eine Geschichte und einen Staat. Aus dem „Verband kuwaitischer Schriftsteller“ schloss man uns aus, genauso wie aus allen gemeinnützigen Verbänden, die ja bekanntlich demokratischer sein sollten als der Staat, nur, dass sie leider noch viel übler, viel reaktionärer und rassistischer waren. Wir verbrüderten uns mit unseren migrantischen Freunden und tauschten uns aus mit Ägypter/innen, Syrer/innen, Palästinenser/innen und anderen Araber/innen, die sich ins Land des Erdöls verirrt hatten. Wir wussten, dass wir am Rand standen, am Rand des Hier und am Rand des Dort. Wir hatten keine Ahnung, wie wir aus unserem Rand etwas hätten machen können, eine alternative Geographie vielleicht, nur für uns, einen Raum, der nicht nur den „hochverehrten Bürger/innen“ vorbehalten wäre. Doch ohne die Bidoon-Bewegung hätte es die Bidoon-Literatur nie gegeben. Denn jedes politische Anliegen braucht selbstredend auch eine Literatur und eine Kultur. Schließlich muss so eine Bewegung, wie auch die Nöte einer Volksgruppe auf ihrem Weg zu einem kollektiven Ansinnen erst mal verbalisiert werden. Autor/innen-Kurzbios verschwanden in der schwammigen Zeile: „In Kuweit geboren“. Schrieb man stattdessen „Bidoon-Dichter/in“, strich der Lektor es einem wieder heraus, denn, also nein, was ist denn das, sich über eine Verneinung identifizieren!
2.
Blicken wir in der Literaturgeschichte ein wenig zurück, in die Zeit vor dem Nationalstaat, der in dieser Form als Erstes in Europa auftritt, werden wir feststellen, dass frühere Literaturen nicht anhand von Geographien sondern nach Sprachen kategorisiert wurden. Dort stößt man, im Osten wie im Westen, auf Literat/innen, die mehrsprachig schrieben, oder die zumindest neben ihrer Muttersprache noch eine andere beherrschten. Aus heutiger Sicht wirkt jene Welt fast schon mythisch – trotz der Versuche der früheren Moderne, insbesondere der surrealistischen Bewegung, auf eine Internationalisierung der Literaturwelt hinzuarbeiten. All diese Versuche haben im Nichts gemündet, und selbst die arabische Literatur, deren viele Räume einander eigentlich immer offen gestanden hatten – auch Minderheiten gegenüber, deren Angehörige auf Arabisch schreiben – selbst sie wird entlang von Staats- und Provinzgrenzen zu Fragmenten zerschreddert. Die moderne Literatur bewegt sich sogar immer weiter von einer Internationalisierung fort. Sie bewegt sich in Richtung Minderheit und Gruppe – wobei sich „Gruppe“ hier über einen einzigen Punkt definiert: ein Anliegen, das sie zusammenhält.
Bidoon-Literatur als solche gibt es aber nicht erst seit den Revolutionen und der Bidoon-Bewegung. Der erste von einem Bidoon-Autor veröffentlichte Text stammt von Sulaiman al-Falih aus den 1970er Jahren, also nach der Unabhängigkeit, die ja die Geburt der Bidoon als Gruppe zur Folge hatte. Wie es scheint, hört das Bidoon-Sein eines Menschen nicht einfach auf, wenn er irgendwo anders eingebürgert wird oder wegzieht. Später sah al-Falih sich gezwungen, nach Saudi Arabien auszuwandern, wo er lange Zeit in der dortigen Presse tätig war und auch weiter seine Texte veröffentlichte, doch während er seiner ersten Szene treu geblieben ist, blieb er der dortigen immer fremd.
In den 1990er Jahren dominierten die Bidoon die Lyrikszene Kuwaits, und da es ihnen verboten ist, an Unis zu studieren oder zu unterrichten oder im öffentlichen Dienst zu arbeiten, arbeiteten die meisten bidoonischen Lyriker/innen in der kuwaitischen Presse. Den Bidoon-Literat/innen war nicht bewusst, dass sie nur eine Untergruppe innerhalb einer migrantischen Literaturszene bilden würden, in einem Kuweit, dessen Kulturwirtschaft infolge des Golfkriegs zerfallen war. Sie hielten sich schlichtweg für Einzelpersonen am Rand, weswegen es damals auch keinen Versuch gab, von einer bidoonischen Literatur zu sprechen. Der Großteil von ihnen fand ein angenehmes Plätzchen in der Lyrik, wo das Schreiben über Identität, Zugehörigkeit und Entfremdung weniger risikobehaftet war. Einige Kritiker/innen führten das größere Interesse bidoonischer Autor/innen an Lyrik im Vergleich zu Prosa auf deren beduinische Wurzeln zurück. Eine Interpretation, die so falsch gar nicht wäre, wäre sie nur nicht so eindimensional. Die Ironie dabei ist, dass die Lyrik den Bidoon nie ein sicheres Terrain war. Immer wieder hörte man von Dichter/innen, denen die Staatssicherheit Besuche abstattete und von Entlassungen aus der kuwaitischen Presse. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür ist der Fall von Fahad Afet. Der verschwand eine Zeitlang im Gefängnis, nachdem er ein Gedicht verfasst hatte, das als Schmähgedicht über den regierenden Emir gedeutet worden war. Später tauchte er wieder auf, doch als Emigrant, erst in Saudi Arabien und dann in den Emiraten.
Mit dem Interesse neuerer kuwaitischer und westlicher Akademiker/innen an der Bidoon-Frage wurde im letzten Jahrzehnt der Begriff „Bidoon-Literatur“ häufiger verwendet. Die jüngere arabische (wie auch globale) Migrationswelle in Richtung Roman als Genre ist auch an den Bidoon-Autor/innen nicht vorüber gegangen. Nasser Al Zafiri, in den Neunzigern nach Kanada ausgewandert und vor zwei Jahren dort verstorben, veröffentlichte einen Dreiteiler mit dem Titel „Die Jahra-Trilogie“, in der er versuchte, die Siedlungsbewegung der Bidoon nachzuzeichnen, von der Wüste, in die Basthütten, hin zu den Arbeitersiedlungen, in denen sie sich außerhalb der Städte ballten und bis schließlich zu ihrem Leben in den Städten des Erdöls. Diese Geschichten changieren zwischen dem Kulturschock im Angesicht der Moderne und den Ambitionen einer Generation von Bidoon, die in einer aufstrebenden Gesellschaft aufgewachsen sind, die viel pluralistischer, viel weniger ausschließend anmutet, als es die heutige ist. Dieser Wendepunkt im Leben der Bidoon bildet ein wiederkehrendes Motiv in den Texten bidoonischer Literat/innen: Bei Al Zafiri oder seinem Zeitgenossen Kareem Alhazzaa, aber auch bei Lyrikern wie Dakhil al-Khalifa, Sulaiman Alfraih und Ahmad Al Dosari und selbst bei einem jungen Romancier wie Khaled Torki findet sich das Motiv wieder. Doch weisen diese literarischen Narrative oft in nur eine einzige Richtung. Ihr Fokus liegt auf einer Form von Zugehörigkeit, die so romantisch wie problematisch ist. Diese wird besonders in der Figur des Bidoon-Soldaten verkörpert, der 1967 im Sechstagekrieg, 1973 im Jom-Kippur-Krieg und am Besten auch noch im zweiten Golfkrieg gedient hat: als Loyalität und Patriotismus in Reinform. Dasselbe Motiv findet man auch immer wieder in den Narrativen des Staates und der herrschenden Klasse wieder. Dort allerdings wird es instrumentalisiert, um die Bidoon als gekaufte Söldner hinzustellen.
3.
Im Exil habe ich Menschen aus der Golfregion mit verschiedenen Hintergründen kennengelernt; Schriftsteller/innen mit indischen, iranischen, ägyptischen und palästinensischen Wurzeln. Manche von ihnen schreiben auf Englisch, obwohl sie im Golf geboren und aufgewachsen sind, bevor es sie irgendwann aus unterschiedlichen Gründen ins Exil verschlug. Sie bezeichnen sich dann als „Autor aus Abu Dhabi“ oder „Lyriker aus Dubai“, und manche von ihnen können nicht einmal Arabisch. Durch die Lektüre ihrer Texte, die einen völlig anderen Golf abbilden, wurde mir klar, dass anscheinend auch meine Vorstellungswelt einem nationalistischen Literaturbegriff aufgesessen ist. Es war den staatlichen Institutionen der gesamten arabischen Welt offenbar geglückt, die Idee der nationalistischen Literatur zu zementieren: Eine alleinig von Staatsbürger/innen ausnahmslos auf Arabisch geschriebene Literatur, die mit der Identität und dem Narrativ des Staates verschmolzen ist– und nicht mit der Geografie, die ja der eigentliche Inkubator jeder kreativen Handlung ist. Das System Nationalstaat wurde der arabischen Welt, beziehungsweise vermutlich sogar der ganzen „Dritten Welt“ in immer derselben Betonform übergestülpt: Willst du einen Staat erschaffen, musst du dir erst eine Folklorekultur, eine Literatur und ein lokales Trachtentum zulegen. Das liegt in der Natur der Sache, nur so kann die Lüge Realität werden. Gamal Abdel Nasser sandte seine Spezialkommittees in die gesamte Golfregion aus, wo sie ihre Maßnahmenpläne und Formate umsetzten, auf dass man sie weitergebe, Generation für Generation, und die Bürger/innen sie stolz und treuherzig bewahrten. Bei diesen aggressiven Feldzügen jedoch gab niemand den Migrant/innen, den Bidoon oder welchen Gestrandeten oder Durchziehenden auch immer die Möglichkeit, sich mit ihren kulturellen Produkten zu beteiligen. Ich bin groß geworden einem Land, in dem das Staatsfernsehen nach dem zweiten Golfkrieg die Namen palästinensischer und irakischer Künstler/innen regelmäßig aus dem Abspann von Serien oder TV-Programmen schnitt. Ganze Filmszenen „aus deren heimischer Kultur“ wurden zensiert – waren sie doch das Werk oder die Repräsentation des neuen Feindes. Kassetten von Kazem Al Saher und Yas Khidr reichte man sich unter dem Tisch herum, als handle es sich um Haschisch oder Alkohol. Nach der Besatzung des Iraks im Jahr 2003 wurde an kuwaitischen Nationalfeiertagen plötzlich anders gefeiert. Autos drängten sich die Strandpromenade entlang, aus den Autoradios wummerten irakische Lieder in voller Lautstärke. Gott, das war der Inbegriff von Freiheit: irakische Lieder auf offener Straße hören.
Über das fünfbändige Romanwerk „Salzstädte“[1] von Abdalrachman Munif schrieb der indische Autor Amitav Ghosh einen brillanten Essay mit dem Titel „Petrofiction“, in dem er das Projekt der Literatur in der Golfregion komplett auseinandernimmt. Ghosh schildert, dass die Literatur zu keiner Zeit und an keinem Ort wirklich gewusst hat, wie sie mit der Entdeckung des Erdöls umzugehen habe. Denn jenen Rohstoff zu extrahieren, der das Gleichgewicht der Weltmächte ein für alle Mal umgewuchtet hat, erfolgt an abseitigen Orten, Orten, die außerhalb des Blickfeldes der Menschheit liegen. Der Rohstoff selbst wird auf fiktiven Märkten vertrieben, über die wir nichts wissen, außer den Kurs in den Börsennachrichten. Ghosh führt aus, dass Munifs „Salzstädte“ womöglich der einzige Versuch sind, dieses monströse Aufeinandertreffen von Erdöl und Mensch literarisch zu begreifen, zumal es sich im äußerst schroffen Terrain des Golfs vollzieht, einer Region, in der die Geschichte ihre normalen Entwicklungsphasen vom Feudalismus zur industriellen Revolution einfach übersprungen hat, um schnurstracks in den Erdölkapitalismus überzugehen. In Munifs Roman wird deutlich, wie sich der Golf von einer Geografie kleiner, zwischen den beiden Ufern der Wüste und des Meers verstreut lebender Gemeinschaften hin zu Staaten und Städten verwandelt hat. Städte, die schneller wachsen, als die Lungen der Geschichte aufzunehmen vermögen. Wann immer man die Seiten eines Romans über den Golf aufschlägt, fällt auf, wie immens, wie dunkel, wie schweigend der Abgrund des Erdöls, der Moderne klafft. Jedes literarische Werk springt direkt von Beschreibungen ländlicher Idylle in die Problematiken und Ansprüche des modernen Lebens. Was aber geschieht mit dieser Leerstelle, mit diesem Ökosystem, das mittendrin verloren geht: Dass die Wüste gestern noch dein Wohnzimmer war und du einen Tag später Gefangener eines Betonklotzes bist? Gar nichts. Ghosh spricht von Munifs klugem Zug im ersten Teil des Fünfteilers, in dem er diese stutzig machende Unvereinbarkeit aufgreift – durch die natürlich diejenigen, die die Region zu einem Spielplatz für die Amerikaner gemacht haben, ein leichtes Spiel hatten. Dann jedoch attestiert Ghosh dem Autor das Scheitern, im zweiten Teil: Hier nämlich knickt Munif punktgenau vor der Dichotomie „Staatsbürger/innen –Neuankömmling“ ein, wobei Letztere, die ja per se erstmal Paria sind, als Teil des Systems dastehen, die den Bürger/innen über das Projekt des Erdöls das Land und die Freiheit stehlen sollen. Womöglich steht Munifs Scheitern hier exemplarisch für das Scheitern der gesamten Literatur der Golfregion bis heute. Darin, das historisch dominante Narrativ zu erschüttern, über das Gegensatzpaar Bürger/innen – Andere hinwegzukommen und sich von der Lüge der nationalistischen Literatur zu befreien, die in Wahrheit weder vor, noch nach der Entdeckung des Erdöls dienlich war, um Kulturgüter zu erschaffen.
Heute sehe ich die „Bidoon-Literatur“ als Chance, gegen den Strom zu schreiben. Zumal wir nun einmal in dieser Dreiecksbeziehung feststecken: Erdöl, Nationalstaat, Leerstelle in der Geschichte. Dass Autor/innen das Schreiben immer wieder auf eine Aufgabe der reinen Repräsentation reduzieren, auf das „eine Stimme geben“, wird uns nicht weiterbringen. Und zwar weder in Bezug auf den Wunsch nach Anerkennung von Minderheitenliteratur, noch wenn es darum geht, die nationalistische Literatur in ihren Grundfesten erschüttern. Die Bidoon können – und diese Chance teilen sie mit den Migrant/innen – die Vorstellungskraft wider die Narrative der Dominanzkultur öffnen. Sie können die Begegnung zwischen Erdöl und Mensch neu ergründen und dadurch die Beziehung zwischen Mensch und Ort freilegen. Heute strebe ich nicht nach einem Bindestrich, den ich mir zwischen zwei Identitäten klemmen kann. Einfach, weil ich nicht daran glaube, dass dieses Interpunktionszeichen einen Ort für Romane schaffen wird, wie die von Ibrahim Abdel Meguid, Sonallah Ibrahim, Ghassan Kanafani, Mohammad Assaad, Huzama Habayeb, Yachya Yachluf, Walid Abu Baker, Ahmad Zein und all den anderen arabischen, südasiatischen, afrikanischen Autor/innen, die in der Golfregion gelebt oder über sie geschrieben haben, die Reihe ist endlos. Ich aber weiß, ich könnte diese Wände auseinandernehmen, hinter denen sich die nationalistische Literatur verschanzt. Inklusive derjenigen, die von diesen Räumen profitieren. Selbst wenn ich nur mit einem Löffel bewaffnet wäre.
Autorin: Mona Kareem ist eine bilinguale Lyrikerin, Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin. Sie lebt in New York. Sie hat drei Lyrikbände veröffentlicht und drei Monographien übersetzt.
Übersetzung aus dem Arabischen & Kuration: Sandra Hetzl (*1980 in München) übersetzt literarische Texte aus dem Arabischen, u.a. von Rasha Abbas, Mohammad Al Attar, Kadhem Khanjar, Bushra al-Maktari, Aref Hamza, Aboud Saeed, Assaf Alassaf und Raif Badawi, und manchmal schreibt sie auch. Sie hat einen Master in Visual Culture Studies von der Universität der Künste in Berlin, ist Gründerin des Literaturkollektivs 10/11 für zeitgenössische arabische Literatur und des Mini-Literaturfestivals Downtown Spandau Medina.
Dieser Beitrag ist Teil unserer Serie „Blick zurück nach vorn“ . Anlässlich von zehn Jahren Revolution in Nordafrika und Westasien schildern die Autor/innen dabei aus verschiedensten Kontexten, was sie hoffen, wovon sie träumen, was sie sich fragen und woran sie zweifeln. In ihren literarischen Essays wird deutlich, wie wichtig die persönlichen Auseinandersetzungen sind, um politische Alternativen zu entwickeln, und was jenseits der großen Ziele erreicht wurde.
Mit dem anhaltenden Kampf gegen autoritäre Regime, für Menschenwürde und politische Reformen beschäftigen wir uns darüber hinaus in multimedialen Projekten: In unserer digitalen scroll-story „Aufgeben hat keine Zukunft“ stellen wir drei Aktivist/innen aus Ägypten, Tunesien und Syrien vor, die zeigen, dass die Revolutionen weitergehen.
*Bidoon sind staatenlose Menschen im arabischen Golf. Wörtlich bedeutet es „ohne“, rührt aber vom arabischen bidūn dschinsiyya, also „ohne Staatsangehörigkeit“ her. Der Begriff bezeichnet vor allem Staatenlose in Kuwait. Die ersten Bidoon waren Araber, die um die Zeit der Unabhängigkeit des Landes einen temporären Status bekommen haben, der ihnen dann für Generationen anhaftete. Der Bidoonstatus wird vererbt. Praktisch bedeutet dies, dass man keine amtlichen Papiere bekommt, weder Zugang zu Sozialhilfe hat, noch zu Grundrechten wie staatliche Anstellung, juristische Vertretung, Wohnung, Gesundheitswesen und Bildung.
[1] Abdalrachman Munifs (1933-2004) Pentalogie „Salzstädte“ erschien im Zeitraum der Jahre von 1984 und 1989. In der deutschen Übersetzung von Magda Barakat und Larissa Bender erschienen die ersten drei Teile im Heyne Verlag.