Deutschland riskiert nicht nur Menschenleben, sondern auch seine Glaubwürdigkeit als internationaler Partner. Zehn Jahre nach „Wir schaffen das“ hat sich die öffentliche Debatte dramatisch verändert.
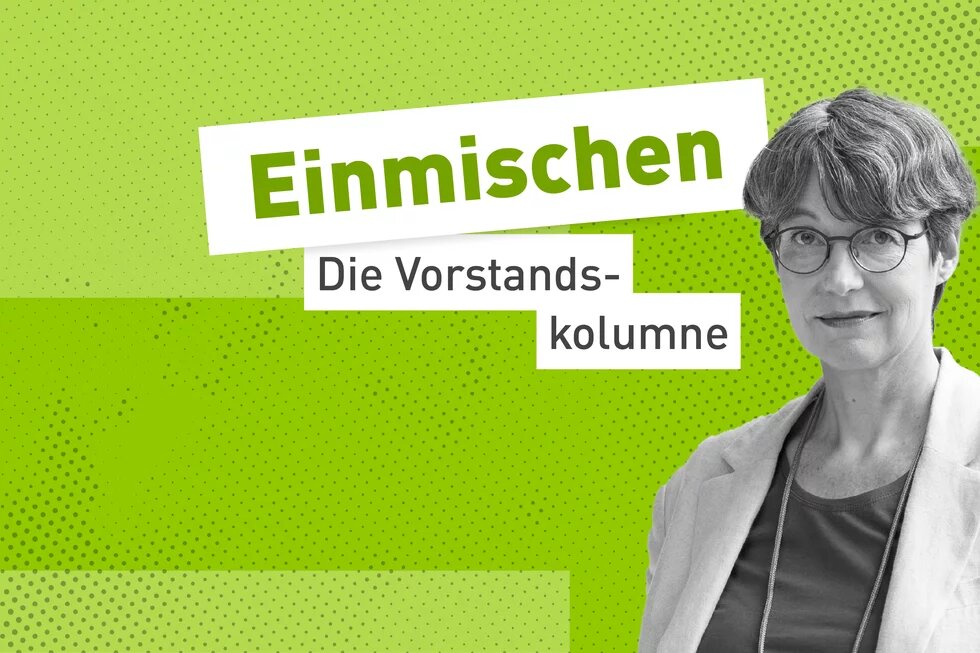
Die gegenwärtige Koalition hat sich für einen harten Kurs in der Migrationspolitik entschieden und kürzlich die humanitären Aufnahmeprogramme der Bundesregierung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Aussetzung betrifft die Paragraphen 22 und 23 des Aufenthaltsgesetzes.
Diese Politik hat reale Kosten: für Menschenleben, für demokratische Normen und für Deutschlands Stellung in der Welt. Besonders deutlich wird dies in der aktuellen politischen Debatte um ehemalige lokale Mitarbeiter*innen aus Afghanistan. Nach der Machtübernahme durch die Taliban im Jahr 2021 versprach die Bundesregierung, ehemalige Ortskräfte aufzunehmen. Diese Menschen hatten sich für die Demokratie engagiert, sie hatten für die Bundesregierung gearbeitet oder in Organisationen, die von Deutschland unterstützt worden waren. Viele von ihnen sitzen in Pakistan fest, ihnen wurde eine Einreise nach Deutschland versprochen, doch stattdessen befürchten sie Inhaftierung und Abschiebung zurück in das von den Taliban kontrollierte Afghanistan. Dort droht ihnen im schlimmsten Fall der Tod.
Der harte Kurs der Regierung
Die Erfahrungen in Afghanistan haben gezeigt, dass Ortskräfte entscheidend waren für den Erfolg von Sicherheitsoperationen, Entwicklungsprojekten, humanitärer Hilfe und wirtschaftlichen Unternehmungen. Sie verdienen daher höchsten Respekt und Anerkennung. Deutschland schuldet ihnen auch Loyalität und vor allem den notwendigen Schutz.
Pro Asyl und das Partnernetzwerk Ortskräfte halten die Aussetzung der Schutzzusagen für rechtswidrig und haben Klage gegen die Bundesminister Wadephul und Dobrindt eingereicht. Wenn Deutschland seiner Verantwortung nicht nachkommt, hat dies schwerwiegende Folgen: auf menschlicher Ebene für diejenigen in Pakistan, die auf ihre Ausreise warten. Und auf politischer Ebene, weil Deutschland Gefahr läuft, seine Glaubwürdigkeit als demokratischer Akteur zu untergraben, und das in einer Zeit, in der angesichts multidimensionaler Krisen ein starkes Engagement für Demokratie und Menschenrechte besonders wichtig ist.
Nach ihrem Amtsantritt im Mai hat die Koalition zügig eine Reihe von Maßnahmen zur „Eindämmung der Migration” beschlossen. Das Aufnahmeprogramm für schutzbedürftige Afghanen wurde beendet, Pushbacks an den deutschen Grenzen eingeführt, die Familienzusammenführung für Menschen mit subsidiärem Schutzstatus wurde ebenso vorübergehend ausgesetzt wie die Teilnahme Deutschlands am UN-Flüchtlingsaufnahmeprogramm. - Verbindliche Versprechen wurden gebrochen.
Humanitäre Visa wurden eingefroren
Auch das humanitäre Visa-Programm gemäß § 22 Aufenthaltsgesetz wurde stillschweigend eingestellt. Bisher ermöglichte dieses Programm, in Ausnahmefällen akut gefährdete Menschen aufzunehmen, wenn dies im politischen Interesse Deutschlands liegt. Für einige der schutzbedürftigsten Menschen der Welt – politische Dissident*innen, Menschenrechtsverteidiger*innen und diejenigen, die unmittelbar von Verfolgung bedroht sind – war es die Rettung. Seit Juli sind dieses und andere Programme eingefroren, Neuanträge werden nicht mehr angenommen. Für die Betroffenen sind die Folgen verheerend.
Nicht nur Afghan*innen haben keinen Schutz
Russische Dissidenten und belarussische Menschenrechtsverteidiger, die einst humanitäre Visa für Deutschland erhielten und ihre Arbeit aus dem Exil fortsetzen konnten, stehen nun allein da. Menschenrechtsorganisationen haben bereits über Fälle berichtet, in denen Aktivisten Repressalien ausgesetzt waren, weil sie in Berlin nicht mehr willkommen sind. Mit Entscheidungen wie dieser verliert Deutschland seinen Einfluss und seine Glaubwürdigkeit. Das Programm war von Anfang an bescheiden angelegt, die Anträge unterlagen einem strengen Prüfverfahren und wurden nur in Ausnahmefällen bewilligt, die ausdrücklich im politischen Interesse Deutschlands lagen. Bis zum 31. Dezember 2024 profitierten lediglich 37.103 Personen von der Regelung, und zwar überwiegend Afghanen, die nach der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 geflohen waren.
Während die Bundesregierung die Aufnahmeprogramme überprüft, verstößt sie gegen internationales und europäisches Recht. Im Fall von drei somalischen Geflüchteten, die an der deutsch-polnischen Grenze abgewiesen wurden, ignorierte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) eine Berliner Gerichtsentscheidung, die diese Zurückweisungen für rechtswidrig erklärte. In einem anderen Fall wurde Flüchtlingen in Kenia, die im Rahmen des UNHCR-Programms eine Genehmigung für die Aufnahme in Deutschland erhalten hatten, das Visum verweigert und sie wurden zurück in das Flüchtlingslager Kakuma geschickt.
Kosten für die Außenpolitik
Die Entscheidung der Bundesregierung, diese Programme auszusetzen, hat nicht nur Konsequenzen für die betroffenen Menschen, sondern auch für die internationale Integrität und das Ansehen Deutschlands. Eine Einschränkung der humanitären Zugänge wird die Zahl der Asylanträge nicht wesentlich reduzieren. Aber sie sendet eine deutliche Botschaft an die Verbündeten und Gegner Berlins. Repressiven Regierungen signalisiert sie, dass Berlin für eine Zusammenarbeit offen ist. Bereits jetzt sind die Taliban ein unangenehmer Partner für Berlin, der die Regierung bei der Koordinierung von Abschiebungen unterstützt, während Afghanen, die mit deutschen Organisationen zusammengearbeitet haben, jenseits der Grenze in Pakistan zurückgelassen werden. Demokratieaktivisten und Menschenrechtsverteidigern wird signalisiert, dass sie nicht mit Schutz in Deutschland rechnen können. Zumindest hat juristischer und diplomatischer Druck die Koalition jedoch bereits dazu gezwungen, ihre harte Haltung aufzugeben und die Einreise schutzbedürftiger Afghanen teilweise wieder zuzulassen. Dies ist konzertierten Aktionen der Zivilgesellschaft und einer starken Oppositionspolitik zu verdanken. Verfolgten Menschen zu helfen, ist nicht nur eine humanitäre Geste, sondern vor allem Ausdruck des deutschen Interesses daran, diejenigen zu unterstützen, die vor Ort für Rechte und Demokratie kämpfen, in einer Zeit, in der demokratische Akteure weltweit mehr denn je gefordert sind.
