Frieden zu sichern ist keine Utopie, sondern eine realpolitische Notwendigkeit. Globale Sicherheit erfordert Kooperation, Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung. Dafür muss Europa seine Resilienz stärken.
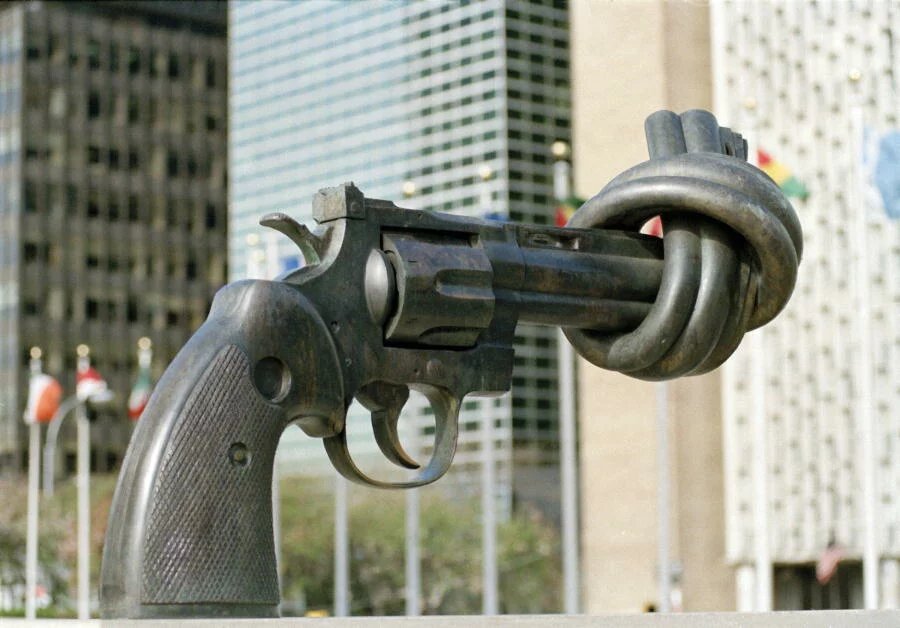
Dieser Text basiert auf einer Rede, die Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesumweltminister sowie früherer außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, im Rahmen der 25. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung im September 2025 gehalten hat.
25 Jahre Einstehen für eine wertebasierte Außenpolitik
Seit 25 Jahren diskutiert die Heinrich-Böll-Stiftung einmal im Jahr die Lage der Welt. Das tat sie immer in besonderer Weise. Auf den Außenpolitischen Jahrestagungen ging es immer um eine wertebasierte Außenpolitik auf der Basis von Demokratie und Menschenrechten. Um eine Politik im Wissen um die planetaren Grenzen der einen Welt für das Leben dieser und künftiger Generationen. Hier wurde der Sicherheitsbegriff nie auf das rein militärische eingeengt - aber auch die Notwendigkeit des Militärs als Ultima Ratio nicht bestritten. Wertebasierter Außenpolitik wird gerne Idealismus unterstellt. Jüngst behauptete Deutschlands Großhistoriker Herfried Münkler, das Völkerrecht sei etwas für „das Feuilleton“. Hier wurde das immer anders gesehen.
Dieses Jahr lautet das Thema der Jahrestagung „Reclaiming Peace - Peace and Security in a Fragmented World“. Wie naiv ist das denn angesichts der Kriege in der Ukraine, in Gaza, im Sudan – so könnte man fragen. Aber: Frieden zu sichern ist nicht naiv. Es ist eine realpolitische Notwendigkeit. Nicht nur, weil die Menschen in der Ukraine, in Gaza wie in Israel oder im Sudan sich danach sehnen. Sondern weil unser aller Sicherheit, die Zukunft des Planeten Erde von einem nachhaltigen Frieden abhängt.
Realpolitik Reloaded
Eine wertegeleitete Realpolitik muss sich gerade vor dem Hintergrund der genannten Kriege nicht verstecken. Im Gegenteil. Gerade Russlands imperialistischer Krieg gegen die Ukraine belegt das Scheitern der traditionellen realpolitischen Schule.
Das liegt weniger am vermeintlichen Widerspruch zwischen Werten und Interessen. Im Zweifel beriefen sich auch knallharte Realpolitiker auf Werte, um ihre Interessen durchzusetzen. Man denke nur an den Kampf der USA gegen den Kommunismus in Vietnam oder Lateinamerika. Oder daran, wie sich Russlands Wagner-Söldner in Mali oder Burkina Faso zu Kämpfern gegen einen westlichen Kolonialismus stilisieren. Umgekehrt haben die Vertreter einer wertebasierten Außenpolitik sehr wohl die Interessen von Mächten wie von Unternehmen kritisch im Blick.
Innen und Außen gleichzeitig betrachten
Die Schwäche der tradierten realpolitischen Schule ist ihre Blindheit für die Dynamik in Gesellschaften. Sie ist fast ausschließlich auf das Handeln staatlicher Akteure fixiert und blendet die Zivilgesellschaft aus. Und so hat die traditionelle Realpolitik eines übersehen: In einer Welt globalisierter Krisen schwindet die Grenze zwischen Außen- und Innenpolitik. Kein Land kann der Klimakrise allein entkommen. Und kein Land kann sie alleine lösen. Sie zu begrenzen, bedarf der globalen Kooperation und grundlegender Transformation in den einzelnen Ländern. Die Finanzkrise von 2008 wie die Coronapandemie haben die Grenzen einer ungeregelten Globalisierung gezeigt. Sie haben aber auch die Notwendigkeit globaler Kooperation zur Bewältigung solcher Krisen unterstrichen.
Doch mit der Legitimation von Herrschaft im Innern verändert sich die Politik nach außen. Europas alte Realpolitiker haben nicht gesehen, dass ein Putin, der mit einem inszenierten Ausnahmezustand an die Macht kam, kein Stabilitätsfaktor war, nur weil er das Jelzin-Chaos beendete. Der Ausnahmezustand verlangt nach Eskalation, nach innen wie nach außen. Deshalb waren CDU wie SPD so überrascht vom Ukraine-Krieg. Selbst der große Henry Kissinger war lange blind gegenüber Putin.
Grüne dagegen hatten schon lange vor Putin gewarnt. Sie wussten aus ihrer Zusammenarbeit mit Russlands oppositioneller Zivilgesellschaft, was von Putin zu erwarten ist. Grüne waren keine Idealisten, sondern die besseren Realpolitiker.
Kissingers Verhandlungspartner Deng Xiaoping hatte noch den Verzicht Chinas auf alle Großmachtallüren verlangt. Das Narrativ der KP Chinas hat sich aber seit Deng verändert. Chinas Wohlstandsversprechen wird nun mit Nationalismus unterlegt. Unter Xi Jinping heißt es heute: Mao hat China befreit, Deng hat es reich gemacht. Xi macht China stark. Chinas Machtprojektion ist nach wie vor eine stark ökonomische - etwa mit der Belt and Road Initiative. Chinas Nachbarn, die Philippinen, Vietnam, aber auch Indien, haben zuletzt schlechte Erfahrungen mit der neuen chinesischen Großmachtpolitik unter Xi gemacht.
Inneren und Äußeren Frieden verhandeln
Doch in Folge von Finanz-, Corona- und Klimakrise ist paradoxerweise nicht globale Kooperation das Gebot der Stunde. Sondern es dominiert global der Rückzug ins Nationale. Weltweit sind rechte, nationalistische Bewegungen auf dem Vormarsch. Selbst dem Mutterland der Demokratie – den USA – droht ein Systembruch hin zu einer autoritären Oligarchie.
Alle Autokraten von Putin über Orban bis Trump eint die Abneigung von Gewaltenteilung. Sie hassen eine unabhängige Justiz. Sie behaupten, weil sie eine Mehrheit hätten, stünden sie über dem Gesetz. Das hat globale Folgen.
Denn: Wer im eigenen Land die Herrschaft des Rechts zerstört, setzt auch nach außen auf die Macht des Stärkeren. Und umgekehrt. Eine dauerhafte Verletzung des Völkerrechts höhlt auch die Demokratie nach innen aus – wie wir in Israel beobachten können. Wir sehen: Autoritäre Herrschaft und nachhaltiger Frieden gehen schlecht zusammen.
Eine neue Ordnung steht bevor
Wir erleben eine Disruption des internationalen Systems. Die Welt ist auf dem Weg zu einer neuen multipolaren Ordnung. Vor 35 Jahren glaubten viele, mit der Implosion des Warschauer Pakts sei der Siegeszug des demokratischen Kapitalismus unaufhaltsam geworden. Das am „Ende der Geschichte“ (Francis Fukuyama) prophezeite unilaterale Zeitalter der USA ging jedoch in seinen Kriegen im Irak, in Afghanistan und in Libyen unter.
Die USA hatten sich als globale Ordnungsmacht übernommen.
Das Ende des Westens
Der Westen verlor seine politische und ökonomische Dominanz – und ist dabei, auch seine militärische Dominanz zu verlieren. Der Westen ist kein positiver und erst recht kein unschuldiger Begriff. Demokratien sind kein Garant für Frieden. Der Kolonialismus Englands wie Frankreichs wurde in parlamentarischen Demokratien organisiert. Die Kriege der USA von Vietnam über Grenada bis zum Irak wurden von demokratisch gewählten US-Präsidenten begonnen.
Die Dominanz des Westens beruhte nicht auf seinen Werten – eher auf seinem Verrat an ihnen. Seine Dominanz beruhte auf seiner „Überlegenheit bei der Anwendung von organisierter Gewalt“ (Fukuyama). Europäer mögen das vergessen. Der Globale Süden tut dies nicht.
Heute ist der Westen an einem Ende angekommen. Im Irak und in Afghanistan wurde die Überdehnung der USA als globale Ordnungsmacht offensichtlich. Donald Trump hat daraus Konsequenzen gezogen. Wenn die USA nicht mehr globale Ordnungsmacht sein können, dann wollen sie es auch nicht länger sein. Statt auf eine globale Ordnung setzt Trump auf die Erpressung der Schwachen und das Arrangement mit den Starken. Trumps Ordnung gehorcht dem Muster der Aufteilung von Revieren zwischen Mafiabanden.
Wer sind Europas Rivalen?
In Europa verschärft sich der Konflikt zwischen der demokratischen Europäischen Union und dem Imperialismus eines revisionistischen Russlands. Dass dabei die USA weiter auf der Seite Europas stehen werden, ist mehr als zweifelhaft geworden.
Es gibt eine globale systemische Rivalität zwischen den Staaten des demokratischen Kapitalismus und dem autoritären Staatskapitalismus Chinas. Aktuell droht in den USA ein autoritärer Oligarchismus zu entstehen. Es wäre ein neuer systemischer Rivalefür ein demokratisches Europa – nicht länger Freund und Partner.
Wenn Demokratien zu Autokratien werden, hat das außenpolitische Folgen.
Frieden schaffen in einer multipolaren Welt
Die neue Ordnung verschärft bestehende Probleme. Weltweit werden die Mittel zum Kampf gegen Armut und Hunger gekürzt, während die Militärausgaben steigen. Das atomare Wettrüsten weitet sich aus. Eine Reihe von Kriegen - vom Kongo über den Sudan bis zu Gaza und der Ukraine – drohen zu endlosen Kriegen zu werden. Die globale Governance in den Institutionen der Vereinten Nationen ist massiv geschwächt.
Im Ergebnis droht eine internationale Ordnung, in der Imperien ihre Einflusssphären gewaltsam durchsetzen. Es wäre eine Ordnung, die mehr Ähnlichkeit mit der Welt vor dem Ersten als mit der nach dem Zweiten Weltkrieg hat. Diese neue Ordnung ist das Gegenteil von nachhaltigem Frieden.
Europas Hausaufgaben
Will Europa ein handlungsfähiger Pol in einer multipolaren Welt werden, muss es seine Resilienz stärken.
Die neue multipolare Welt stellt Europa vor neue Herausforderungen. Zuerst muss es die Frage beantworten, ob es überhaupt ein globaler Pol sein will.
Wer selbst kein Pol ist, wird sich einem der anderen Pole unterwerfen müssen.
Zur Wahl stehen hier aktuell die USA, Russland oder China. Sich einem davon zu unterwerfen, ist nicht in Europas Interesse.
Resilienz stärken
Will Europa ein handlungsfähiger Pol in einer multipolaren Welt werden, muss es seine Resilienz stärken. Das gilt militärisch, ökonomisch und politisch. Soll Krieg von Europa ferngehalten werden, muss es in seine Abschreckung investieren. Seine Fähigkeiten zur Flugabwehr, zur Nutzung und Abwehr von Drohnen – all dies sind nur die ersten Stichpunkte auf der langen Liste des Nachholens.
Die dafür nötige Industrie muss europäisch sein. Europa kann nicht länger dort shoppen gehen, von wo aus Grönland und Kanada bedroht werden. Das gilt auch für die eigene kritische Infrastruktur – sei es bei Satelliten, Clouddiensten oder Künstlicher Intelligenz. Sie dürfen nicht länger dem Zugriff der NSA ausgesetzt sein. Und auch nicht von chinesischen Monopolen auf seltene Ressourcen.
Solche Resilienz ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt bei anderen Akteuren die Bereitschaft und das Interesse entsteht, mit Europa über Rüstungskontrolle oder gar Rüstungsbegrenzungzu verhandeln. Resilienz geht über das militärische hinaus. Strategische Industrien in Europa zu sichern, ist die Lehre aus den gebrochenen Wertschöpfungsketten. Industrielle Resilienz hat seinen Preis.
Europa darf nicht länger von fossilen Energien abhängen. Trump hat vor der UN-Generalversammlung mehr von seinen Wünschen und Ängsten als von der Realität gesprochen, als er Deutschland die Rückkehr zur Atomenergie und zu Öl und Gas andichtete. Im letzten Jahr gingen weltweit 585 Gigawatt erneuerbarer Stromerzeugung ans Netz. Das waren 92,5 Prozent aller neuen Kapazitäten. Fossile und nukleare Anlagen teilten sich eine Nische von 7,5 Prozent.
Die Hälfte der 585 GW gingen in China ans Netz. Das hat zwei Gründe. Erneuerbare sind konkurrenzlos billig. Und China will sich seine Energiekosten nicht länger von den USA vorschreiben lassen. Das gleiche Interesse hat Europa. Europa hat kein Interesse, sich von den Monopolen Chinas über Seltene Erden erpressen zu lassen. Deshalb muss Europa seine Rohstoffstrategie diversifizieren und mehr Kreislaufwirtschaft organisieren.
Resilienz bedeutet, den Ausbau Erneuerbarer Energien zu beschleunigen statt zu bremsen.
In der Energiepolitik aber liegen Chinas und Europas Interessen nah beieinander. Die Interessen der USA und Russlands stehen dem diametral entgegen. Trump wie Putin sehen ihre Verfügung über fossile Energien als Mittel ihrer Machtpolitik.
Resilienz bedeutet, den Ausbau Erneuerbarer Energien zu beschleunigen statt zu bremsen.
Europa muss Handlungsfähigkeit behalten
In der multipolaren Welt gibt es – allem nationalistischen Geschrei zum Trotz – weniger nationale Souveränität. Gewicht haben nicht Irland oder Italien, Polen oder Frankreich. Auch Deutschland nicht. Gewicht hat nur Europa. Deshalb muss die Handlungsfähigkeit Europas gestärkt werden. Das gilt für alle Akteure.
Dann darf nicht erneut Deutschland wegen seiner Autoindustrie auf einen Zolldeal mit Donald Trump drängen, der am Ende 0:15 und bei Stahl und Aluminium 0:50 gegen Europa ausgeht.
Appeasement hilft nicht gegen Autokraten
Dann haben beim Handelsabkommen der EU mit dem Mercosur die Interessen der französischen Rinderzüchter hinter dem Interesse eines strategischen Bündnisses der EU mit den Demokratien Lateinamerikas zurück zu stehen. Auch den Grünen im Europaparlament sei das gesagt.
Dann darf Deutschland nicht länger eine europäische Nahostpolitik mit dem Ziel eines gerechten Friedens blockieren. Deutschlands dröhnendes Schweigen, sein folgenloses Appellieren ist angesichts der Kriegsverbrechen und ethnischen Säuberungen in Gaza und der Westbank nicht nur ein moralisches Versagen. Der Krieg der Regierung Netanjahu, Smotrich und Ben-Gvir gegen die Palästinenser ist durch das Massaker vom 7. Oktober nicht zu rechtfertigen. Er muss beendet werden. Eine Politik der Kriegsbeendigung aber wird in der EU von Deutschland blockiert.
Meine Partei, Bündnis 90/Die Grünen, versteht sich als Friedenspartei, als Partei der Menschenrechte. Sie schweigt zu Deutschlands Blockade europäischer Friedenspolitik. Das ist bitter. Zudem ist es strategisch dumm. Wer global die Herrschaft des Rechts erhalten will, darf nicht doppelte Standards praktizieren.
Das Völkerrecht gilt universal – in der Ukraine wie in Gaza.
Strategische Allianzen sind elementar
Wer nachhaltig Frieden schaffen will, muss die Herrschaft des Rechts gegen das Recht des Stärkeren durchsetzen. Das geht in der multipolaren Welt nur in ebenso pragmatischen wie strategischen Allianzen, die gemeinsame Interessen nutzen – und die Werte nicht negieren.
Europa investiert viel darin, damit die Ukraine nicht von Putin überrannt wird. Es ist in unserem ureigenen Interesse. Gerade führen der brasilianische Präsident Lula und Indiens Präsident Modi vor, wie man sich von Trump nicht erpressen lässt. Wenn sich Europa, Indien, Brasilien und China gemeinsam seinem Zollkrieg widersetzen, kann es gelingen, der US-Oligarchie Grenzen zu setzen. Wenn wir die Zusammenarbeit mit Südkorea, Vietnam und Japan stärken, ist dies ein starkes Signal gegen die Machtansprüche Chinas in Asien.
Eine wertebasierte Realpolitik ist Grundlage für nachhaltigen Frieden in der multipolaren Welt.


