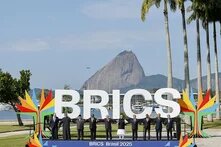Südostasien zieht eine gemischte Bilanz, wenn es um die Förderung von Gewaltlosigkeit als Weg zu staatlicher und menschlicher Sicherheit geht. Das Prinzip der Nichteinmischung hat der ASEAN zwar geholfen, den Frieden zwischen ihren Mitgliedsstaaten zu bewahren – bei innerstaatlichen Konflikten blieb die Gemeinschaft jedoch weitgehend untätig.
Das Papier untersucht anhand von Beispielen aus der Mekong-Region und darüber hinaus, wie Gewaltlosigkeit in inneren und zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen verstanden und praktiziert wird. Es fragt, ob die ASEAN ihr Verständnis von Gewaltfreiheit erweitern sollte – etwa durch stärkere Institutionen und eine klarere Orientierung an Demokratie und gemeinschaftlichen Interessen.
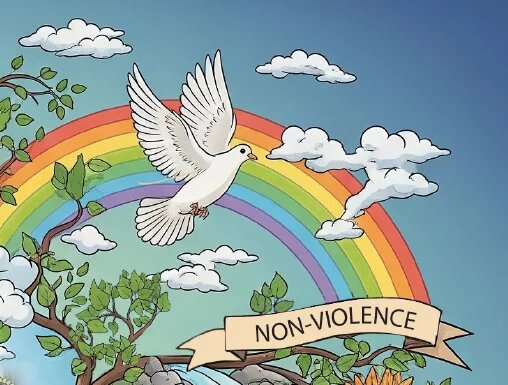
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Die Bilanz Südostasiens bei der Verbreitung des Konzepts der Gewaltfreiheit zur Gewährleistung staatlicher und menschlicher Sicherheit gestaltet sich uneinheitlich.
- Um die staatliche Sicherheit und regionale Stabilität zu gewährleisten, hat Südostasien um Konflikte einzudämmen und zu entschärfen eine Reihe gewaltfreier Mittel eingesetzt, darunter ASEAN-Normen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Multilateralismus. Obwohl diese Elemente nicht perfekt sind, haben sie zu einer Kultur des Friedens und Kooperation in der Region beigetragen. Angesichts der erneuten Spannungen zwischen Thailand und Kambodscha gilt es für ASEAN jedoch möglicherweise ihre Rolle zu überdenken.
- Das Bekenntnis der ASEAN zum Prinzip der Nicht-Einmischung hat die Organisation weitgehend daran gehindert, sich an der Lösung interner Konflikte zu beteiligen. Infolgedessen entscheiden die einzelnen Staaten nach eigenem Ermessen, ob sie bei innerstaatlichen Konflikten Gewalt oder demokratische Maßnahmen anwenden. Der Einsatz militärischer Mittel wiederspricht dem Konzept der Gewaltfreiheit.
Zusammenfassung
Die Welt steht vor wachsenden Herausforderungen, die durch verschärfte geopolitische Spannungen gekennzeichnet sind, die sich vor dem Hintergrund einer geschwächten Weltordnung abspielen. Während immer neue Probleme auftauchen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass die alten Probleme geringer werden. Der Krieg in Gaza tobt, während mehrere Versuche einer friedlichen Lösung den anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bisher nicht beenden konnten. Unterdessen hat die Instabilität in anderen Regionen, wie beispielsweise Afrika, zu weitreichender Zerstörung und Massenvertreibungen geführt, insbesondere im Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo und im Sudan. Während Südostasien als relativ friedliche Region gilt, hält der weitreichende Konflikt in Myanmar an, und ein langjähriger Grenzstreit zwischen Thailand und Kambodscha ist erneut entflammt. Angesichts der Turbulenzen in der Weltpolitik wird eine gewaltfreie Konflikttransformation für die Entschärfung der aktuellen Spannungen immer wichtiger.
Die Studie “When Non-Violence Fails: The Challenges of Resolving Conflicts in Southeast Asia” untersucht die Anwendung des Konzepts der Gewaltfreiheit in den innerstaatlichen und internationalen Konflikten Südostasiens. Unter „Gewaltfreiheit“ schließt sich die Autorin der Definition der Global Greens Charter an, die in 2001 verabschiedet und kürzlich im Jahr 2023 aktualisiert wurde, und deren Ziel es ist, „eine Kultur des Friedens und der Zusammenarbeit zwischen Staaten, innerhalb von Gesellschaften und zwischen Individuen als Grundlage für globale Sicherheit“ zu schaffen. Das Verständnis von globaler Sicherheit geht dabei über eine enge Definition von staatlicher Sicherheit und der Stärkung der Militärmacht hinaus. Stattdessen legt die Charter Wert auf „die Verfolgung einer allgemeinen und vollständigen Abrüstung, einschließlich internationaler Abkommen zur Gewährleistung eines vollständigen und endgültigen Verbots von nuklearen, biologischen und chemischen Waffen, Antipersonenminen und Waffen mit abgereichertem Uran“ sowie „einen strengen Verhaltenskodex für Waffenexporte in Länder, in denen Menschenrechte verletzt werden“. Im Hinblick auf den Schutz der individuellen Sicherheit berücksichtigt die Charter die „sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen, psychologischen und kulturellen Aspekte von Konflikten“. Dazu gehören „die Achtung anderer Kulturen, die Beseitigung von Rassismus, die Förderung von Freiheit und Demokratie“ sowie die Stärkung multilateraler Strukturen, darunter die Vereinten Nationen, sowie regionaler Strukturen, darunter die Europäische Union, die Afrikanische Union und die Association of Southeast Asian Nations oder ASEAN, um nur einige zu nennen. Insgesamt zielt Gewaltfreiheit darauf ab, sowohl die staatliche als auch die menschliche Sicherheit durch friedliche und demokratische Mittel wie die Achtung der Gleichheit, die friedliche Beilegung von Konflikten und Zusammenarbeit zu gewährleisten. Während die Förderung von Gewaltfreiheit oft in internationalen Abkommen und Institutionen festgeschrieben ist, kann ihre nachhaltige Praxis im Laufe der Zeit zu einem Habitus oder einer Kultur des Friedens und der Demokratie werden.
Im Vergleich zu anderen Regionen hat es in Südostasien seit dem Ende des Kalten Krieges keinen Krieg zwischen zwei oder mehr Staaten gegeben. Zwar gibt es nach wie vor einige Konflikte, die gelegentlich zu begrenzten militärischen Auseinandersetzungen führen, wie beispielsweise zwischen Thailand und Myanmar im Jahr 2001 und zwischen Thailand und Kambodscha im Jahr 2011, doch konnten diese Vorfälle durch diplomatische Kanäle rasch entschärft werden und eskalierten nicht zu einem umfassenden Krieg. Einige würden argumentieren, dass ein Teil dieses Erfolgs auf die Rolle der ASEAN bei der Förderung von Frieden und Zusammenarbeit durch inklusive multilaterale Rahmenwerke zurückzuführen ist, die Partner außerhalb der Region, gemeinsame Entwicklung und Verhandlungen einbeziehen. Ebenso wichtig sind die Normen der ASEAN, wie beispielsweise der Grundsatz der Nicht-Einmischung, eine von den ASEAN-Mitgliedstaaten hochgeschätzte sicherheitspolitische und diplomatische Praxis, die die ASEAN-Mitglieder davon abgehalten hat, einen anderen Mitgliedstaat zu kritisieren oder militärisch zu intervenieren. Zwar haben diese Normen und Institutionen insgesamt wohl eine gewisse „Kultur des Friedens und der Zusammenarbeit” geschaffen, doch wurde dies weitgehend durch Konfliktvermeidung und nicht durch echte Problemlösung erreicht. Infolgedessen bleiben Probleme bestehen, und Streitigkeiten werden unter den Teppich gekehrt. Die erneuten Spannungen zwischen Thailand und Kambodscha, die im Mai und erneut Ende Juli 2025 zu militärischen Zusammenstößen führten, verdeutlichen die Fragilität dieses Ansatzes.
Obwohl ASEAN für die Aufrechterhaltung des Friedens zwischen ihren Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung ist, hat sie praktisch keine Rolle bei der Entschärfung innerstaatlicher Spannungen übernommen. Der Hauptgrund dafür ist das Prinzip der Nicht-Einmischung, das – obwohl es ironischerweise zur regionalen Stabilität und zur Entschärfung zwischenstaatlicher Konflikte beiträgt – den Mitgliedstaaten auch freie Hand lässt, die ihrer Meinung nach am besten geeigneten Maßnahmen zur Bewältigung innerstaatlicher Konflikte zu ergreifen. Infolgedessen wurden in einigen Fällen die Rechte von Minderheiten geschützt, während die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit in verschiedenen Phasen der Friedenskonsolidierung, wie Vermittlung und Friedenssicherung, zur friedlichen Beilegung langwieriger Konflikte beigetragen hat. Beispiele hierfür sind die Unterstützung der Friedensüberwachung in Aceh im Jahr 2005, sowie die Rolle Malaysias bei der Vermittlung im Friedensprozess in Mindanao und in den südlichen Grenzprovinzen Thailands. Ohne klare Verfahren zur Bewältigung innerstaatlicher Konflikte im Einklang mit demokratischen Werten haben einige ASEAN-Länder jedoch auf militärische oder gewaltsame Mittel zurückgegriffen, um Unruhen zu unterdrücken, und dabei häufig gegen die ASEAN-Charter und die Genfer Konventionen verstoßen. Während die Menschen in Myanmar weiterhin in Angst und Unsicherheit leben, und die ASEAN machtlos bleibt, die Vereinbarungen des Fünf-Punkte-Konsens (5PC) umzusetzen, steht die ASEAN vor einer klaren Entscheidung: weiterhin Regime zu unterstützen, die wenig Rücksicht auf Menschenleben nehmen, oder tatsächlich ihrer eigenen Verpflichtung zum Aufbau einer menschenzentrierten Gemeinschaft nachzukommen. Während die erste Option ASEAN allmählich in Bedeutungslosigkeit verschwinden lassen würde, käme die zweite Option zweifellos ihre Führungsrolle, zentralen Stellung, Widerstandsfähigkeit und Stärkung ihrer Glaubwürdigkeit nach.
Ist es an der Zeit, dass die ASEAN überdenkt, wie sie Gewaltfreiheit fördert?
Die Studie “When Non-Violence Fails: The Challenges of Resolving Conflicts in Southeast Asia“ diskutiert eine ausführliche Antwort auf diese Frage.
Die Studie ist Teil der Serie Southeast Asian Perspectives on the Six Principles of the Global Greens – A Regional Dialogue E-paper Series des Regionalbüros für Südostasien der Heinrich-Böll-Stiftung.
Autoren*innen aus Südostasien reflektieren über die sechs Grundprinzipien der Global Greens zusammengefasst in der Global Greens Charter vor dem Hintergrund Südostasiens. Die Serie will zu einem erweiterten Verständnis der sechs Prinzipien, Ökologische Weisheit, Soziale Gerechtigkeit, Partizipative Demokratie, Gewaltfreiheit, Respekt für Vielfalt in der südostasiatischen Region beitragen. Darüber hinaus tragen südostasiatische Perspektiven bei zu neuen globalpolitischen grünen Ansätzen und Praktiken auf die Herausforderungen und Krisen unserer Gegenwart.
|
Regional Dialogue E-Paper Series When Non-Violence Fails:The Challenges of Resolving Conflicts in Southeast Asia Chanintira na Thalang |