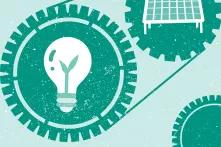Der European Green Deal kann nur dann zu einer echten Erfolgsgeschichte werden, wenn die EU im wahrsten Sinne des Wortes als europäisches Mehrebenensystem funktioniert und die verschiedenen Ebenen gut ineinander verzahnt agieren.

Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf unsere Wirtschaft, Gesellschaft und Demokratie sind enorm. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen werden überall tiefgreifende Folgen haben, wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Für den europäischen Zusammenhalt kommt es deshalb darauf an, gemeinsam gut durch und aus der Krise zu kommen. Erstmalig hat die Europäische Union ein milliardenschweres Programm für den wirtschaftlichen Wiederaufbau aufgelegt, das zu einem Teil aus Zuschüssen besteht und zum anderen an zukunftsweisende Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung geknüpft ist. Damit hebt es sich von den Not-Krediten ab, die während der Schuldenkrise in den 2010er Jahren mit schmerzhaften Sparauflagen verbunden waren.
Den wirtschaftlichen Wiederaufbau in der EU sozial gerecht und ökologisch nachhaltig zu gestalten ist auch eine Frage der Handlungsfähigkeit der EU. Die sozial-ökologische Transformation ist eine Jahrhundertaufgabe. Der Wiederaufbaufonds der EU „Next Generation EU“ ist eine gute Ausgangsbasis für diesen gemeinsamen Pfad. Um unsere Infrastruktur klimagerecht zu modernisieren und allen eine Zukunftsperspektive zu geben, sind nachhaltige Investitionen notwendig. Damit kann der Recovery Fund dem von der EU vereinbarten European Green Deal einen Schub nach vorne verleihen. Er gehört zu den Prioritäten der Europäischen Kommission und ist auch eine Reaktion auf die Europawahl 2019. Die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die EU, Klimaschutz und soziale Absicherung voranzutreiben, sind hoch.
Die Texte im unserem Dossier machen deutlich, dass der European Deal nur dann zu einer echten Erfolgsgeschichte werden kann, wenn die EU im wahrsten Sinne des Wortes als europäisches Mehrebenensystem funktioniert und die verschiedenen Ebenen gut ineinander verzahnt agieren.
Die europäische Ebene muss alle Ausgaben konsequenter an Nachhaltigkeit knüpfen
Die EU muss dafür sorgen, dass Schritt für Schritt alle Ausgaben aus den EU-Fonds an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft werden. Mit seinen Quoten für Investitionen in Klima und digitale Infrastruktur geht der Wiederaufbaufonds einen ersten wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Dies muss allerdings weiter ausgebaut werden und für alle Investitionen gültig sein. Ein angemessener Nachhaltigsbegriff darf zudem im Sinne der sozial-ökologischen Transformation die soziale Komponente nicht ignorieren – dies ist von zentraler Bedeutung vor allem für die europäischen Regionen, die durch die Pandemie und den damit verbundenen Strukturwandel am meisten betroffen oder durch Armut und soziale Spaltung betroffen sind. Der European Green Deal muss als Gesellschaftspakt verstanden werden, der durch das Zusammendenken aller Politikfelder das unverrückbare Ziel hat, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa zu stärken.
Die nationale Ebene muss ambitionierte Pläne vorlegen
Die Nationalstaaten wiederum sind gefragt, ihre nationalen Pläne zügig und ambitioniert aufzusetzen. Sie sollten dabei dem Kriterium Klimaschutz höchste Priorität einräumen und freiwillig über die bisher angesetzten Quoten (37 Prozent Klima und 20 Prozent Digitalisierung) hinausgehen. Dass die Instrumente des Wiederaufbaufonds vom Prinzip her funktionieren und neue Dynamiken auslösen können, zeigt das Beispiel Polen, das in diesem Zusammenhang den Ausstieg aus der Kohle bis 2050 angekündigt hat.
Die bislang bei der Europäischen Kommission eingereichten nationale Pläne lassen dennoch viel Luft nach oben offen. So etwa plant die deutsche Regierung, so scheint es, alten Wein in neue Fässer zu füllen, indem sie nun Maßnahmen aus dem im letzten Jahr eigens beschlossenen Klimapaket über Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds finanzieren möchte. Dies wäre eine verpasste Chance zusätzliche Investitionen zu tätigen, um die Energiewende und die Digitalisierung in Deutschland schneller voranzutreiben. Diese abwartende Position von wichtigen Mitgliedstaaten kostet jedoch wertvolle Zeit im Kampf gegen die zunehmend eskalierende Klimakrise. Um das erklärte Ziel der EU zu erreichen, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, müssen die Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung des European Green Deals noch deutlich entschlossener vorgehen.
Die Europäische Kommission hat nun die Aufgabe, die Nachhaltigkeit der nationalen Pläne kritisch zu prüfen und die Umsetzung der Pläne streng zu überwachen. Sie darf hier nicht beide Augen zudrücken.
Lokale zivilgesellschaftliche Initiativen als Träger der Transformation fördern
Neue Hoffnungsträgerinnen sind vieler Orts die Kommunen. Initiativen auf lokaler Ebene machen schon jetzt in vielen Bereichen einen Unterschied und gelten als mögliche Treiberinnen der sozial-ökologischen Transformation. Damit die Umsetzung des European Green Deals vor Ort gut funktioniert ist auch das Zusammenspiel zwischen Kommunen und lokalen, zivilgesellschaftlichen Akteur*innen gefragt. Lokale Initiativen – von Zero Waste über Wandel im städtischen und ländlichen Raum bis hin zu von Energiegenossenschaften – entfalten eine enorme transformative Kraft und verdienen größte Wertschätzung und Förderung von Seiten der kommunalen Verwaltung. Dieses zivilgesellschaftliche Handeln bildet nicht nur einen sozial-ökologischen Wert, sondern auch einen demokratiepolitischen, denn es erfüllt die Demokratie-Praxis vor Ort mit Leben und macht Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger erlebbar.
Eine gelungener European Green Deal wird zu einer Erfolgsgeschichte der EU
Damit das Geld aus den EU-Fonds vor Ort ankommt und nachhaltig eingesetzt wird, ist die lokale Ebene auf das gute Zusammenspiel mit ihren nationalen Regierungen angewiesen. Nur so verzahnt und im Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen im Mehrebenensystem der EU kann der European Green Deal zu einer Erfolgsgeschichte werden. Es ist ein gemeinsamer Kraftakt. Gelingt er, wird er eine der bedeutsamsten Erfolgsgeschichten der EU. Eine gelungene sozial-ökologische Transformation würde bei den Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik allgemein und insbesondere der EU (wieder) stärken. Deutschland als bevölkerungsreichstes und wirtschaftsstärkstes Land wird eine zentrale Rolle bei diesem Kraftakt spielen müssen. Die Handlungsfähigkeit der EU hängt auch künftig wesentlich vom Handlungswillen Deutschlands ab. Die im Herbst neu gewählte deutsche Bundesregierung wird deshalb eine herausragend aktive Rolle übernehmen müssen.