Vertrauen in staatliche Institutionen ist zentral für Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Anstatt die Herausforderungen einer vielfältigen Migrationsgesellschaft faktenwidrig zur Frage der inneren Sicherheit zu stilisieren, sollten wir gezielt in unser Gemeinwesen investieren – für ein starkes, solidarisches Miteinander.
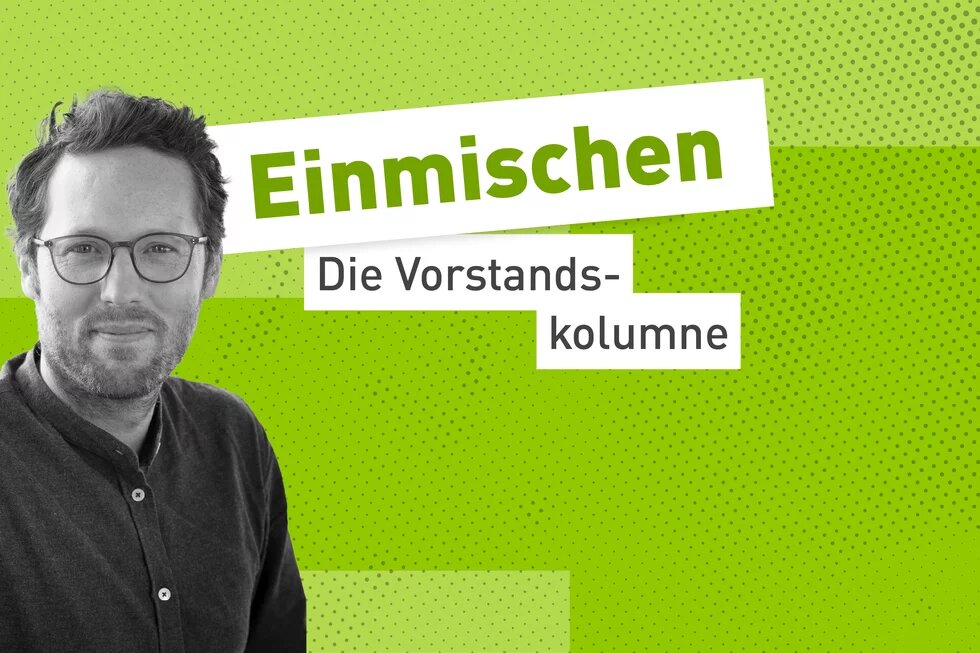
Mit seiner Aussage, das Stadtbild in Deutschland müsse sich durch eine härtere Migrationspolitik ändern, hat Bundeskanzler Friedrich Merz erneut eine Debatte eröffnet, die an den eigentlichen Aufgaben der Politik vorbeigeht. Nicht die Vielfalt der Menschen, die in diesem Land leben, ist ein Problem für die Sicherheit seiner Bevölkerung. Vielmehr erleben viele Menschen, dass kommunale Institutionen ihre zentralen Aufgaben nicht mehr erfüllen können.
Eine zerfallende Infrastruktur, zahlreiche unbesetzte Stellen und ein hoher Krankenstand in der öffentlichen Verwaltung, fehlendes Personal in Schulen, Kitas und Krankenhäusern oder geschlossene Jugendeinrichtungen: Das Vertrauen der Menschen in die Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen und in die positive Wirkung demokratischer Entscheidungen ist vielerorts beschädigt.
Dabei ist dieses Vertrauen ein zentraler Baustein für ein Leben in Sicherheit. Soziale und familiäre Konflikte, mangelnde Kommunikation mit und zwischen den Behörden, eine schlechte Ausstattung sowie eine marode Infrastruktur sind zentrale Ursachen von Unsicherheit. Sie schaffen ein Umfeld, in dem Grenzüberschreitungen und Kriminalität sichtbar werden.
Angst vor einer Erosion des gesellschaftlichen Miteinanders
Viele Menschen beobachten dieses Phänomen und haben zu Recht Angst vor einer massiven Erosion des gesellschaftlichen Miteinanders. Sie wünschen sich und ihren Angehörigen Schutz vor diesen Umständen. Doch die ehrliche Antwort auf dieses Bedürfnis lautet: Sicherheit entsteht, wenn alle Menschen über ausreichende Freiheit und Selbstbestimmung verfügen. Das zeigen auch die zahlreichen Erfolge, die unsere Demokratien etwa in Form von niedrigen Kriminalitätsraten in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben.
Gleichzeitig werden diese nun häufig infrage gestellt, da die wahrgenommene Realität von Kriminalität und Gewalt geradezu überwältigend scheint. Angeblich sollen migrantische Tatverdächtige dabei eine besondere Rolle spielen. Ein Blick auf die Daten und Fakten zeigt jedoch schnell ein anderes Bild. Weder gibt es eine besonders starke Zunahme von Straftaten, noch kann klar nachgewiesen werden, dass Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit per se häufiger kriminell werden. Schließlich leben sie statistisch häufiger in sozial angespannten und urbanen Umgebungen – also Kontexten, in denen die Kriminalitätsrate pro Kopf ohnehin erhöht ist. Vielmehr scheint es wichtiger zu sein, dass heute – insbesondere in den sozialen Medien – deutlich unmittelbarer und häufiger über Straftaten und Kriminalität berichtet wird und dabei migrantische Täter*innen besonders im Fokus stehen.
Die tatsächlichen Lücken der inneren Sicherheit angehen
Trotz dieser verzerrten Wahrnehmung stellt das Sicherheitsgefühl der Menschen im Land einen ganz entscheidenden Gradmesser für den Zustand des Gemeinwohls dar. Vielen Menschen ist bewusst, dass ein würdeloser Alltag für Teile der Gesellschaft, die tiefe Spaltung zwischen Arm und Reich, eine Krise der mentalen Gesundheit, fehlende Orte des gesellschaftlichen Miteinanders sowie unzureichende Bildungsarbeit bei Kindern und Jugendlichen – übrigens nicht nur in Kita und Schule, sondern auch im Elternhaus und im sozialen Umfeld – ein massives Problem für die Sicherheit in ihrem Land darstellen.
Und dass die tatsächlichen Lücken der inneren Sicherheit endlich ins Zentrum der Debatte gehören: Schlecht ausgestattete Polizei- und Justizbehörden, die über die Kommunen, Bundes- und EU-Länder und erst recht im digitalisierten internationalen Raum noch immer nur sehr bruchstückhaft und träge zusammenwirken. Hier ist jetzt dringender denn je entschlossenes politisches Handeln gefragt. Nebelkerzen zum Stadtbild verschleiern die echten Herausforderungen nur.
