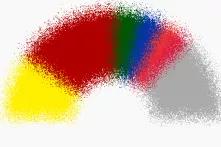Angela Merkel spricht sich gegen amerikanische Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Auch in den USA ist das Thema umstritten – gleichzeitig gilt es, in Washington Einigkeit zu beweisen. Ein Kommentar zum diplomatischen Seiltanz.
Normalerweise ist der Besuch der deutschen Kanzlerin in Washington D.C. ein politischer Spaziergang. Nicht so in diesen Tagen. Viel wurde im Vorfeld geschrieben über die drohende Belastung der transatlantischen Beziehungen angesichts möglicher Waffenlieferungen der USA an die Ukraine. Der Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die bei der Münchener Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende Waffenlieferungen kategorisch ausgeschlossen hatte, glich daher einem diplomatischen Balanceakt.
Die meisten Politiker/innen auf beiden Seiten des Atlantiks sind sich einig, dass der Krieg in der Ukraine zu einer Kernfrage der europäischen Friedensarchitektur geworden ist. Die Entwicklung dieser Krise hat eine maßgebliche Bedeutung nicht nur für die Menschen im Donbass, sondern auch für die Zukunft der EU, der politischen Beziehungen zwischen EU und USA, und der transatlantischen Sicherheitsallianz im Kontext der NATO.
In Washington steigt dieser Tage das Bewusstsein dafür, dass die Vision eines „Europe whole and free“ nicht nur in die Geschichtsbücher, sondern auf die aktuelle politische Tagesordnung gehört. Vielen Europäern wiederum ist klar geworden, dass eine enge sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit den amerikanischen Partnern auch zwei Jahrzehnte nach den Balkankriegen eine Notwendigkeit bleibt.
Vorstoß ohne die USA
Die Münchener Sicherheitskonferenz und die Bilder des kopfschüttelnden John McCain bei der Rede der Bundeskanzlerin haben aber auch die Fragilität der transatlantischen Einigkeit verdeutlicht: Der Vorstoß von Merkel und Hollande, eine neue Friedensinitiative ohne direkte US-amerikanische Beteiligung ins Leben zu rufen, wird in Washington hinter vorgehaltender Hand als Vertrauensbruch gewertet. Eine transatlantische Bündniskrise droht sich zugleich an der Frage von US-Waffenlieferungen an die Ukraine zu entzünden.
Bisher hat die transatlantische Gemeinschaft ein bemerkenswertes Maß an Einigkeit im Vorgehen zur Ukraine-Krise bewiesen. Drei zentrale Pfeiler bildeten dabei den Kern der transatlantischen Antwort auf Putins Annexion der Krim und die militärische Aufrüstung der ukrainischen „Separatisten“: Koordinierte Finanz- und Wirtschaftssanktionen gegen den inneren Machtzirkel des Kreml; dringend notwendige finanzielle Hilfe für die ukrainische Regierung; und die Bemühung um eine diplomatische Lösung mit den Rebellen und ihren Unterstützern im Kreml.
Die Aushöhlung des Minsker Abkommens, die dramatische Verschlechterung der Sicherheitslage im Osten der Ukraine und die schwindende Hoffnung auf eine baldige diplomatische Lösung des Konflikts hat jedoch zusätzlich die Frage von defensiven Waffenlieferungen an die Ukraine auf die politische Agenda in den USA katapultiert. Die Debatte wurde durch einen gemeinsamen Bericht von acht parteiübergreifenden Expert/innen und politischen Schwergewichten angefacht, der vom Atlantic Council und der Brookings Institution herausgegeben wurde.
Keine militärische Lösung der Krise
Eine Stilisierung dieser Debatte in skeptische Europäer und risikofreudige Amerikaner greift jedoch zu kurz. In der Frage der defensiven Waffenlieferungen gibt es anerkannte Stimmen und relevante Argumente auf beiden Seiten der Debatte und des Atlantiks.
Einigkeit herrscht darüber, dass die Ukraine-Krise nicht militärisch zu lösen ist. Vielmehr geht es im Kern der Auseinandersetzung darum, welche Mittel die Chance auf eine ernsthafte politische Lösung erhöhen. Die Schlüsse, die daraus gezogen werden, fallen unterschiedlich aus – gemein ist jedoch das Interesse, den Krieg in der Ukraine einzuhegen, die Souveränität des Landes zu gewährleisten, zivile Opfer zu minimieren und zu einer erstzunehmenden Verhandlungslösung mit Putin zu kommen.
Die Befürworter von defensiven Waffenlieferungen argumentieren, dass wirtschaftliche Sanktionen allein die Kalkulation des Kremls nicht hinreichend beeinflussten, um einen Kurswechsel zu bewirken. Eine Unterstützung der ukrainischen Armee mit panzerbrechenden Waffen, so die Hoffnung der Befürworter, würde dagegen den Preis für eine weitere Eskalation erheblich in die Höhe treiben und zudem der moralischen Verpflichtung vor dem Hintergrund des Rechts der Ukraine auf Selbstverteidigung nachkommen.
Es geht ihnen nicht um den Anspruch, die ukrainische Armee soweit aufzurüsten, dass sie der russischen Armee ebenbürtig oder gar überlegen wäre. Auch redet niemand von der Stationierung amerikanischer Bodentruppen in der Ukraine. Vielmehr wollen sie den Preis Putins für eine weitere militärische Eskalation soweit erhöhen, dass er diese als innenpolitisch zu kostspielig betrachten würde.
Debatten quer durch alle Lager
Diese Argumentation wird in den USA nicht nur von „Hardlinern“ oder außenpolitischen Falken vorgebracht. Zu den Befürwortern defensiver Waffenlieferungen gehört unter anderem der Präsident der renommierten Brookings Institution Strobe Talbott, der ehemalige US Botschafter in der Ukraine Steven Pifer, und der Direktor des Eurasian Centers des Atlantic Councils, John Herbst. Die Debatte entspannt sich keineswegs entlang der üblichen parteipolitischen Trennlinien, sondern verläuft quer durch das außenpolitische Establishment.
Die Gegenposition wird von nicht minder prominenten Expertinnen und Experten vertreten. Dazu gehören unter anderem die international anerkannte Putin-Biographin und Russland-Kennerin Fiona Hill, ebenfalls bei der Brookings Institution und ihr Kollege Jeremy Shapiro, der vor seiner Zeit bei Brookings im Planungsstab des Außenministeriums für Europa zuständig war.
Sie bezweifeln, dass sich Putins Kalkulation durch einen höheren Blutzoll der eigenen Soldaten entscheidend beeinflussen ließe und fürchten stattdessen eine weitere Eskalation der kriegerischen Auseinandersetzung. Ließen die USA und Europa sich auf Waffenlieferungen ein, würden sie exakt die Rolle als aktive Konfliktpartei einnehmen, die Putin ihnen vorwerfe. Die größte Gefahr von Waffenlieferungen bestehe zudem darin, einen Bruch des transatlantischen Krisenmanagements nach sich zu ziehen, und damit die USA und die EU strategisch dauerhaft zu schwächen, womit der Ukraine am Wenigsten gedient sei.
Die Rückkehr zum Recht des Stärkeren?
Innerhalb der Obama Administration scheiden sich die Geister an dieser Frage. Während der neue Verteidigungsminister, Ashton Carter, bei seiner Anhörung zum Amtseintritt im Kongress sagte, er neige zu einer Bewaffnung der ukrainischen Armee, klingen die Töne aus dem Nationalen Sicherheitsrat Obamas eher zögerlich. Wie die Entscheidung im Weißen Haus ausfallen wird, ist offen.
Unabhängig davon, in welche Richtung dieser Entsch eidungsfindungsprozess ausgeht, sollten sich alle Seiten der potentiellen transatlantischen Konsequenzen bewusst sein. Ein Anfang wäre gemacht, wenn die Diskussion um die richtige Strategie für die Ukraine in all ihren Facetten transatlantisch und undogmatisch geführt würde. Einigkeit herrscht dabei sicherlich darin, dass die Debatte um Waffenlieferungen zu kurz greift, wenn sie die weit größere politische Herausforderung für die transatlantische Allianz verkennt: Die Tatsache, dass das Recht des Stärkeren auf den europäischen Kontinent zurückzukehren droht.
Vor diesem Hintergrund war der gemeinsame Auftritt von Angela Merkel und Barack Obama ein gelungener diplomatischer Seiltanz. Im Kern sendeten beide ein Signal der Geschlossenheit zur Unterstützung der aktuellen diplomatischen Initiative von Deutschland und Frankreich, aber auch bezüglich einer möglichen Verschärfung von Sanktionen und im Hinblick auf das Eintreten für eine politische Lösung.
Beide machten zugleich deutlich, dass die Frage von Waffenlieferungen – trotz potentiell unterschiedlicher Auffassungen in dieser Frage – das entschlossene gemeinsame transatlantische Auftreten nicht berühren dürfe. Denn eine Schwächung der transatlantischen Allianz würde Putin in die Hände spielen und für den Aufbau der Ukraine nichts Gutes verheißen.
Weitere Informationen zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland finden Sie im Interview mit Ralf Fücks.