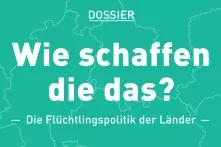"Wir schaffen das" – sagt die Kanzlerin. Richtig so! Aber wie? Das fragt dieses Dossier und schaut für das Jahr 2015 auf einen oft übersehenen Akteur in der Flüchtlingsdebatte: die sechzehn Bundesländer. Vorwort zu einer bundesweiten Recherche.
Die Länder spielen im föderalen Geflecht auch in der Flüchtlingspolitik eine zentrale Rolle (siehe das Interview mit Hannes Schammann). Besonders spannend ist eine nähere Betrachtung der Landespolitiken, weil es dort inzwischen (fast) jede denkbare Koalitionskonstellation gibt - das Farbspiel reicht von rot-rot-grün über grün-rot, rot-grün, rot-rot, rot-schwarz bis zu schwarz-grün. In neun Bundesländern ist Bündnis 90/Die Grünen an der Landesregierung beteiligt.
Geben unterschiedliche Konstellationen unterschiedliche Antworten auf die drängenden Probleme von Aufnahme, Bleiberecht, Integration und Gestaltung des gesellschaftlichen Diskurses um Heterogenität und Zugehörigkeit? Wie positionieren sie sich gegen Rassismus und Ausgrenzung? Gibt es grüne, rote, schwarze Handschriften in diesem politischen Handlungsfeld? Entstehen neue Allianzen jenseits der politischen "Lager"?
Diese Fragen nicht abstrakt, sondern entlang der spezifischen Situation in den einzelnen Bundesländern zu untersuchen, ist das Anliegen dieses Dossiers. Journalistinnen und Journalisten aus allen Regionen der Republik haben recherchiert, um die Besonderheiten eines Landes und der Landespolitik herauszuarbeiten - jede und jeder mit eigenen Fragestellungen, eigenen Formaten.
Die Berichte, die in diesem Dossier zusammengefasst sind, schildern detailreich die Situation in den Bundesländern Ende 2015, benennen Herausforderungen und politische Antworten der Landespolitik. Sie sind weit mehr als eine reine Bestandsaufnahme, sie beleuchten, wie weitreichend die gesellschaftspolitischen Veränderungen sind, die durch die verstärkte Ankunft von Geflüchteten ausgelöst werden. Längst verschränken sich Diskurse um sozialen Wohnungsbau, Arbeitsmarkt, demographischen Wandel, Bildungssysteme mit den Fragen der Aufnahme und Unterbringung, längst ist die Flüchtlingspolitik zum alles überlagernden Fixpunkt für eine sich zunehmend polarisierende Debatte um Identität und Zugehörigkeit, um Zusammenhalt und Zukunft des Wohlfahrtsstaats geworden.
Drei Trends aus regionalen Politiken
Aus der Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit regionaler Politiken ragen drei Trends besonders heraus:
- Die anfängliche Improvisation ist fast überall in eine gewisse Krisenroutine übergegangen. Administrative Strukturen wurden optimiert und ressortübergreifende Koordinationsstellen aufgebaut, die Erschließung neuer Unterkünfte professionalisiert usw. (Das gilt für alle Länder bis auf Berlin, wo sich das Registrierungs- und Erstunterbringungschaos eher vergrößert hat). Festzuhalten bleibt aber auch: All das funktioniert nur, weil zivilgesellschaftliche Gruppen nach wie vor viele behördliche Aufgaben übernehmen.
- Länder (und Kommunen) favorisieren in der Regel eine Politik der "Integration von Anfang an". Vielerorts reagiert man darum mit Skepsis auf die neuen bundesgesetzlichen Regelungen zur organisierten Desintegration von Flüchtlingen, denen eine Bleibeperspektive abgesprochen wird. Polarisierendes "Chaosgequatsche" (Hessens Innenminister Peter Beuth) zu vermeiden, darum bemühen sich alle Länder unabhängig der politischen Couleur. Ausnahme: die bayerische Hau-Drauf-Krisenrhetorik (nicht: die gesellschaftliche Praxis!), die in Wahlkampfzeiten schon mal Nachahmer in anderen Ländern findet. Aber, und das unterscheidet die Situation heute fundamental von den Neunzigern, insgesamt bestimmen nicht die Das-Boot-ist-voll-Parolen, sondern chancenorientierte Diskussionen das gesellschaftliche Klima vor Ort. Die mit Abwanderung und Überalterung konfrontierten Flächenländer etwa diskutieren inzwischen sehr konkret über die positiven demographischen Folgen der Flüchtlingsaufnahme und entwickeln Ideen für eine Bleibepolitik.
- Zunehmend treten jetzt die dahinter liegenden strukturellen Probleme einer Politik zu Tage, die im letzten Jahrzehnt mehr auf die Marktertüchtigung denn auf öffentliche Daseinsvorsorge geachtet hat: In den Städten verschärft die Flüchtlingsaufnahme die Probleme auf dem Wohnungsmarkt für die unteren Einkommensschichten. In der Bildungspolitik zeigt sich, dass unser Schulsystem immer noch weit entfernt davon ist, Kindern mit allen sozialen und sonstigen Herkünften Chancengleichheit zu gewährleisten, und es nach wie vor chronisch unterfinanziert ist. Im tertiären Bildungssektor bedeuten die ungenügenden Möglichkeiten von Teilqualifizierungen, dass die Neuankömmlinge ihre Kompetenzen nicht einbringen können und auf Jobs weit unterhalb ihrer mitgebrachten Qualifikation verwiesen werden. Zugespitzt kann man sagen: Die Erkenntnis wächst, dass Deutschland nicht eine andere Flüchtlingspolitik braucht, sondern eine andere Gesellschaftspolitik, die solidarische Antworten auf die Verwerfungen der Globalisierung gibt.
Mit dieser Diskursverschiebung von „Flüchtlingspolitik“ zu „Gesellschaftspolitik in Zeiten der Globalisierung“ öffnen sich neue politische Gestaltungsfelder, die den Debatten um Teilhabe von Minderheiten und gesellschaftlichen Zusammenhalt einen neuen Schub geben können. Gerade die Breite der Flüchtlingsunterstützungsbewegung macht Hoffnung, dass wir aus der Krise „das Richtige" lernen, wie es so schön heißt – lernen, in einer zerrissenen Welt Solidarität zu entwickeln, lernen, mit zeitweiligen Überforderungen gesellschaftlicher Inklusionsinstanzen unbürokratisch umzugehen: lernen also, gelassener zu bleiben im Umgang mit Spannungen und Konflikten, die eine plurale, demokratische Gesellschaft nun mal so mit sich bringt.
Dabei ist der Blick auch auf zwei Leerstellen zu richten, die nicht nur auf der Ebene der Bundesländer zu bearbeiten sind:
Zum einen die Aktivierung und Partizipation der Geflüchteten selbst. Die vorliegenden Ansätze, Strategien, Konzeptionen und Praktiken fragen überraschend wenig, was eigentlich die Interessen der Flüchtlinge sind, was sie brauchen, um auf eigenen Beinen zu stehen. Den Flüchtlingen die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Stärken im „Integrationsprozess“ selbstbestimmt einzusetzen, ist eine bisher weitgehend vernachlässigte Ressource. Dazu gehört auch eine Unterstützung ihrer Netzwerke und Strukturen, die sich, größtenteils unbemerkt, entwickelt haben.
Die andere und sicherlich folgenreichste Leerstelle ist die fehlende Gesamtstrategie im Umgang mit der alltäglichen verbalen und manifesten Gewalt – und das in allen Ländern. Der Gewöhnungsprozess an brennende Unterkünfte, Übergriffe auf Flüchtlinge, menschenverachtende Parolen und an die ausufernde Hetze im Internet ist unerträglich weit vorangeschritten. Dieses "Integrationshindernis" wird bisher nicht als Teil der Flüchtlingspolitik erkannt und bearbeitet, sondern bleibt innenpolitischen Expert/innen und Aktivist/innen überlassen. Die Auseinandersetzung mit Rassismus und Gewalt als Querschnittsthema muss ins Zentrum flüchtlingspolitischer Konzepte und Strategien rücken, damit das Klima der Offenheit, das die Basis jedes auf Inklusion und Teilhabe ausgerichteten Gesellschaftsentwurfes ist, erhalten bleibt.
Günter Piening war von 2003 bis 2012 Integrationsbeauftragter des Senats von Berlin. Er ist Soziologe und Journalist und hat das Dossier "Wie schaffen die das? Die Flüchtlingspolitk der Länder" in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung redaktionell betreut.