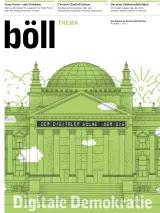Die US-Wahlkampfarbeit sei an einem Wendepunkt angelangt, sagen die digitalen Experten. Bietet Kalifornien, der US Staat, der mit Silicon Valley die Digitalisierung vorantreibt, neue Ansätze die Demokratie ins Digitale zu verlagern?
Die Suche nach Antworten führt mich nach Berkeley an die Universität von Kalifornien.
Seit in den sechziger Jahren hier die Studentenbewegung begonnen hat, gilt Berkeley als einer der progressivsten Orte Amerikas. Am Eingang zum Campus verteilt eine Frau Flugblätter zu einer politischen Veranstaltung. «Interessierst du dich dafür, die Welt zu ändern?», ruft sie.
Ich treffe Philips Stark, Professor für Statistik, um über E-Voting zu reden: All die potenziellen Wähler, die nicht wählen, weil sie an einem Sonntag nicht zu ihrem Wahlbüro kommen wollen oder können, machen online Klick. Alle paar Tage kommt ein Politiker auf Stark zu mit der Frage: «Warum wählen wir nicht längst im Internet?» «Ich muss dann erklären, dass das keine gute Idee ist», sagt er. Porno, Shoppen, Bankgeschäfte. Dafür eigne sich das Netz. Wenn auch nur bedingt. Fast jede Site nutze Cookies und speichere Daten. Wenn man online Pornos schaut, ist es nicht privat, sondern einsehbar. Wer online einkauft, dem werden oft ähnliche Produkte vorgeschlagen. Der Mensch im Internet hinterlässt Spuren. Kaum etwas im Netz ist privat.
Und die Sicherheit? Unsere Online-Überweisungen bei unserer Bank wähnen wir doch als sicher. «Es geht viel Geld verloren», sagt Stark, «aber die Banken sind bereit, die Kosten zu tragen, wenn etwas schiefläuft.» Die Banken haben beschlossen, dass es günstiger ist, das Risiko einzugehen und Kosten zu erstatten, als Bankangestellte in der Bank arbeiten zu lassen. «Das Internet ist leider weder privat noch sicher.»
Es gibt keine Garantie
Wenn wir dennoch im Netz wählten, liefe das so ab: Wir klicken einen Kandidaten. Vielleicht wird die Wahl gezählt, vielleicht erreicht sie ihr Ziel, vielleicht sogar unverändert, vielleicht wird sie richtig gezählt. Es gibt keine Garantie, keine Möglichkeit, Beweise für die eigene Wahl zu kreieren. Selbst ohne bewusste Manipulation oder Betrug.
Auch wenn E-Voting zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich scheint, in LA arbeitet man an neuer Technologie für die Wahl. Lange war die Wahltechnologie ein geschlossener Markt, bei dem wenige Händler Hard- wie Software stellten, die Wartung übernahmen und die Preise diktierten. In Travis (Texas), San Francisco und LA soll sich das nun ändern.
Pamela Smith, Vorsitzende der NGO Verified Voting, unterstützt den Landkreis LA dabei, ein neues Wahlsystem zu entwickeln. Der Trend gehe insgesamt zu Open-Source-Software und Papier. Doch statt per Hand ein Kreuzchen zu machen, wähle man mithilfe eines Touchscreens. «Auch, wenn man Wählern erklärt, wie sie einen Wahlschein ausfüllen sollen», sagt Smith, «machen manche Häkchen, statt das Feld auszufüllen, oder streichen die Kandidaten durch, die sie nicht wollen.» Diese Stimmen würden verloren gehen. Das vermeidet die Maschine und druckt den ausgefüllten Wahlschein aus. Der Wähler kann seine Richtigkeit überprüfen, wenn nötig kann das Papier als Beweis dienen. Der Wahlzettel wird dann mithilfe einer Maschine gescannt und ausgewertet.
Neu wird in LA vor allem die Nutzung von für alle zugänglichen Seriengeräten und Open-Source-Software sein. Damit macht sich der Bezirk unabhängig von Händlern, die seit Jahrzehnten von Verkauf und Wartung profitieren. Ihre Technik stammt oft noch aus den neunziger Jahren. Die Wahlen werden ein Stück moderner und transparenter. Bis das neue System läuft, wird es noch dauern, vielleicht bis 2018, vielleicht länger.
Auch wenn bei der Wahl an allen Ecken und Enden Technologie involviert ist, scheint es, als gehe es nicht immer nur ins Internet, auch nicht im technologieverliebten Kalifornien. Und manchmal bedeutet Fortschritt auch ein Zurück. «Die Leute müssen begreifen, dass das Neuste nicht immer das Beste ist», sagt Professor Stark. «Für Wahlen ist Papier beispielsweise noch immer die beste Technologie.»
Etwas ernüchtert gehe ich ein paar Häuser weiter zu Ken Goldberg. Schliesslich ist nach der Wahl vor der Wahl, und immer wieder wird Politikern vorgeworfen, ausschliesslich im Wahlkampf Kontakt zu den Bürgern zu suchen. Hilft hier das Internet zu kontinuierlicherem Austausch?
Im Berkeley Campus geht es an Studenten mit Anarchie-Ansteckern und regenbogenfarbenen Haaren vorbei, die in der Mittagspause über die neuste Folge ihrer Lieblingsserie debattieren und Sushi aus dem Campus-Laden essen. In seinem Büro in einem modernen Holzbau sitzt Ken Goldberg, ein Professor mit lockigem Haar und dickrandiger Brille. Er entwickelte die California Report Card, eine Plattform, die zu einem direkteren Kontakt mit den Regierenden führen soll. «Es geht darum, einen Schnappschuss der öffentlichen Meinung zu bekommen», sagt Goldberg. «Wie empfinden die Leute die Politik? Wie macht sich der Staat?» Er ist Teil von Citris, dem Zentrum für Informationstechnologie-Forschung im Interesse der Gesellschaft.
Die Mitmachplattform der Report Card kann jeder mit Internet öffnen. Sie funktioniert auf dem Smartphone und dem Laptop. Brandie Nonnecke, eine zierliche Frau, führt die Plattform vor. Sie ist eine der Managerinnen von Goldbergs Team. «Verbinden Sie sich mit 22.228 anderen, um die kollektive Intelligenz Kaliforniens zu stärken» heisst es auf der Site. Ein Klick auf «Teilnehmen». Dann eine Liste von sechs Fragen. Die Bewohner Kaliforniens sollen den Staat bewerten: Welche Note geben Sie dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Schulbildung? Wie schätzen Sie die Bezahlbarkeit der Unis ein und wie die Gesetze punkto Marihuana? Als einzige Kennzahl gibt der Teilnehmer seine Postleitzahl an.
Nun kann der Nutzer seine Antworten im Vergleich mit den anderen Bürgern sehen. Er sieht, dass die meisten das Gesundheitssystem besser benoten als die Bezahlbarkeit der Unis. In einem zweiten Teil können die Bürger nun eigene Vorschläge machen, was bei der nächsten Fassung der Report Card berücksichtigt werden sollte. Die Analyse läuft in Echtzeit, und regelmässig wird Lieutenant Governor Gavin Newsom, so etwas wie ein Kantons-Vize für Kalifornien, über die Ergebnisse informiert.
Analog führte der Weg zu ihm ins Capitol von Sacramento, 130 Kilometer nordöstlich von Berkeley. Statt Monate auf Gesprächstermine warten zu müssen, können Bürger nun also auf ihrem Rechner, egal, wo sie sind, die Regierenden bewerten. In Berkeley sagt Goldberg: «Es gibt im Internet viel Potenzial, die Art, wie wir über Politik und Demokratie denken, zu ändern.» Am Ende angelangt sei die Entwicklung noch nicht.
Sehen, wie Neues entsteht
Durch die Online-Befragungen habe man schon Themen ausgemacht, die man sonst übersehen hätte. So habe man festgestellt, dass die Vorbereitung auf Erdbeben eine zentrale Sorge der Bürger sei. «Keiner hatte das auf dem Schirm.» In Kontakt mit Gavin Newsom vom Senat wurde schnell reagiert. Das Team von Goldberg schuf eine Plattform, die sich nur mit Erdbeben befasst, Quakecafe.
Das System ähnelt dem der Report Card: Kaliforniens Bürger bewerten, schlagen vor, lernen Neues. Auch der Staat lernt, was Bürger brauchen und wie er helfen kann. «Ich möchte Werkzeuge entwickeln, durch die echte Diskussionen stattfinden können», sagt Goldberg. Denn neue Ideen entstehen durch diese Art Brainstorming. In der digitalen Welt müssen die Menschen dazu nicht mehr in einem Raum sein. Manche denken besser alleine, andere in der Gruppe, manche eher morgens, manche abends. «Wenn wir Werkzeuge entwickeln können», sagt Goldberg, «dass alle so arbeiten können, wie es ihnen passt, können alle sehen, wie Ideen herumhüpfen und Neues entsteht.»
Die Reise zur Demokratie der Zukunft führt nicht zwingend immer in die Digitalisierung. Während Wahlwerbung im Internet einen idealen Nährboden gefunden zu haben scheint, setzt man bei Wahlen wieder verstärkt auf eine mehr als 2000 Jahre alte Technologie: das Papier. Auch in Sachen Bürgerbeteiligung ist der Stein der Weisen noch nicht gefunden. Ideen aber gibt es genug im technophilen Kalifornien. Vielleicht muss man sie tatsächlich noch eine Weile herumhüpfen lassen.
Den vollständigen Artikel können Sie in der Neuen Zürcher Zeitung vom 10. Juli lesen.
Der Beitrag drückt die Meinungen der Autorin aus, die nicht notwendigerweise mit den Ansichten der Heinrich-Böll-Stiftung übereinstimmen.
Die Autorin Lena Schnabl ist eine unserer Media Fellows - mehr Informationen zum Transatlantic Media Fellowship Program