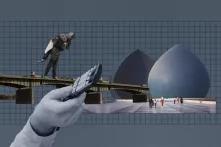In einem Auszug aus seinem Essay „Ich, ,der Homo'“ beschreibt der syrische Autor Raeef al-Shalabi den inneren Prozess, im Zuge dessen er sich als schwuler Mann positionieren und letzten Endes Menschenrechte auf eine neue Weise denken gelernt hat.
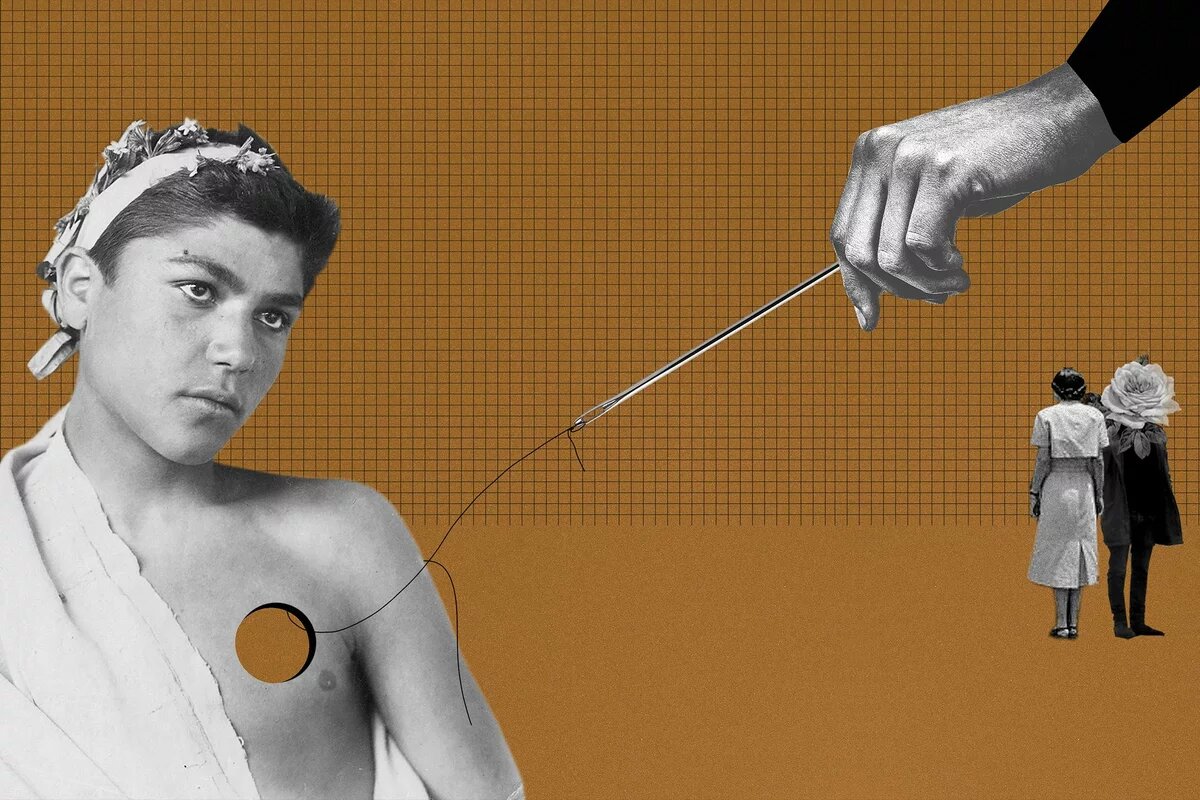
Allmählich verlor alles seinen Sinn. Ausgelaugt von all dem Lügen und Sich-Verstellen, ganz und gar in den Fängen der Einsamkeit, fing ich eines Tages an, morgens aufzuwachen und mir zu wünschen, ich wäre im Schlaf gestorben. Am Ende waren es 37 Schlaftabletten der Marke Ambien, die ich schluckte, bevor mich letztlich die Angst besiegte - vor dem Tod und vor der Vorstellung, wie es wäre, wenn meine Mutter erführe, dass sich ihr einziger Sohn mit gerade einmal 26 Jahren in einem fernen Land das Leben genommen hätte.
***
Wenige Monate nach dieser furchtbaren Nacht kehrte ich nach Syrien zurück. Doch ohne lange zu zögern - oder, womöglich: nach lebenslangem, ununterbrochenen Zögern - , ergriff ich die die nächstbeste Gelegenheit und ging nach Beirut. Dort suchte ich einen palästinensischen jungen Mann, den ich einmal kennen gelernt und von dem man mir später erzählt hatte, er lebe offen schwul. Ich fand ihn und „offenbarte mich“ ihm. Dies tat ich in wenigen Sätzen, die ich langsam, schleppend und nuschelnd hervorbrachte und dabei zum allerersten Mal ganz deutlich ein Gefühl verspürte, als nähme mir jemand tonnenschwere Felsen von Brust und Schultern.
Amer - so hieß er - stellte mich seinen Freunden vor, und die stellten mich ihren Freunden vor, und ich fing an mit ihnen jene neuen Bars zu frequentieren, die für Schwule und Lesben aus der Mittelschicht gemacht waren. Denke ich heute an jene Orte zurück, kommen sie mir so gewöhnlich, so brav und schlicht vor. In meiner damaligen Wahrnehmung aber waren sie etwas ganz Außergewöhnliches. Dort waren Libanes/innen von unterschiedlichsten regionalen und konfessionellen Hintergründen und wenn sich ihre sozialen Milieus auch meist ähnelten, wurde es in den lauteren, volleren Nächten durchmischter. Da kamen Syrer/innen und Palästinenser/innen, Heteros, Queers, teils aus der Arbeiter/innenschicht, die sich den Job hinter der Theke mit den Libanes/innen teilten, während die Stammkundschaft sich eher aus der gehobenen oder zumindest der mittleren Einkommensklasse zusammensetzte. Da waren auch Jordanier/innen, Iraker/innen, Ägypter/innen und Leute vom Golf, die entweder unter Beirutfans fielen, oder regelmäßige, saisonale Besucher/innen waren, aber es gab auch ausländische Tourist/innen aus der ganzen Welt.
Alle gaben sich Mühe, schön und elegant auszusehen. Die Atmosphäre war ungezwungen und heiter, ohne aber ins „Trashige“ zu kippen - zumindest nach den Maßstäben der globalisierten Schickeria, die dort ein- und ausging. Begegnete man dort zwei jungen Frauen auf ihrem dritten Date oder zwei mittelalten Männern, die seit fünfzehn Jahren als Paar lebten, konnte man einige Momente lang das Gefühl bekommen, wirklich in einer anderen arabischen Welt gelandet zu sein. Einer Welt, die nicht von einer erbärmlichen Sexualmoral beherrscht wird, in der Queersein längst keine Frage mehr ist und das, was Volljährige im gegenseitigen Einverständnis miteinander taten, ohne jemandem zu schaden, die Anderen nichts mehr anging. Einige Augenblicke lang hatte man das Gefühl, man konnte sein, wie man ist. Und durchatmen.
***
Erst Jahre später konnte ich Heteros gegenüber offen zu meinem Schwulsein stehen.
Hätte man mir damals erzählt, ich würde eines Tages öffentlich en detail über meine Sexualität sprechen, hätte ich das für einen schlechten Witz gehalten, oder eine lästige akustische Halluzination. Bis vor nicht allzu langer Zeit wollte ich einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich wollte nur eine kleine Fläche, wo ich nicht lügen und mich nicht zu verstellen brauchte und wo es eine kleine Schnittmenge gab, zwischen meinen geheimen queeren Welten und den paar Heteros, die mir nahe standen, aber an einer Hand abzählen konnte. Eine Fläche, die mich mit meiner lebensnotwendigen Ration an Freundschaft, Liebe und Sinnhaftigkeit versorgte. Im Gegenzug akzeptierte ich, außerhalb jener Fläche „nach den Spielregeln“ zu leben. Meine Befreiung war eine Befreiung im Mindestmaß, ihr einziges Ziel war mein Überleben als Individuum. Die anderen Schwulen und Lesben gingen mich nichts an, schon gar nicht „Queerness“ als politisches Anliegen.
Wenn ich mir diese Haltung heute ansehe, weiß ich, dass sich dahinter ein Riesenberg aus Pessimismus verbarg. Denn damit ein Mensch überhaupt für eine bestimmte Sache kämpfen und somit sein Leben, seinen Ruf und das Glück seiner liebsten Mitmenschen aufs Spiel setzen kann, muss er ja überhaupt erst einmal glauben, dass sein Kampf einen Sinn ergibt, wenn auch nur ein ganz klein bisschen. Irgendwo tief in sich drin muss er das Gefühl haben, dass all das zu riskieren zu einer Verbesserung der Situation führen könnte, zu einem würdigeren Leben, zu einer freieren und gerechteren Gesellschaft. Ich aber hatte damals nichts davon. Im Gegenteil, ich war der festen Überzeugung, jene libanesischen Bars wären das Höchste, das man sich auf diesem Fleckchen Erde wünschen könnte.
Ich glaubte, dass es das Beste sei, den Dingen ihren gewohnten Lauf zu lassen, wie sie ihn seit Jahrtausenden gegangen waren, hinter dem Schweigen der Wände, unter dem Schutz des Unausgesprochenen, ohne alberne Illusionen über Coming-Outs, Gleichberechtigung und den juristischen Jargon der Menschenrechte. Und so wie die Erde um die gigantische, grelle Sonne kreist, so kreiste mein Pessimismus um denjenigen, der für mich die Verkörperung aller Macht war, aller Eitelkeit, aller Gewalt, aller Privilegien und des allgegenwärtigen Hasses, dessen Klinge für immer und ewig an meinem Hals liegen würde: der heterosexuelle Mann, derjenige, „dem Majestät und Ehre gebühren“.[1] Wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich bis wenige Monate, bevor ich diesen Text schrieb, noch keinem einzigen heterosexuellen Syrer offenbart, dass ich schwul bin. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich mich, würde ich das tun, sofort einem wilden Schakal gegenüber finden würde, der stolz auf seinen Hass auf mich wäre, oder einem Fuchs, dessen Hass in Hohn und Verachtung umschlagen würde.
„There are two kinds of straight people in the world“, sagt Brian Kinney, der Hauptdarsteller der amerikanischen Fernsehserie Queer as Folk, die das Leben von fünf schwulen Männern im Pittsburgh der frühen 2000er erzählt. „Those that hate you to your face and those who hate you behind your back.“
***
Aber neben meinem Pessimismus war da noch etwas Anderes: Ein tiefsitzender Wunsch, mich zu assimilieren. Ein blinder Instinkt, mich den Spielregeln anzupassen, in der Hoffnung, ich könne so die Akzeptanz meiner Mitmenschen bekommen.
Denke ich jetzt an jene ersten Jahre zurück, jene Zeit, als ich gerade begann, mein Schwulsein zu akzeptieren, fällt es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich damals noch immer eine Mischung aus Schmach und Minderwertigkeit über meine Sexualität empfand. Ich war wie einer, der im Begriff war, eine vermeintliche körperliche „Missbildung zu akzeptieren und sich nun Mühe gab, sich nicht mehr allzu sehr davon beeinträchtigen zu lassen. Wenn ich schon kein Hetero sein konnte, dann wollte ich wenigstens das sein, was einem Hetero am nächsten kam: Ein schwuler Mann, dessen Schwulsein der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft fast nicht auffällt. Ein schwuler Mann, der die Hetero-Welt nicht stört, indem er über sein Schwulsein spricht. Ein schwuler Mann, der sein Schwulsein nicht zum Politikum macht, sondern der sich, im Gegenteil, bemüht, der Gesellschaft zu beweisen, dass er gut ist, obwohl er schwul ist.
Im Kern all dessen steht die Problematik der Männlichkeit. Mein ganzes Leben lang war ich auf der Flucht gewesen vor meiner vermeintlichen Unzulänglichkeit, von Kindesbeinen an meine soziale Männlichkeit zu performen. Dass ich in Wahrheit erfolgreich darin gewesen war, wurde mir ausgerechnet in dem Moment klar, als ich mir eingestand, dass ich schwul bin. In Beiruter Bars, an Damaszener Abenden und auf den Dating-Apps, die damals beliebt waren, sahen mich jene Männer, die auf „Maskulinität“ fixiert waren, als einen von ihnen an. Eitel und zufrieden stellte ich fest, dass ich innerhalb der bunten Vielfalt der Schwulenwelt als „maskuliner“ Mann gelte. Hirnverbrannte Homophobe verstehen davon nur Bahnhof, sind sie schließlich der Ansicht, ein schwuler Mann sei per definitionem „feminin“.
Dabei gibt es in Wirklichkeit sehr wohl viele Männer, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen, von denen man in gewissen Zusammenhängen aber sagt, man „sehe ihnen ihr Schwulsein gar nicht an“ – und viele von ihnen heften sich das auch gerne ans Revers. „Der ist so maskulin“; „der verhält sich wie ein Hetero“, „ein Macho“, „ein ganz Diskreter“, „merkt man ihm gar nicht an“. Solche Beschreibungen zirkulieren unter schwulen Männern als positive Attribute, die sie entweder selbst anstreben oder in ihren Partnern suchen. Dem liegt wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen Haltungen zugrunde: Eine sozial und historisch bedingte Disposition, die Schönheit und Attraktivität eines Mannes in erster Linie mit seiner „Kraft“ und „Maskulinität“ zu verbinden; tiefe seelische Wunden, die Männer seit ihrer Kindheit und Pubertät tragen und die dazu führen, dass sie ihre Maskulinität in den Vordergrund stellen und womöglich sogar von ihr besessen sind, und der rein pragmatische Beweggrund, dem Zorn und den Ressentiments der Gesellschaft zu vermeiden. Genau weiß ich es nicht, auch ich habe hierzu nur meine persönlichen Eindrücke.
Sicher aber ist, dass diese Mischung die repressive Binarität „weiblich-männlich“ auch innerhalb queerer Communities reproduziert. Das wiederum führt bei vielen Schwulen, die sich selbst als „maskulin“ sehen, zu einem gewissen Unbehagen, einer gewissen Kälte, zu Ablehnung und Überheblichkeit bis hin zu offenem Hass gegenüber denjenigen Schwulen, die sie als „effeminiert“, als „Tunten“, aus „aufgeflogene“ oder einfach als „Frauen“ betrachten. Und anstatt sich in einem öffentlichen Befreiungskampf zu engagieren, bei dem sie mit jenen in einer Reihe stehen würden, wähnen sich viele jener selbstgewissen Repräsentanten der Maskulinität durch ihre klischeehafte Lebensweise vor jeglicher Unterdrückung sicher. Manche Extremfälle glauben sogar, die Ursache des Problems sei gar nicht die heteronormative Gesellschaft, sondern die „Tunten“, die mit ihrer Effeminiertheit den Ruf der Schwulen in den Dreck ziehen und so deren Akzeptanz bei den Heteros verhindern würden.
Bewusst habe ich solche Gedanken nie übernommen. Aber ich habe immer sehr auf meine Maskulinität geachtet und mich stets vor jeglichen Personen ferngehalten, die irgendwie Blicke auf sich ziehen könnten. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich heute, dass meine damalige Haltung durchaus etwas von Taqiyya[2] hatte, also etwas von Verstellung, aber auch ein klein wenig von … Mittäterschaft.
***
Erst im Rückblick konnte ich meinen damaligen Pessimismus und meinen Assimilationstrieb wahrnehmen. Während der Jahre ihrer Totalherrschaft über mich war ich mir ihrer nicht bewusst. Wessen ich mir hingegen immer völlig bewusst war, war eine dritte Logik, die mich abermals daran hinderte, mich für queere Menschen und ihre Lebensumstände als soziales und politischen Anliegen zu interessieren. Nennen wir sie einmal die „Logik des Verschiebens zugunsten anderer Prioritäten“. Seit meinen ersten Abstechern in besagte Beiruter Bars und ihre Parallelwelten, lernte ich in erster Linie eine bestimmte Art von Leuten aus der LGBTIQA+-Szene kennen: Junge Männer und Frauen, die vor aller Welt offen zu ihrer Sexualität standen und die sich teilweise in Vereinen organisierten, Demos und Aktionen planten, um damit Aufmerksamkeit für Freiheit und Gleichberechtigung in Sexualitäts- und Genderfragen zu schaffen.
Ich war durchaus beeindruckt von ihnen, gleichzeitig zweifelte ich aber auch an der Priorität ihres Kampfes in unserem arabischen Kontext. Halb ernst, halb ironisch pflegte ich sie zu fragen, wie sinnvoll es denn sei, sich für die Rechte von queeren Personen in einer Region einzusetzen, wo keiner Rechte hat – weder Heteros, noch Frauen, weder Mehrheiten, noch Minderheiten! Wäre es nicht sinnvoller, erst einmal für die Rechte aller Menschen zu kämpfen und einen Nenner zu finden, den alle gemeinsam haben – und den Genderkampf auf irgendwann später zu verschieben? Und war es nicht auch so, dass der queere Kampf seine größten Siege in Ländern errungen hatte, wo Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und das Vokabular politischer und zivilgesellschaftlicher Rechte ohnehin schon fest verwurzelt war? Wäre es also nicht besser, unsere Kraft in diese allgemeineren Fortschritte zu investieren, bevor wir uns in einem partikulären Kampf engagieren, in dem wir noch dazu so gut wie keine Verbündeten haben?
Dachte ich an queere Menschen in Syrien, stellte ich mir dabei immer Leute vor, die mir oder den Leuten in meinem Freundeskreis glichen: Junge Männer und Frauen aus der Mittelschicht, Akademiker/innen, die in Städten lebten, vermutlich ganz gut Englisch sprachen und generell auf dem Laufenden waren über Filme, Serien und Musik und was die globale Popkultur sonst noch so hervorbrachte. Mit anderen Worten: globalisierte junge Menschen, die in der Lage waren, sich an den globalen Diskursen für LGBTIQ+-Rechte zu beteiligen und sich nur allzu gerne davon inspirieren ließen, weil sie letzten Endes Opfer derselben „viktorianischen“ Sexualmoral waren, gegen die sich jene Kämpfe richteten.
Ich wusste natürlich, dass Homosexualität als Neigung und Praxis auch überall sonst vorkam, auch außerhalb jener sehr speziellen Gesellschaftsschicht, zwischen Frauen und zwischen Männern, zwischen Armen und weniger Armen, in den alten Vierteln von Damaskus und Aleppo, in allen anderen Städten, Dörfern und Provinzen. Aber ich fragte mich immer, ob einem Menschen, der in jenen Welten gleichgeschlechtliche Beziehungen lebte, seine „Rechte“ als queere Person etwas bedeuteten. Ob er sich überhaupt als Schwuler bezeichnen würde, ob ihm das Wort „schwul“ überhaupt geläufig war. In Wahrheit war ich davon überzeugt, dass es eine wahnsinnig elitäre Sache sei, über Schwulenrechte zu reden. Eine Sache, die nicht einmal den Schwulen „aus dem Volk“ etwas bedeutete. Das allerdings hieß im Umkehrschluss für mich, dass es nicht nur vorschnell wäre, das Thema auf den Tisch zu bringen, sondern, dass es der queeren Allgemeinheit sogar schaden würde. Denn es würde die Aufmerksamkeit der konservativen Kräfte auf sie lenken, an denen sie sonst wie seit jeher unbemerkt vorbei leben könnten.
Das war meine Überzeugung – bis gar vor nicht allzu langer Zeit.
***
Ganz verlassen haben sie mich nie, diese Gedankengänge und Gefühle. Auf die eine oder andere Weise sitzen sie noch tief in mir drin. Dort ringe ich mit ihnen und sie mit mir, bis sie mir heimlich entwischen, in einer flüchtigen Handlung, einem dahingesagten Satz oder einer unbewussten Reaktion. Und in Augenblicken der Stille knüpfen sie Gespräche mit mir an, ruhig, aber resolut.
Noch immer trage ich tief in mir einen harten Kern aus Pessimismus. Oder, genauer gesagt, besteht dieser Kern heute eher aus instinktivem Misstrauen. Ich fühle mich immer noch latent unwohl, wenn ich mich in der Öffentlichkeit in Gesellschaft einer Gruppe Schwuler befinde, „denen man es ansieht“. Und ich bin immer noch schlagartig genervt, sobald ich eine Aufnahme meiner Stimme höre und dabei das Gefühl nicht loswerde, meine Stimme klinge nicht rauh und „maskulin“ genug. Mein Misstrauen und mein Assimilationstrieb sind bei alledem so eng miteinander verwoben, dass ich sie meistens gar nicht auseinanderhalten kann. Wenn ich von positiven Errungenschaften auf dem Weg in Richtung Freiheit, Würde und Gleichberechtigung meiner queeren Leidensgenoss/innen an irgendeinem Fleckchen dieser Welt höre, halte ich mich immer mit meiner Zuversicht zurück. Denn dann muss ich daran denken, wie die Schwulen in Deutschland in den Zwanzigern ihre Clubs und Bars hatten und wie erstaunlich frei und sichtbar sie im öffentlichen Raum waren, bis man sie wenige Jahre später in die Gaskammern schickte.
Mache ich die Bekanntschaft eines heterosexuellen Mannes, gehe ich immer automatisch davon aus, dass er eine potentiell Gefahrenquelle ist. Dann versuche ich mich zu schützen, indem ich mich am Rockzipfel der Maskulinität festklammere und mich den „Spielregeln“ entsprechend verhalte. Und wenn ich mich mit Aktivistenfreund/innen treffe, werfe ich immer ein, dass die Belange der LGBTIQ+-Community nicht von den Belangen der restlichen Menschheit getrennt sein dürfen. Auch stelle ich beharrlich – und wahrscheinlich auch ein wenig nervig - die Frage, ob ihr Befreiungsnarrativ wirklich dem Anspruch gerecht wird, die Lebensrealität aller widerzuspiegeln, die es repräsentieren will. Dennoch habe ich mich geändert. Verändert hat mich jenes menschliche Erdbeben, das Syrien im Jahr 2011 durchgerüttelt, die Wände meiner kleinen Welt eingerissen und mich nach und nach in andere, neue Welten getrieben hat. Zuerst entdeckte ich heterosexuelle Syrer/innen, die die queere Causa voll und ganz verstanden und sie vor aller Welt verteidigten. Meist waren es mutige Frauen und Aktivistinnen, aber es befanden sich auch Männer unter ihnen, die sich gegen repressive, patriarchale Auffassungen von Männlichkeit stellten.
Manche Diskussionen in sozialen Medien ließen in mir eine ungewohnte Zuversicht wachsen - eine, die der kollektiven Zuversicht ähnelte, die die Demonstrationen in Syrien begleitet hatte. Plötzlich verstand ich, dass der Pessimismus der Unterdrückten ab einem gewissen Punkt zur tödlichen Waffe in den Händen der Unterdrücker wird. Mir wurde bewusst, dass wir sehr wohl Verbündete hatten, die bereit waren, ihre Stimme zu heben, um uns zu verteidigen. Und als ich plötzlich meine Vorsicht und mein Schweigen gegen ihren Mut und ihre lauten Stimmen aufwog, schämte ich mich.
Dann, ohne, dass ich es darauf angelegt oder es geplant hatte, geschah es, dass ich eine andere Art Syrer/innen kennenlernte: Zaki, Khaled, Mohammad, Wissam, Abdallah, Nuha, Hanan, Lina und viele andere mehr. Gerade frage ich mich, ob es wirklich angemessen ist, sie als Schwule und Lesben zu bezeichnen. Das waren sie zwar wirklich, aber sie waren eben auch, wie alle Menschen, noch so viele andere Dinge mehr als ihre sexuelle Orientierung. Sie hatten alle ganz verschiedene Temperamente, Lebensumstände, waren unterschiedlich aufgewachsen und lebten über das ganze Land verstreut: In Homs, in Ghouta, in Yarmouk, in Raqqa, in Aleppo, unter den Massen der Fliehenden und später derjenigen im Exil in Beirut, der Türkei und Europa.
Die meisten von ihnen lernte ich über einen gemeinsamen Nenner kennen, der überhaupt nichts mit unserer Sexualität zu tun hat: Wir alle unterstützten die Revolution und engagierten uns auf die eine oder andere Weise in ihren Kämpfen. Erst später und exakt so allmählich, wie man nach und nach eine geheime Chiffre dekodiert, entdeckten wir jenen anderen Nenner, der uns miteinander verband. Es gab Mutige unter ihnen, die vor einem relativ großen Personenkreis offen queer lebten und es gab andere, die eher vorsichtig waren und sich mit einem klitzekleinen Raum begnügten, wo sie sie selbst sein konnten. Aber sie alle waren sich völlig darüber im Klaren, wer sie waren. Sie waren damit im Reinen und es war ihnen wichtig, ihr Existenzrecht zu verteidigen. Und im Gegensatz zu jenen, die ich davor in Beiruts Bars kennengelernt hatte, waren die meisten von ihnen stark in ihrer Regionalität verhaftet, zutiefst engagiert in den Belangen ihrer Provinzen, Viertel und kleinen Dörfer. Von ihren Träumen, Eskapaden und romantischen Beziehungen sprachen sie ausschließlich in ihrer jeweiligen lokalen Mundart. Sie waren einfach so, quälten sich auch nicht lange mit der Frage herum, wie „repräsentativ“ sie seien und ob es berechtigt sei, als queere Personen Freiheit, Würde und Gleichberechtigung zu verlangen. Für sie war das auch keine komplexe theoretische Fragestellung, es war schlicht gesunder Menschenverstand. Man könnte auch sagen, sie waren lokal verwurzelt und universell ausgerichtet, aber ohne großes Brimborium und ohne das Gefühl, das Ganze erklären oder problematisieren zu müssen. Es war für sie einfach selbstverständlich.
***
Meine komplette Kindheit über hatte ich ein Gefühl totaler Verlassenheit, aber ohne den Luxus, zu verstehen, warum. Und erst, als ich jene jungen Männer und Frauen kennenlernte, spürte ich zum ersten Mal, dass ich nicht alleine bin. Aus Liebe zu meinen neuen Freund/innen begann ich, mich für LGBT-Rechte zu interessieren. Die Bindung, die ich zu ihnen aufbaute, beruhte auf unseren geteilten Geheimnissen und Bekenntnissen. Auf dem existentiellen Horror, der uns so lange begleitet hatte, dass er ein Teil von uns geworden war, auf den Schwerthieben der Kindheit und Pubertät, die auf unserer Haut tiefe Wunden und darunter noch tiefere Traumata hinterlassen hatten. Sie beruhte auf der Entdeckung, dass die Menschen, die einem am nächsten standen, zu den grausamsten Menschen werden und einem den größtmöglichen Schaden zufügen konnten.
Als einige dieser Freundschaften von der virtuellen in die reale Welt wanderten, erst in Beirut, dann in der Türkei und schließlich in Deutschland, wuchs mein Bekanntenkreis immer mehr. Schließlich schloss er sogar Leute mit ein, von denen ich mich früher geekelt und sofort das Weite gesucht hätte, weil ich sie als „Klischeeschwule“ betrachtet hätte. Jetzt wurde mir klar, dass sie die Allermutigsten und Stärksten von uns waren. Ich verstand jetzt, was es hieß, mit der ständigen Bedrohung zu leben, getötet, geschlagen, verhaftet oder gedemütigt zu werden, einfach nur, weil man raus auf die Straße geht. Ich sah, wie sie all jene Gefahren, mit denen sie täglich konfrontiert waren, in eine nie versiegende Quelle für sarkastischen Humor verwandelten – über das Leben, über die Mächtigen, über die Besitzer pikierter Gesichter und deren rigide Moralvorstellungen, und zu guter Letzt über sie selbst. Ich wurde neidisch, als ich entdeckte, dass sie ganz im Gegensatz zu mir ihre Natur nicht von Kindesbeinen an mit fieberhafter Vehemenz bekämpft hatten, sondern es fertig brachten, sich von einem Moment zum anderen zu befreien, zu vergessen und – zu tanzen!
Letztlich beschloss ich, diesen Text in erster Linie als eine Art Brief an jene Freund/innen zu adressieren, und an alle anderen, die ihn lesen wollen, aus den queeren Communities in unserer gar so glücklichen arabischen Welt. Weil ich inzwischen voll und ganz verstehe, was für eine enorme Kraft durch ein Coming-Out und durch geteilte Geschichten zwischen Gefährt/innen und Fremden entstehen kann. Eine Kraft, die beim Durchhalten und Weitermachen hilft. Ich wollte von dem „Käfer“ erzählen, der in mir hauste - vielleicht kann meine Erzählung ja jemand anderem helfen, seine Einsamkeit zu überwinden, seine Angst, seinen Selbsthass, seine Obsession mit seiner Maskulinität oder sein Verlangen, Schlaftabletten zu schlucken und sein Leben zu beenden. Wir sind kein Ungeziefer. Wir sind keine Teufel. Wir sind keine Kranken, wir sind keine Kinderschänder. Wir sind keine Agenten des Westens, des Zionismus, der Freimaurer oder des Butzemanns. Wenn es einen Gott gibt, dann ist es zweifellos er gewesen, der uns so erschaffen hat. Und all die Doktrinen, die das Gegenteil behaupten, gehören in die Tonne.
Wenn es aber keinen gibt, dann schaden wir zumindest niemandem mit dem, was wir im gegenseitigen Einverständnis miteinander tun. Und wenn wir auf offener Straße getötet, von hohen Gebäuden gestürzt oder festgenommen werden, wenn auf Polizeiwachen unsere Intimsphäre durchleuchtet wird, dann werden wir nicht sagen: „Aber wir sind doch Menschen, obwohl wir queer sind“, sondern wir werden sagen: „Ja, wir sind queer und wir haben Rechte“. Und wenn wir um unser Überleben kämpfen, denn dann hat unser Kampf für alle Menschen Priorität. Denn wir kämpfen für Freiheit, Gerechtigkeit und für die Rechte aller Menschen. Weil diejenigen, die unsere Rechte verletzen, durch uns die Verletzung der Rechte aller legitimieren, indem sie erst an uns üben, was sie später gegen alle loslassen. Das alles habe ich nicht in der Hoffnung aufgeschrieben, die Dummen und Bösen, die uns verachten, zu bekehren. Von ihnen erwarte ich mir nichts als eine Riesenflut an Beleidigungen, Flüchen und Anschuldigungen, sollte es dieser Text je ans Licht schaffen. Nein, ich schreibe diesen Text für Meinesgleichen.
***
Jetzt, nachdem ich mein Leben bis ins kleinste Detail preisgegeben habe und am Ende dieses langen Textes angelangt bin, bleibt nur noch, dass ich zugebe, dass mein Vorname nicht Raeef und mein Nachname nicht al-Shalabi ist. Ich habe einen fast achtzigjährigen Vater, für den ich das Licht der Welt bin. Jedes Mal, wenn ich während des Schreibens an ihn denken musste, fühlte ich Reißzähne und Klauen aus dem Schreibtisch und dem Stuhl in mein Herz und meine Gedärme fahren. Ich werde meinem Vater nicht das Herz brechen. Nicht ihm, der alles gegeben hat, um mich glücklich zu machen. Ich werde ihm nicht sagen, wer ich wirklich bin, seine Gesundheit aufs Spiel setzen, seine Liebe zu mir riskieren und ihm seinen Stolz auf mich zerstören. Wenn er eines Tages stirbt, werde ich bitterlich um ihn weinen. Meine Trauer um ihn wird eine Doppelte sein: Die Trauer darüber, ihn zu verlieren, und die Trauer darüber, dass er so lange gelebt hat, ohne die wichtigste Geschichte meines Lebens zu kennen. Aber ich kann nicht zulassen, ihn gebrochen, schockiert und traurig zu sehen – oder wütend, hart und aufbrausend. Um seinetwillen und nur für ihn, werde ich weiter mit dieser eigenartigen Mischung aus Schönrederei und Lüge leben, die Menschen auf Arabisch in alter Zeit „Taqiyya“ zu nennen pflegten. Nach ihm aber, und mit jedem Anderen, bleibt mir keine Alternative mehr als die Wahrheit. Uns allen bleibt keine Alternative.
Dieser Text ist ein Auszug aus dem Essay „Ich, ,der Homo'“, der im November 2018 auf aljumhuriya.net erschien.
[1] Derjenige, dem Majestät und Ehre gebühren, ist der 85. und 99. Name Gottes. Diese kommen im Koran vor und werden als Synonyme für Gott verwendet.
[2] Taqiyya – hier im übertragenen Sinne – bezeichnet normalerweise ein Prinzip, wonach es bei Zwang oder Gefahr für Leib und Besitz erlaubt ist, rituelle Pflichten zu missachten und den eigenen Glauben zu verheimlichen.
Übersetzung aus dem Arabischen & Kuration: Sandra Hetzl (*1980 in München) übersetzt literarische Texte aus dem Arabischen, u.a. von Rasha Abbas, Mohammad Al Attar, Kadhem Khanjar, Bushra al-Maktari, Aref Hamza, Aboud Saeed, Assaf Alassaf und Raif Badawi, und manchmal schreibt sie auch. Sie hat einen Master in Visual Culture Studies von der Universität der Künste in Berlin, ist Gründerin des Literaturkollektivs 10/11 für zeitgenössische arabische Literatur und des Mini-Literaturfestivals Downtown Spandau Medina.
Dieser Beitrag ist Teil unserer Serie „Blick zurück nach vorn“. Anlässlich von zehn Jahren Revolution in Nordafrika und Westasien schildern die Autor/innen dabei aus verschiedensten Kontexten, was sie hoffen, wovon sie träumen, was sie sich fragen und woran sie zweifeln. In ihren literarischen Essays wird deutlich, wie wichtig die persönlichen Auseinandersetzungen sind, um politische Alternativen zu entwickeln, und was jenseits der großen Ziele erreicht wurde.
Mit dem anhaltenden Kampf gegen autoritäre Regime, für Menschenwürde und politische Reformen beschäftigen wir uns darüber hinaus in multimedialen Projekten: In unserer digitalen scroll-story „Aufgeben hat keine Zukunft“ stellen wir drei Aktivist/innen aus Ägypten, Tunesien und Syrien vor, die zeigen, dass die Revolutionen weitergehen.