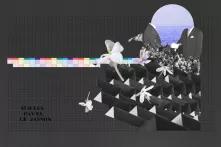Angesichts des schrecklichen Krieges und der Hungersnot im Jemen ist es Bushra al-Maktari nicht leicht gefallen, sich an die hoffnungsvollen Anfänge der Revolution zurückzuerinnern. In einer fast spirituellen Rückschau umreißt sie aber ein auch für die jemenitische Revolution zentrales Konzept: Das Konzept der Würde.

Würde hat Augen, Lippen und Schultern. Und Füße, die ihren Traum bis ans Ende tragen würden. Wie hätten sie ahnen können, dass sich ein Gewitter zusammenbraute? Dass der Ruf nach Freiheit bald in der Mittagshitze dieses traurigen Landes verhallen würde?
Dabei waren es erst die Füße, die der Würde eine Gestalt verliehen, während sie sich den Boden, auf den sie stapfend ihre Schatten warfen, Schritt für Schritt wieder aneigneten. Es waren die Schultern, die sich den Panzern entgegenstellten und dafür mit ihrem Blut bezahlten; es waren die Kehlen, die die Tyrannen in die Flucht schrien. Es waren Augen, die zaghaft Flügel wachsen sahen, wo die Vergangenheit ihre langen Schatten warf. Doch den Menschen, die für Würde gekämpft haben, wurde ein anderes Los zuteil. Genau wie ihrem Land, dem Jemen, der heute im Krieg versunken ist.
Ich schlage die Augen auf und erinnere mich zurück. Der 2. Februar 2011 war ein Mittwoch. Es war gegen Mittag, als sich eine Gruppe junger Männer und Frauen – Journalist/innen, Anwält/innen und Aktivist/innen – in der Kanzlei von Yasmine al-Sabri in Taizz versammelte. Die Wände des kleinen, fensterlosen Raumes schienen sich zu weiten, bis die ganze Welt hineinpasste. Alles redete durcheinander, laut und euphorisch. Die Gruppe „Jugend für Wandel“ plante gerade die Kundgebung, die am nächsten Tag stattfinden sollte. Einige diskutierten mögliche Versammlungsorte, andere verliehen Ängsten und Erwartungen Ausdruck, wieder andere schrieben Slogans auf Pappschilder.
Die Stimmen von Sanaa, Yasmine, Mutlaq, Iban, Ishraq, Ahmed, Ghazi, Taufiq, Mohammed und Wissam überlagern sich in meinem Kopf. Ich sehe Yassin Abd al-Qadir vor mir, wie er sich über ein Stück Karton beugt. Während er die Forderungen der Revolution mit rotem Marker festhält, schreibt er sich die Angst von den Fingern.
Yassin, ein schmaler, junger Mann mit dunkler Haut, kam aus einem der Dörfer auf dem Dschabal Saber, wo die Wolken ganz nah sind. Seine Art, von der Revolution zu träumen, war zielsicher und stark, wie die stille Kraft eines Kaffeebaumes, dessen Äste immer zum Licht streben. Dass Träume manchmal bitter schmecken, erfuhr Yassin erst später: Wenige Monate nach der Demonstration sperrte ihn das Regime des damaligen Präsidenten Ali Abdullah Salih in eine Zelle in Taizz. Später starb er im Krieg, gerade einmal Anfang Dreißig. Sein Tod hinterließ eine tiefe Wunde in den Herzen seiner Angehörigen und Freunde.
Doch bei der Demonstration am Tag nach dem Treffen bei Yasmine al-Sabri lief Yassin an der Spitze. Mit ängstlichen Schritten bahnte er sich den Weg: durch das Ussayfira-Viertel, an der Tankstelle vorbei, zum Sitz der Gouvernementsverwaltung von Taizz. Glitzernde Schweißperlen rannen den jungen Frauen und Männer in der heißen Mittagssonne über die Stirn. Es war, als müssten sie die über Jahrzehnte gewachsene Angst erst wieder Schritt für Schritt ablegen und sich selbst zurückerobern. Ihre Schatten haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Sie markieren die Grenzlinie zwischen Freiheit und Demütigung. Ich weiß noch, wie sich die protestierende Menge vor der Betonabsperrung um das Verwaltungsgebäude aufbaute und einen gewaltigen Wall bildete, eine Art menschlicher Staudamm, so wie der von Ma'rib[1], während die Soldaten ihre Gewehre im Anschlag hielten. Dann die Szene, als Dr. Mohammed Makharesh auf die Absperrung kletterte und den Sicherheitskräften in ihren gepanzerten Fahrzeugen seine nackte Brust entgegenstreckte.
Vor meinem inneren Auge fegen die Schritte wie Lichtflecken dahin. Sie flackern durch die Gassen und Straßen der Stadt, über Dächer und Büroklötze, bis sie wieder erlöschen. Diese Schritte waren noch nicht so zäh und selbstbewusst wie die, die später Tag für Tag durch die Straßen der Stadt und des Landes hallten: als die Menschen zum Aufbau der Protestcamps auf dem Freiheitsplatz in Taizz zogen oder als sie den Platz des Wandels in Sanaa eingenommen hatten, bevor die Kriegsparteien sich einigten, wieder Krieg zu führen. Nein, diese Schritte waren noch frisch, unerfahren. Sie wussten noch nicht, dass der Sturm, der aufzog, all ihre Träume niedermähen würde. Träume von einem Recht auf Heimat, in der jede und jeder Platz hat.
An jenem Tag mussten die Schritte an einer Wand aus verächtlichen Blicken vorbei. Sie galten den Frauen, die sich in Straßen begeben hatten, die allein den Männern vorbehalten waren. Ich sehe sie noch genau vor mir, wie sie dort stand, mitten auf dem zentralen Kath[2]-Markt: die Rechtsanwältin Yasmine al-Sabri, in einem kleinen Pulk von Mitstreiterinnen, nicht mehr als zehn dürften es gewesen sein. Von einem fahrenden Kath-Händler hatte sie sich ein Megafon ausgeborgt und mit ihrer rauen Stimme schrie sie hinein, den Kopf in den Nacken geworfen: „Arbeiter aller Länder, wehrt euch! Bauern aller Länder, wehrt euch!“ Ihre Stimme hallte durch den Kath-Markt, übertönte sein Getöse, die Flüche der Verkäufer und das Gemurmel der Schaulustigen.
Während ich so zurückdenke, fühle ich plötzlich einen Stich im Herzen. Plötzlich ist es wieder da: das Knattern des Revolutionsbusses – so nannten wir ihn. Das kleine, weiße, klapprige Gefährt brummte durch das Gassengewirr der Stadt. Dabei brach sein Motor oft abrupt qualmend zusammen. Dann schoben die Demonstrant/innen kräftig hinten an und bahnten sich so ihren Weg durch die Menschenmenge auf dem Fischmarkt in der Stadtmitte. Die Fischverkäufer, die dort mit ihren Filetiermessern hinter ihren Tischen standen, musterten die jungen Männer und Frauen scharf, die da in aller Herrgottsfrühe hinter einem Klapperbus hermarschierten.
Der Bus gehörte dem Genossen Ayoub al-Salihi, der damit nichts Geringeres als „revolutionäre Beschleunigung“ bezweckte. Aus den Lautsprechern des Revolutionsbusses ertönte: „Dieser Tag gehört mir, ich laufe in sein Licht“. Der Schwung des patriotischen Liedes von Ayoub Taresh steckte uns an. „Aller Stolz meines Landes wohnt in mir und all seine Schande tut mir weh", ging es uns durch die Ohren in die Köpfe und wir fühlten, wie wir wirklich wieder stolz wurden auf dieses Land, das uns doch allen gehören sollte. Mittlerweile ist leider klar, dass der Jemen offensichtlich nicht allen gehört, sondern den kriegführenden Parteien. Aber damals nahmen wir die Sicherheitskräfte kaum war, die uns mit stechendem Blick und im Anschlag gehaltenen Waffen beobachteten; und auch den Panzern, deren Kanonenrohre die Bewegung der Demonstration begleiteten, schenkten wir keine Aufmerksamkeit.
Tag für Tag fuhr Genosse Ayoub mit seinem Revolutionsbus durch die schwer bewachte „Zone der Angst“ bis an ihr äußerstes Ende, wo er den Soldaten seine Freiheitsparolen entgegen schmetterte. Ayoub, der bislang nur durch pures Glück einer Verhaftung entgangen war, wurde Jahre später von einer selbsterklärten „Revolutionsmacht“ verschleppt. Den Revolutionsbus ließen die neuen Herrscher auf dem Freiheitsplatz verrotten, als Zeuge der Katastrophe, während man Ayoub in die Keller eines bis heute unbekannten Gefängnisses verbannte.
Erst in den Körpern von Menschen, die dem Tod ins Auge blicken und dem Scharfschützen entgegentreten, der es auf ihre Träume abgesehen hat, erst dort wird die Würde zur Naturgewalt.
Etwa um die gleiche Zeit war es, dass die Journalistin Maha Al-Sharjabi wie ein Morgenstern in unser Leben kam. Wer den Spuren der Würde in der Geschichte der Revolution folgen will, kommt nicht umhin, über sie zu sprechen. Wie sie mit ihrer kleinen Kamera herumlief, um tagein, tagaus Demonstrationen und den Alltag im Protestcamp auf dem Platz der Freiheit zu dokumentieren. Oder wie sie einmal die aus Islamisten bestehende Menschenkette sprengte, mit der diese weibliche von männlichen Demonstranten trennen wollten. Mit ihrem Sonnenschirm als Waffe führte sie den Marsch an. Als echte Bürgerin stellte sich Maha nicht nur der Diskriminierung von Frauen entgegen, sondern kämpfte gegen autoritäre und patriarchale Unterdrückung.
Da war diese Situation, als vor dem staatlichen „Krankenhaus der Revolution“ ein Panzer stand und Granaten auf die Demonstranten feuerte. Überall wurde geschossen, ein Demonstrant wurde getötet. Während alle um ihr Leben rannten, lief Maha todesmutig auf einen Soldaten zu. Ich sah sie mit ihm diskutieren und dabei sein Gewehr festhalten, bis er schließlich den Lauf seiner Waffe senken musste und den übrigen Demonstrierenden gestattete, die Demo fortzusetzen.
Ich erinnere mich an eine andere Demo, bei der die Menschen ihre innere Angst in Mut verwandelten. Die Armee hatte mit Wasserwerfern und gepanzerten Fahrzeugen vor dem Rundfunk- und Fernsehgebäude Stellung bezogen und begann, auf die Protestierenden in der Malia-Straße vorzurücken. Doch der Widerstand jener Schutzlosen gegen ihre Peiniger ließ sich weder durch Patronenregen noch durch Tränengas brechen. Es war, als würden sie dem Tod nicht länger gehorchen. Jedes Mal, wenn ein Verletzter verarztet worden war, kehrte er in den Kugelhagel zurück. Ich erinnere mich, dass die Sicherheitskräfte gerade ihre dritte Tränengasgranate abgefeuert hatten und dutzende Protestierende bewusstlos am Boden lagen. Ich weiß nicht wie, aber ich rollte eine Straße hinab, die an einer Stelle plötzlich abschüssig wird. Ich erinnere mich nur noch an Mahas Hand, die sich inmitten von Rauchschwaden und Kugelhagel nach mir ausstreckte. Mit einem Mal stand auch ich wieder auf meinen Füßen: zwischen Maha, Riham, Yasmine und anderen Mitdemonstrantinnen. Gemeinsam schrien wir gegen die Arroganz des Regimes und die Barbarei der Sicherheitskräfte an.
Würde zieht oft Unterdrückung nach sich, zum Beispiel wenn das Regime den Menschen das Demonstrationsrecht verweigert oder Protestcamps niederbrennt. Dann kann man sie kaum noch fassen. Doch selbst inmitten solchen Unrechts scheint es, als erschüfen die Menschen die Würde mit ihren bloßen Körpern neu.
Ich erinnere mich an den 19. Mai 2011, einen Sonntag. Sonnenuntergang. Der Himmel über dem Freiheitsplatz war mit Wolken aus Tränengas verhangen. Ich konnte weder meine Füße noch die Gesichter der Flüchtenden sehen. Körper kollidierten als alle um ihr Leben liefen. Panische Schreie betäubten meine Ohren, der Platz der Freiheit hatte sich in ein Schlachtfeld verwandelt, auf dem die Truppen des Regimes die unbewaffneten Protestierenden angriffen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Protestcamp in einer unausgesprochenen Übereinkunft mit den Sicherheitskräften mehr als vier Monate lang bestanden. Diese hatten gepanzerte Fahrzeuge nördlich des Südeingangs postiert und so eine bis zu diesem Tag gültige Grenze zwischen den beiden Parteien markiert. Aber dann wurden einige Demonstrant/innen zu einem Sicherheitsposten vor dem Eingang des Platzes gelockt – der Startschuss zum Niederbrennen des Protestcamps war gegeben. Kugeln flogen kreuz und quer, Tränengas mischte sich in dem Qualm des Feuers, das die Schlafzelte der Protestierenden zu Dutzenden verschlang. Die verbleibenden Zelte wurden von Planierraupen des Militärs dem Erdboden gleichgemacht. Der Sicherheitsausschuss der Reformpartei ergriff derweil die Flucht und die Führungsfiguren der Parteien, die vor Kurzen noch über Redezeit auf der Bühne gestritten hatten, taten es ihm gleich.
Nur ein paar Protestierende hielten bis zum Schluss die Stellung. Ich erinnere mich an einen alten Mann, der stur vor seinem Zelt die Nationalflagge schwenkte und sich weder von den Planierraupen noch von den in seine Richtung feuernden Sicherheitskräften beeindrucken ließ. Stoisch stand er da, stolz wie der letzte Wächter der Freiheit, umgeben von Rauch und Flammen, inmitten von Schüssen und den Schreien der Flüchtenden.
Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, war nur noch Asche vom Protestcamp übrig und die Soldaten der Anti-Terror-Einheiten führten ihre massiven Körper auf dem verwüsteten Platz spazieren. Derweil nahmen Polizeihunde die Spur der Protestierenden auf. Bald schon umzingelten Sicherheitskräfte eine verlassene Schule, in der sich einige junge Männer versteckt hatten. Ich sah sie, wie sie einen der Protestierenden fesselten, zu Boden warfen und auf ihn eintraten. Doch dieser Körper, der sich unter ihren Tritten wand, stand wieder auf und brüllte Parolen gegen das Regime. Er hörte auch nicht auf, als ihn ein Soldat mit aller Kraft ohrfeigte. Die auf ihn gerichteten Gewehre schien er nicht wahrzunehmen.
Würde ist stark und kennt kein Erbarmen, wenn sie die ängstlichen Schritte auf ihrem Weg vorwärts zwingt.
Ich erinnere mich an den Morgen des 3. Juni 2011. Es war ein Freitag und der Tag des Jüngsten Gerichts schien angebrochen. Die Straßen waren gesperrt, die Geschäfte geschlossen und die Märkte menschenleer. Nirgendwo eine Spur von Leben. Taizz hatte sich in eine Geisterstadt verwandelt, in der kein Geräusch zu hören war außer dem Bellen der Hunde und den Lautsprecherdurchsagen der patrouillierenden Anti-Terror-Einheiten, die die Bewohner/innen dazu aufforderten, in ihren Häusern zu bleiben und Demonstrant/innen zu melden. Auf Haupt- und Nebenstraßen waren gepanzerte Fahrzeuge des Militärs, Mannschaften der Sicherheitskräfte und Wasserwerfer stationiert, wobei letztere neben heißem Wasser auch Chlor und Tränengas versprühen konnten. Am Eingang des Platzes der Freiheit standen zwei gepanzerte Fahrzeuge der Armee; Soldaten der Anti-Terror-Einheiten hinderten die Bewohner der an den Platz angrenzenden Gebäude daran, ihre Häuser zu verlassen.
Als ich gemeinsam mit einigen Demonstrantinnen aus dem Haus meiner Schwester trat, hielt uns ein Soldat auf und fragte, wohin wir wollten. Bis heute ist mir unklar, wie es uns gelungen ist, an ihm vorbeizukommen; wie wir es schafften, uns trotz der Checkpoints, der Sicherheitskräfte und der gesperrten Straßen zum Hotel Deluxe in der Stadtmitte durchzuschlagen und dort gegen das Demonstrationsverbot des Regimes zu protestieren. Aber es waren nicht nur die Freundinnen gekommen, mit denen wir diesen Protest geplant hatten. Jede hatte ihre Mutter, Nachbarin, Freundin, Tochter oder andere Angehörige mitgebracht, so dass wir ein beeindruckendes Bild abgaben, als wir uns vor dem kanadische Sprachinstitut sammelten – also direkt neben dem Aufgebot des Sicherheitsapparats, das vor dem Hotel Stellung bezogen hatte. Nur zehn Meter trennten uns von den gepanzerten Militärfahrzeugen, dem Wasserwerfer und den Mannschaften der Bereitschaftspolizei.
Die Frauen begannen, Parolen gegen das Regime zu rufen, woraufhin die Soldaten das Feuer eröffneten, was die Demonstrantinnen aber nicht einschüchtern konnte. Nach dem Niederbrennen des Protestcamps hatten sie vorerst keine weiteren Demonstrationen mehr gewagt. Aber nun hatten sie die Angst überwunden. So trauten sich nun auch einige junge Männer, sich ihnen anzuschließen. Die Soldaten und Sicherheitskräfte begannen, in Richtung der Demonstrierenden zu schießen. Tränengaskartuschen flogen. Ich weiß noch, wie sie sich gerade noch in die angrenzenden Gassen und Gebäude retteten. Mehr als zehn Frauen versteckten sich in einem Gebäude neben dem Restaurant „Aden“. Der Gedanke an das Zischen der Kugeln, das Bellen der Hunde und die Schreie der Demonstrantinnen versetzt mich auch jetzt noch in Panik. Nach einer Weile umstellten Sicherheitskräfte und Soldaten der Anti-Terror-Einheit das Gebäude, in dem sich die Frauen versteckt hielten, und belagerten es über drei Stunden. Die Polizei forderte die Frauen über Lautsprecher auf, die Tür des Gebäudes zu öffnen, sonst würden sie sie aufbrechen. Die Schlagstöcke und Militärstiefel setzten der Tür, hinter der sich die Frauen verschanzt hatten, schwer zu. Letztlich wurde sie von innen geöffnet, nachdem es einer der Frauen gelungen war, freies Geleit für die Demonstrantinnen und Demonstranten zu verhandeln. Hinter der Tür bildeten die Frauen einen menschlichen Schutzschild und verwehrten den Sicherheitskräfte damit den Zutritt. So sollten die Demonstranten auf dem Dach genügend Zeit gewinnen, um über die angrenzenden Häuser zu fliehen. Bis heute erinnere ich mich an die Flüche, mit denen einer der Soldaten die Frauen bedachte, während sie das Gebäude erhobenen Haupts verließen: „Und ihr versteckt sie noch, ihr Huren!“
Wenn einmal entgegen aller Widrigkeiten ein Wunder geschieht, leuchtet die Würde aus den Gesichtern.
Ich erinnere mich an den Nachmittag des 4. Juni 2011. Es war ein Samstag, die Stadt bebte unter dem Einschlag von Granaten und in der Ferne war Lärm zu hören. Die Kräfte von Präsident Saleh lieferten sich gerade mit Stammeskriegern und Revolutionären ein Gefecht. Überall in der Stadt wimmelte es von gepanzerten Militärfahrzeugen und Soldaten der Anti-Terror-Einheit.
Mehr als zwanzig Frauen demonstrierten an diesem Tag friedlich gegen die Militarisierung der Revolution. Sie sammelten sich in der Wadi-al-Qadi Straße. Von den dortigen Soldaten ließen sie sich nicht einschüchtern, auch nicht, als diese das Feuer eröffneten. Dann begann ein Panzer auf die Demonstrantinnen zuzurollen, woraufhin sich ihm eine junge Frau namens Sabreen in den Weg stellte. Während der Panzer sich weiter in ihre Richtung bewegte, setzte sie sich auf den Boden und erhob ihre Hände wie eine griechische Göttin, die den Tod herausfordert. Angesichts ihrer Entschlossenheit zog sich der Panzer zurück.
Nach diesem Ereignis schickten die Sicherheitskräfte Polizistinnen vor, um die Demonstration zu zerstreuen. Uniformierte Frauen verfolgten mit Schüssen und Schlagstöcken die Demonstrantinnen, diese flüchteten sich in die Moschee, in Internetcafes oder die nahen Wohnhäuser. Ich weiß noch, wie ich durch eine Straße rannte, die nie zu enden schien. Als ich mich kurz umblickte, sah ich eine Polizistin, die eine Demonstrantin schon fast eingeholt hatte. „Renn!“ schrie sie, und ich rannte. Ein Anwohner rief mir zu, ich solle links abbiegen, dort würden sich einige Demonstrantinnen in einem Haus verstecken. Das letzte was ich sah, bevor ich seiner Anweisung folgte, war die Hand der Polizistin, die nach der flüchtenden Frau griff.
Wenig später sah ich sie in der Seitenstraße, die ich genommen hatte. Die Knöpfe ihres Oberteils waren abgerissen, ihre Unterwäsche war teilweise zu sehen. Sie trug kein Kopftuch mehr und ihre Haare flogen wild herum, während sie wie verrückt schrie. Nachdem es anderen Frauen gelungen war, sie zu beruhigen, strich sie ihre Kleider glatt und ging zurück auf die Straße – um weiter gegen das Regime zu skandieren.
Wenn diejenigen fallen, die nach Freiheit gerufen hatten, und sie nicht mehr erleben, dass ihre Träume sich verwirklichten, dann wird Würde zu Verlust und zu Trauma. Den Augenzeugen ätzen die Getöteten die Kapitel der Tragödie für immer ins Gedächtnis.
Ich erinnere mich an den Morgen des 11. November 2011. Es war ein Freitag und Mörsergranaten schlugen reihenweise im Gebäude der Gesundheitswissenschaften am Platz der Freiheit ein. Überall in der Stadt war Gefechtslärm zu hören und die meisten Demonstranten hatten den Platz verlassen, da dieser seit zwei Tagen unter ständigem Artilleriebeschuss stand.
Trotz des Bombardements machten sich an diesem Morgen einige Männer und Frauen auf den Weg, um das Freitagsgebet auf dem Platz zu verrichten. Manche huschten an den niedrigen Mauern entlang, während sich andere über schmale Seitengassen herbeischlichen. Ich ging zu dem Ort, den die Islamisten später den protestierenden Frauen zuteilen würden. Die zerfetzte, blaue Plastikplane zitterte im kalten Novemberwind, der über den Platz wehte. Mehr als zehn Frauen hatten sich hier versammelt. Tuffaha al-Antari, Zainab al-Adini und Yasmine al-Asbahi nahmen ihre gewohnten Plätze auf den Stufen des Sinan-Hotels ein, die sich im Gebetsbereich der Frauen befanden. Sie ließen sich weder von den Einschlägen der Granaten noch vom Geschrei der Demonstranten beeindrucken. Zainab und Yasmine lehnten ihren Oberkörper an die Wand des Hotels während Tuffaha die Demonstrantinnen dazu aufforderte, standhaft zu bleiben. Dann krachte eine Granate in das Hoteldach, Splitter flogen durch die Gegend und überall war Rauch. Die Männer rannten panisch davon und auch der Imam, der gerade noch auf der Bühne Standhaftigkeit gepredigt hatte, suchte das Weite. Tuffaha, Zainab und Yasmine hingegen nahmen wieder ihre Plätze auf der Hoteltreppe ein.
Ich war gerade ein wenig abseits gegangen, um etwas mit meiner Freundin Ibtisam zu besprechen, als die zweite Granate im Hotel einschlug, nur zielte sie diesmal auf die Frauen im Gebetsbereich. Als ich mich umdrehte, sah ich die Körper vom Tuffaha, Zainab und Yasmine reglos am Fuße der Treppe liegen. Die Flagge, die Tuffaha Sekunden früher noch geschwenkt hatte, war nun mit ihrem Blut getränkt.
Würde ist machtvoll, wenn sie einen letzten Versuch unternimmt, ihren Traum zurückzugewinnen. Wenn sie ihre Stimme erhebt gegen das Bündnis derer, die ihre Revolution geplündert und ins Gegenteil verkehrt haben. Selbst dann, wenn sie keiner mehr hört.
Ich erinnere mich an den Morgen des 20. Dezember 2011. Es war ein Samstag, als sich die Demonstranten und Demonstrantinnen unter der Führung von Mohammed Sabr auf den Weg machten, um in sechs Tagen von Taizz nach Sanaa zu laufen. Diese schmächtigen Gestalten wollten es nicht nur mit der Kälte und dem Hunger aufnehmen. Auch den Kugeln der regimetreuen Soldaten, die sie in den Bergen, Tälern und Städten, durch die der Protestmarsch führte, erwarteten. Tausende Jemenitinnen und Jemeniten, darunter Senioren ebenso wie Kinder, nahmen diesen beschwerlichen Weg auf sich. Dabei skandierten sie immer wieder, was sie sich wünschten: Freiheit. So hallen ihre Stimmen noch immer nach, wie ein Echo der Hoffnung, die in ihren Herzen loderte. Der Millionenmarsch zog weiter und in jeder Stadt schlossen sich noch mehr Demonstrant/innen an. Die Frauen, die vor den Reihen der Männer marschierten, boten einen unvergesslichen Anblick. Gemeinsam bildeten sie den Marsch des Lebens.
Als diese friedliche Prozession Hiziz, einen Vorort von Sanaa, erreichte, wurde sie von Gewehrsalven und Tränengas empfangen. Die Menge zerstreute sich, brach aber bald schon wieder auf, ihren Traum zu verwirklichen. An diesem Tag wurden dutzende Demonstranten getötet und hunderte verletzt. Unter ihnen war ein junger Mann, Anfang zwanzig, der sechs Tage lang der Dezemberkälte trotze, als er barfuß und treuherzig seinem Traum folgte. Das Bild seiner aufgerissenen Füße hat sich für immer in mein Gedächtnis eingeprägt.
Würde hat unzählige Formen. Aber zehn Jahre nach dem Ausbruch der jemenitischen Revolution habe ich einen bitteren Geschmack im Mund, sobald ich mich an den Glanz erinnere, der nun verloschen ist. All die Menschen, die für sie gestorben sind!
Sich daran zu erinnern, tut weh. Nicht nur, weil die Revolution keines ihrer Ziele erreicht und sich stattdessen in einen Krieg verwandelt hat, der bis heute so viele Jemeniten und Jemenitinnen das Leben kostet. Auch, weil viele der Revolutionäre, die damals Freiheitsparolen gerufen haben, heute zu Warlords geworden sind. Im Höllenfeuer dieses Konflikts wurden sie neu geboren: als Händler, Diebe oder Sprachrohre für die Kriegsparteien und die Regionalmächte, die um ihr Land kämpfen.
Bei aller Enttäuschung über das Scheitern der jungen Revolution, die wie jede Revolution ihre Licht- und Schattenseiten hatte, bleibt der Traum doch bestehen – auch wenn ich ihn mir gerade genauso wenig vorstellen kann, wie ich einen Lufthauch zu packen vermag. Aber eigentlich weiß ich es ja: Dieser Traum ist so glaubwürdig und integer, wie all jene, die an ihn geglaubt haben, aber seine Früchte nicht ernten konnten.
Autorin: Bushra al-Maktari (*1979) ist eine jemenitische Schriftstellerin und lebt in Sanaa. 2013 erhielt sie den François-Giroud-Preis für das Verteidigen von Rede- und Pressefreiheit (Paris) sowie den Leadership in Democracy Award (Washington). 2020 wurde sie mit dem Johann-Philip-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit ausgezeichnet.
Übersetzung aus dem Arabischen: Mirko Vogel, überarbeitet von Sandra Hetzl. Mirko Vogel, Jahrgang 1983, studierte Mathematik, Arabistik und Konferenzdolmetschen in Aleppo, Beirut, Berlin und Leipzig. Er arbeitet er als freiberuflicher Übersetzer und Dolmetscher und lebt mit drei Kindern in Frankfurt. Außerdem ist er ist Mitbegründer von Mahara, einem Dolmetsch- und Übersetzungskollektiv.
Kuration: Sandra Hetzl (*1980 in München) übersetzt literarische Texte aus dem Arabischen, u.a. von Rasha Abbas, Mohammad Al Attar, Kadhem Khanjar, Bushra al-Maktari, Aref Hamza, Aboud Saeed, Assaf Alassaf und Raif Badawi, und manchmal schreibt sie auch. Sie hat einen Master in Visual Culture Studies von der Universität der Künste in Berlin, ist Gründerin des Literaturkollektivs 10/11 für zeitgenössische arabische Literatur und des Mini-Literaturfestivals Downtown Spandau Medina .
Dieser Beitrag ist Teil unserer Serie „Blick zurück nach vorn“. Anlässlich von zehn Jahren Revolution in Nordafrika und Westasien schildern die Autor/innen dabei aus verschiedensten Kontexten, was sie hoffen, wovon sie träumen, was sie sich fragen und woran sie zweifeln. In ihren literarischen Essays wird deutlich, wie wichtig die persönlichen Auseinandersetzungen sind, um politische Alternativen zu entwickeln, und was jenseits der großen Ziele erreicht wurde.
Mit dem anhaltenden Kampf gegen autoritäre Regime, für Menschenwürde und politische Reformen beschäftigen wir uns darüber hinaus in multimedialen Projekten: In unserer digitalen scroll-story „Aufgeben hat keine Zukunft“ stellen wir drei Aktivist/innen aus Ägypten, Tunesien und Syrien vor, die zeigen, dass die Revolutionen weitergehen.
[1] Anm. d. Übersetzerin: Der Staudamm von Ma'rib wurde in der Mitte des 1. vorchristlichen Jahrtausends gebaut. Er galt als größtes technisches Bauwerk der Antike und Wunder Arabiens.
[2] Anm. d. Übersetzerin: Kath ist eine berauschende, besonders im Jemen stark verbreitete Droge, die aus den Blättern des Kathstrauches besteht, die man zerkaut.