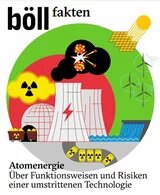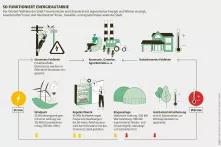Seit bald zwei Jahren wird kein Strom aus Atomenergie mehr in Deutschland produziert. Manche halten dies für einen Fehler. Doch nicht nur die Gesetzeslage oder Sicherheitsrisiken sprechen gegen einen Wiedereinstieg, sondern vor allem die immensen Kosten für Atomenergie, die um ein vielfaches höher sind als für Erneuerbare Energien. Das zeigen auch unser neues Faktenheft über Atomenergie und der aktuelle World Nuclear Industry Status Report.

Im kommenden Jahr jährt sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 40. Mal, die von Fukushima zum 15. Mal. Und auch 63 Jahre nach der ersten Nutzung von Atomenergie in Deutschland gibt es noch immer keine Lösung für den hochradioaktiven Müll. Erst kürzlich stellte das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung fest, dass ein Standort hierfür nach derzeitigem Vorgehen frühestens im Jahr 2074 feststehen wird. Die Sicherheitsrisiken und Ewigkeitslasten der Atomenergie sind also offensichtlich – doch was oft übersehen wird, sind die Kosten und wirtschaftlichen Fallstricke der Atomenergie.
Ökonomisch stellt ein Wiedereinstieg in die Atomenergie ein Himmelfahrtskommando dar. Unser neues Faktenheft über Atomenergie zeigt anschaulich: Alle AKW-Neubauten in westlichen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten wurden zum finanziellen Desaster – Bauzeiten und -kosten sind explodiert. Nur ein Beispiel: Die Kosten für Europas größten Reaktor in Finnland stiegen von den geplanten knapp 4 Milliarden US-Dollar auf über 12 Milliarden. 2023 ging das AKW ans Netz – nach 17 Jahren Bauzeit. Ganz abgesehen davon, dass es kaum Fachkräfte und Baufirmen für AWK-Neubauten gibt. Der aktuelle World Nuclear Industry Status Report 2024 zeigt, dass Russland das einzige Land ist, das derzeit im großen Stil AKWs in anderen Ländern baut.
Atomstrom ist also rund dreimal teurer als Strom aus Erneuerbaren Energien.
AKW-Neubauten sind außerdem nur mit staatlichen Abnahmegarantien und Subventionen möglich – bei Stromgestehungskosten 1, die mittlerweile um ein Vielfaches höher sind als bei den Erneuerbaren Energien. Im Jahr 2024 kostet eine Megawattstunde (MWh) Strom aus neuen Atomkraftwerken (AKW) etwa 182 US-Dollar, aus Windenergie 50 US-Dollar und aus Solarenergie 61 US-Dollar. Atomstrom ist also rund dreimal teurer als Strom aus Erneuerbaren Energien. Beispiel Frankreich: Unser Nachbarland rühmt sich günstigen Atomstroms, doch der Preis ist künstlich gedrückt. Staatliche Subventionen halten die Stromtarife niedrig, während Gutachten zeigen, dass die tatsächlichen Kosten um 75 Prozent höher liegen – teurer als der europäische Durchschnitt und künftig wohl kaum noch wettbewerbsfähig. Gerade erst korrigierte der Pariser Rechnungshof seine Preisschätzung für den Atomstrom aus dem neuesten AKW Flamanville um 60 Prozent nach oben – und warnte die Politik eindringlich vor den unkalkulierbaren finanziellen Risiken weiterer Neubauten.
Was noch hinzu kommt: Das künftige erneuerbare Energiesystem wird stark wetterabhängig sein und braucht Flexibilitäten, um die wetterbedingten Schwankungen der Stromerzeugung auszugleichen. AKW sind aber unflexibel und daher nicht gut als Ergänzung zu Erneuerbaren geeignet. Die hohen Investitionskosten von AKW machen einen flexiblen Betrieb mit Drosselungen oder Abschaltungen extrem teuer. Um die Klimaziele zu erreichen, ist nicht nur der Rückgang der Emissionen entscheidend, sondern auch die Effizienz. Das heißt es muss die größtmögliche Emissionsminderung pro Euro und Jahr erreicht werden. Es gibt wesentlich günstigere, flexiblere und weniger gefährliche Optionen als AKW, um die Schwankungen der Erneuerbaren auszugleichen. Zum Beispiel Batteriespeicher oder wasserstofffähige Gaskraftwerke.
Die Nutzung von Atomenergie macht von Russland abhängig, denn der russische Staatskonzern Rosatom übernimmt einen großen Teil der Urananreicherung und Brennelementlieferung für europäische AKW.
Auch in Serie gefertigte Kleinstreaktoren, sogenannte SMR, werden an den Problemen der Atomenergie wenig ändern. Unser Faktenheft zeigt: Sie sind unzuverlässige Zukunftsmusik. Bislang gibt es noch kein AKW, das auf diese Weise hergestellt wurde und auch keine industrielle Produktionskapazität dafür. Bisherige Prototypen waren umgerechnet auf ihre Größe noch teurer als heutige AKW und konnten nicht schnell gebaut werden. Zudem muss mit Blick auf jegliche Nutzung von Atomenergiefestgestellt werden: Die Nutzung von Atomenergie macht von Russland abhängig, denn der russische Staatskonzern Rosatom übernimmt einen großen Teil der Urananreicherung und Brennelementlieferung für europäische AKW. Bezeichnend ist die Tatsache, dass die Atomenergie auch nach vielen EU-Sanktionspaketen gegen Russland weiterhin von den Sanktionen ausgenommen ist.
Führt man sich all diese Fakten vor Augen, ist es kaum verwunderlich, dass die Atomenergie weltweit an Bedeutung verliert, wie der World Nuclear Industry Status Report 2024 zeigt: 1996 betrug ihr Anteil an der weltweiten Stromproduktion noch 17 Prozent, 2023 nur noch 9 Prozent. Dieser Trend wird sich fortsetzten, denn der Großteil der bestehenden AKW ist alt. In vielen Ländern gibt es kaum Pläne für Ersatz, sodass es zwangsläufig zu einem Rückgang kommt. Mit unserem Faktenheft stellen wir die Hintergründe dieser Entwicklung dar: Atomenergie ist teuer, unsicher und umweltschädlich und kann nicht mit den Erneuerbaren mithalten.
Wer für günstige Energie und eine bezahlbare Energiewende eintritt, kann kaum ernsthaft für Atomkraft sein. Statt also immer wieder eine Debatte über eine abwegige Rückkehr zur Atomenergie zu führen, ist unsere Zeit und Energie besser darin investiert, die weltweite Energierevolution vorne mitzugestalten.
Hier geht es zur englischen Fassung des Reports.
Veranstaltungstipp: Öffentliche Deutschland-Vorstellung des Reports am 25. Februar von 16.00 bis 18.00 Uhr in Berlin.
Fußnoten
- 1
Stromgestehungskosten umfassen die Kosten für den Bau, den Betrieb, die Wartung und den Brennstoff der Energiequelle und zeigen, wie teuer oder günstig diese ist.