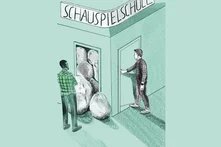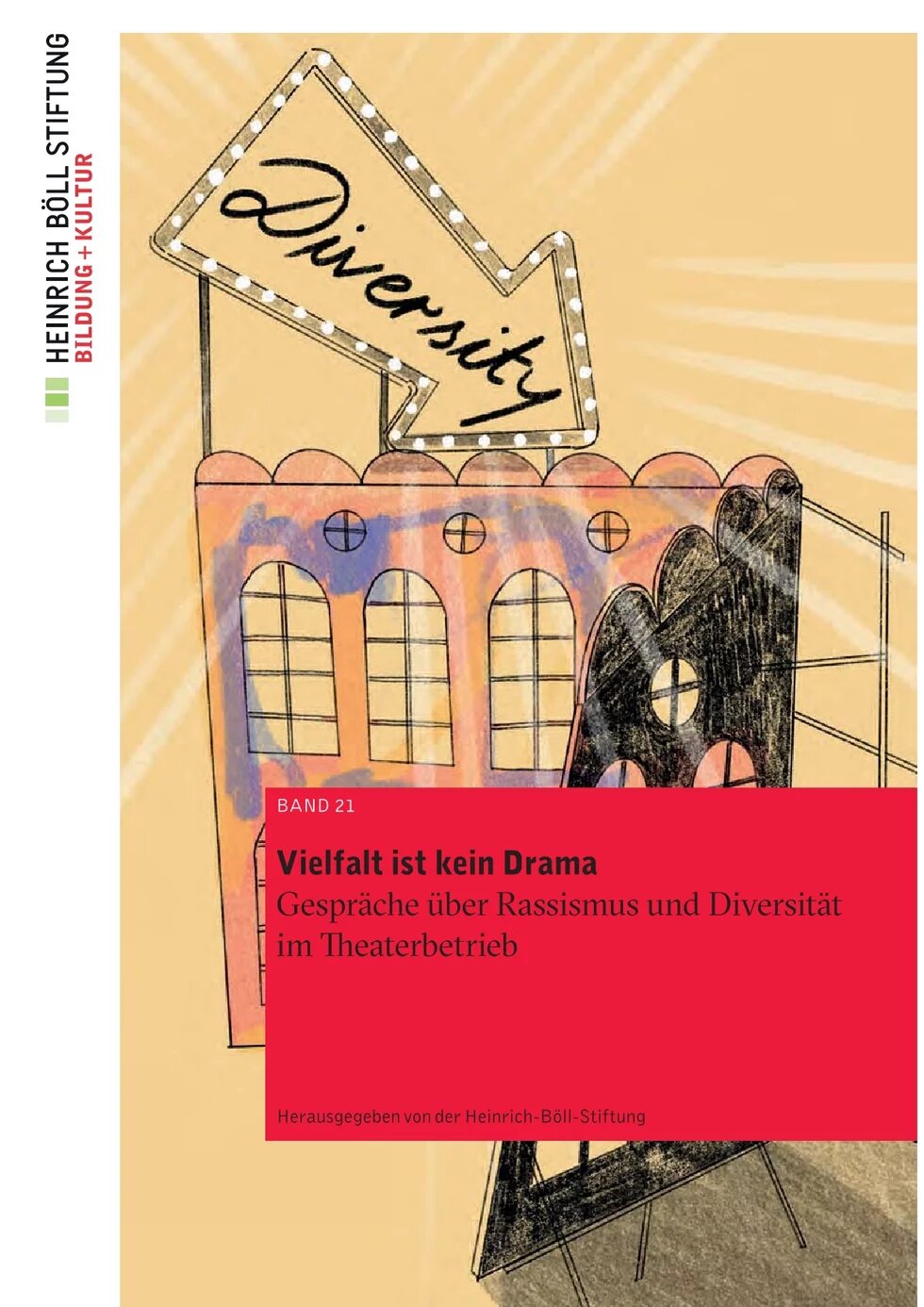
Prof. Dr. Joy Kalu lehrt im Fachbereich Darstellende Kunst an der Universität der Künste in Berlin. Bei ihren Studierenden beobachtet sie ein zunehmend diskriminierungskritisches Bewusstsein und auch mehr Mut, im Unterrichtsraum Machtgefälle zu reflektieren.

Das Gespräch führte Prof. Elizabeth Blonzen, Max-Reinhardt-Seminar Wien
Berlin, Sommer 2024. Prof. Dr. Joy Kalus Büro in der Universität der Künste. Hell, nicht sehr groß, sparsam möbliert. Ein Arbeitsraum, ohne Schnickschnack und mit viel Platz für Kreativität. Man fühlt sich sofort wohl. Wir springen so schnell ins Gespräch, dass wir den Kaffee vergessen, den wir uns eigentlich in der Kantine holen wollten.
Joy, wie bezeichnest du dich selbst?
Meine Selbstbezeichnung ist Schwarz, ich bin eine Schwarze deutsche Dramaturgin und Theaterwissenschaftlerin.
Wie verlief dein Werdegang?
Mein Werdegang ist ein doppelter, ich arbeite in der Theaterpraxis und -theorie. Manchmal ließ und lässt sich beides vereinen, meist wechseln sich beide Felder ab. Gleich nach dem Abitur habe ich als Regiehospitantin gearbeitet und wurde dann als Regieassistentin und Souffleuse angestellt, zuerst am Oldenburgischen Staatstheater, dann in Hamburg am Thalia Theater. Anschließend habe ich an Theatern in den USA wie der Actors' Gang in Los Angeles und später der New Yorker Wooster Group assistiert, später dann vor allem als Dramaturgin gearbeitet.
Hast du studiert?
Ja, Theaterwissenschaft und Nordamerikanistik. Ich habe das Studium allerdings für meine Arbeit an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz unterbrochen, dort bei Christoph Schlingensief und Carl Hegemann hospitiert und in einer Produktion von Frank Castorf mitgespielt, «Der Meister und Margarita». Die Volksbühne habe ich dann wieder hinter mir gelassen, um mein Studium fortzusetzen und noch in Theaterwissenschaft zu promovieren. 2017 bin ich zurück ans Theater gegangen und war bis 2023 leitende Dramaturgin an den Sophiensaelen.
Aktuell bist du wieder in der Lehre tätig und unterrichtest Theatertheorie an der Universität der Künste Berlin. Was sind deine Schwerpunkte?
Meine Schwerpunkte waren und sind das experimentelle Gegenwartstheater in Deutschland und den USA. In meiner Postdoc-Phase habe ich vermehrt machtkritische Fragestellungen in Anlehnung an Queer-Theorie und an Denkfiguren der Postcolonial Studies in meine wissenschaftliche Arbeit einbezogen, insbesondere in die Aufführungsanalyse. Dazu gehört auch, die Methoden des Fachs zu hinterfragen und an ihrer machtkritischen Weiterentwicklung zu arbeiten. Außerdem habe ich mich vermehrt mit experimentellem Theater aus Schwarzer Perspektive auseinanderzusetzen begonnen, als Dramaturgin, aber auch wissenschaftlich.
Wie definierst Du Rassismus?
Rassismus folgt einer Lehre, die Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale abwertet und angreift. Diese Merkmale wurden früher willkürlich zur Kategorisierung nach vermeintlich unterschiedlichen Races genutzt. Rassistisches Verhalten bedient sich stereotypisierender Sprache und stereotypisierender Codes oder folgt den Logiken diskriminierender Abwertung, die ihren Ursprung im Kolonialismus haben und im deutschen Kontext außerdem nicht unabhängig von der Ideologie der Nationalsozialisten zu denken sind.
Was ist dein Aufgabenbereich an der UdK?
An der UdK habe ich eine Gastprofessur für «Theorie der Performativen Künste» inne. Und da es an der UdK kein theoretisch ausgerichtetes Studium gibt, unterrichte ich in verschiedenen Fächern des Fachbereichs Darstellende Kunst. Aktuell biete ich Seminare in Bühnenbild, Szenischem Schreiben und im Darstellenden Spiel an, nächstes Semester werde ich auch im Fach Schauspiel unterrichten.
Was sind die Inhalte?
Die Seminare sind von Fach zu Fach unterschiedlich. In allen Studiengängen unterrichte ich gern Aufführungsanalyse, weil ich es wichtig finde, über das aktuelle Theater ins Gespräch zu kommen. Ich gebe momentan ein Fachwissenschafts-Seminar in Darstellendem Spiel. Dabei geht es um eine Einführung in aktuelle Diskurse des Theaters. Ich vermittle Methoden, Theater zu analysieren, diskutiere aber auch machtkritische Theorien, mit denen wir Aufführungen, Inszenierungen und Vermittlungsstrategien konfrontieren. Es geht mir immer darum, Repräsentationsfragen und Repräsentationslogiken sowohl auf der Bühne als auch im ganzen Apparat des Theaters zu beleuchten.
Welchen Unterschied siehst du zwischen dem Theater und der Lehre?
Die politische Situation schafft momentan in beiden Feldern ein Bedrohungsszenario. Sowohl in der Kultur, als auch in den Wissenschaften sind besonders die machtkritischen Initiativen von Kürzungen betroffen oder bedroht. Rechte politische Tendenzen setzen sich vermehrt durch, was man auf lokaler, aber zunehmend auch auf Bundesebene an kulturpolitischen Entscheidungen sehen kann. Ausgerechnet in Zeiten größter politischer Instabilität wird in Kultur wie Wissenschaft an der Förderung demokratiebildender Programme gespart. Gleichzeitig wird in den öffentlichkeitswirksamen Bereichen von Theaterwissenschaft und insbesondere von Theatern gerade sehr auf das Schlagwort Diversität gesetzt – zumindest in den Großstädten.
Diversität bleibt nur ein Schlagwort?
Wenn es um vermeintliche Diversität geht, steht meist nur die Programmgestaltung der Kulturinstitutionen, beziehungsweise die Ausrichtung von Lehrveranstaltungen und Tagungen im Fokus. Das führt weder zu fairen Arbeitsbedingungen, noch zu künstlerischen Freiheiten für PoCs. Im Theater werden viele Darsteller*innen of color leider immer noch entlang ihrer Identitäten gelabelt – mit wenigen Ausnahmen wie dem Maxim Gorki Theater. Die Stadt- und Staatstheater setzen sie gerne ein, um das vermeintlich Andere zu repräsentieren. In der freien Szene werden PoC-Künstler*innen oft als Expert*innen ihrer eigenen Diskriminierungserfahrungen gebucht und leider auf diese Narrative festgelegt. Das heißt, sie sollen das kulturelle Kapital der Häuser und Dramaturgien steigern, indem sie sich wieder und wieder mit Rassismus und Rassismuserfahrungen auseinandersetzen. In das wirklich spannende Theatergeschäft der Fiktion dürfen sie aber nicht einsteigen.
Siehst du irgendwo Veränderungen zum Positiven?
Es gibt hier und dort Versuche. In den Sophiensælen haben wir an solchen Transformationsprozessen gearbeitet und Programm und Strukturen aufeinander bezogen. Und natürlich gibt es durch die Arbeit am Gorki jetzt auf der Ebene eines Staatstheaters große Sichtbarkeit für PoC-Künstler*innen, -Spieler*innen, -Regisseur*innen und -Autor*innen, die inzwischen auch an andere Häuser und in andere Kontexte weiterziehen. Punktuell wurde also schon wichtige Aufbauarbeit geleistet. Die führt wiederum dazu, dass die Schauspielschulen nachziehen und das Potenzial breiterer Repräsentation erkennen. Es ist etwas in Bewegung. Aber überwiegend sehen wir in der Theaterlandschaft immer noch die klischeehaften Festschreibungen von Theatermenschen of color.
Gibt es viele PoC-Lehrende?
In der deutschsprachigen Theaterwissenschaft kenne ich mit Azadeh Scharifi lediglich eine Kollegin of color, die sich Repräsentationsfragen aus politischer Perspektive widmet. Es mag andere Kolleg*innen der jüngeren Generation geben. Aber aktuell sind wir als promovierte Kolleg*innen, die konsequent und gestaltend in rassistische Strukturen eingreifen, allein auf weiter Flur.
Woran liegt das? Und wie, glaubst du, ließe es sich ändern?
Die Probleme sind struktureller Natur, aber hinter diesen Strukturen stehen natürlich auch Menschen, die sie verantworten, aufrechterhalten oder bestenfalls bearbeiten. Ich glaube, es herrscht nach wie vor eine große Angst vor Mitarbeiter*innen of color in Entscheidungspositionen. Nicht unbedingt eine Angst vor uns individuell, aber doch vor den Themen, die wir vermeintlich ins Haus tragen. Die Themen sind ohnehin längst da, insbesondere unter den Studierenden. Vermutlich werden wir Kolleg*innen of color aus einer weißen Angst verhindert, sich mit eigenen Denkmustern und Privilegien zu konfrontieren.
Hast du ein Beispiel aus deiner Praxis?
Ich selbst habe mich zum Beispiel an der UdK für eine Professur qualifiziert. Ich konnte die Berufungskommission und die externe Begutachtung überzeugen und bin auf dem ersten Listenplatz gelandet. Vermeintlich eine sichere Sache. Aber dann hat der Berliner Senat in einem Akt, den ich als rassistisch bezeichnen würde, meinen Ruf auf die Professur verhindert. Die Berufungskommission hat mit Verweis auf die diskriminierenden Dimensionen dieser Verhinderung Widerspruch eingelegt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Daraufhin wurde das Berufungsverfahren eingestellt, und ich fülle die Professur seitdem zeitlich begrenzt als Gast aus.
Bist du mit Kolleg*innen konfrontiert, die finden, die Quote an PoCs sei doch mittlerweile erfüllt?
Solche Kolleg*innen sind mir bisher nicht begegnet. Vielleicht auch, weil ich zum Beispiel an der UdK in keinem Kollegium direkt verankert bin, sondern in ganz unterschiedlichen Fächern des Fachbereichs Darstellende Kunst unterrichte. Aber ich höre leider regelmäßig Beispiele von rassistischen Vorfällen in Unterrichtskontexten. Und in der Theaterwissenschaft habe ich es des Öfteren erlebt, dass ein großes Schweigen herrscht, sobald ich Diskriminierungserfahrungen anspreche. Emotional ist mir sehr präsent, dass die Themen rassistischer Diskriminierung im Wissenschaftsbetrieb nicht ausreichend vorkommen und es für mich als Schwarze Lehrende keine Räume gibt, mich über Erfahrungen auszutauschen. Reaktionen auf Hinweise und Änderungsvorschläge bleiben aus, oder es wird abgelenkt.
Wie gehst du damit um?
Mit der Enttäuschung gehe ich um, indem ich mir vor Augen führe, dass ich im Bereich des Freien Theaters und der Theaterwissenschaft wichtige Pionierinnenarbeit leiste und sich der Kampf in für Veränderungen in den langsamen Apparaten des Theaters und der Wissenschaft lohnt. Zum Glück habe ich einen schönen Ausgleich in meinem privaten Umfeld. Energie tanke ich in Kontexten, in denen ich mich selbst, politische Zusammenhänge und Repräsentationsfragen nicht ständig erklären muss.
Werden von Studierenden Probleme mit anderen Dozierenden im Zusammenhang mit Rassismus an dich herangetragen? Und falls ja, entstehen dadurch Konflikte für dich, weil du einerseits Teil des Lehrkörpers, andererseits selbst PoC bist?
Diskriminierungsfälle werden oft und regelmäßig auch über Bande an mich herangetragen. Selbst wenn mich Studierende noch nicht persönlich kennen, finden ihre Wünsche nach Austausch oder Unterstützung den Weg zu mir. Aus ganz verschiedenen Fächern wenden sich Studierende mit ihren Erfahrungen von rassistischer oder queer-feindlicher Diskriminierung an mich, bitten mich zum Beispiel um Beratung zu ihren Projekten oder möchten mich als Mitglied in ihren Prüfungskommissionen. Den Konflikt der Doppelrolle, den du beschreibst, kenne ich auch. Zum einen ist es natürlich für mich persönlich belastend, von all diesen Vorfällen zu hören. Andererseits hatte ich selbst keine Ansprechpersonen of color in meinem Studium – und in Erinnerung an die eigene Einsamkeit fühle ich die Verantwortung, für diese Studierenden da zu sein.
Was dann vermutlich unbezahlte Antirassismus-Arbeit ist?
Kürzlich wurde ich gefragt, ob ich offiziell als Ansprechpartnerin in Diskriminierungsfragen für Studierende fungieren könnte. Der Wunsch nach einer Ansprechperson außerhalb des Lehrkörpers im eigenen Fach kam von den Studierenden. Ich habe mich aber gegen diese Funktion entschieden, als ich erfahren habe, dass sie als Ehrenamt gedacht war. Ich hätte in Form einer Sprechstunde Zeit und sehr viel Kraft in diese Arbeit investiert, ohne an anderer Stelle entlastet zu werden. Außerdem hätte ich in der besagten Doppelrolle mit Sicherheit mein Verhältnis zum Kollegium belastet, weil manche mich als «Polizei» gefürchtet hätten. In einem diverser aufgestellten Kollegium würde sich die Arbeit gut auf mehrere Schultern verteilen lassen, und es gäbe eine ganz andere Diskriminierungssensibilität im Team.
Wo hast du an der Uni Solidarität erlebt?
In der Theaterwissenschaft habe ich immer wieder kollegiale Unterstützung, aber wenig Solidarität in Bezug auf meine Rassismuserfahrungen erlebt. Meine Karriere lief glatt, solange ich keine strukturelle Kritik geübt habe. In dem Moment, wo ich Veränderungswünsche anbrachte, kam aber weder von übergeordneten Kolleg*innen noch von Kolleg*innen auf meiner Ebene Solidarität. Heute bin ich überrascht, wenn ich mir die Lebensläufe der Kolleg*innen ansehe und plötzlich alle zu machtkritischen Fragestellungen arbeiten: Sie verfolgen dekoloniale Strategien, setzen sich mit Barrierefreiheit auseinander, queeren den Kanon. Menschen ohne Diskriminierungserfahrung, die sich nie politisch positioniert, geschweige denn engagiert haben, schreiben sich jetzt Diversität auf ihre Fahnen, weil «Diversitätskompetenz » als Skill bei Bewerbungen abgefragt wird.
Und wie ist es am Theater?
An den Sophiensælen hatte ich ein sehr offenes Kollegium. Wir haben gemeinsam feministische und queer-feministische Fragestellungen und zunehmend auch den Abbau von Barrieren für behinderte Künstler*innen, das Publikum und das Kollegium verfolgt. Wir haben auch als erstes Haus der Freien Szene die von Julia Wissert und Sonja Laaser entwickelte Anti-Rassismus-Klausel in die Verträge mit den Künstler*innen implementiert, angepasst für unsere Kontexte. Es gab den ernstgemeinen und in Teilen erfolgreichen Versuch, strukturelle Veränderungen herbeizuführen, bei dem wir als Kollegium an einem Strang gezogen haben. Aber Solidarität ist natürlich nochmal was anderes. Eine konkrete Unterstützung in Bezug auf meine Rassismuserfahrungen habe ich an weißen Institutionen oder Kollegien leider noch nicht erlebt.
Woher nimmst du deine Kraft?
Aus der Begeisterung fürs Theater, der Zeit mit meiner Familie und meinem Freundeskreis, gutem Essen, Erholung, Natur – also all den schönen Dinge, die es natürlich auch gibt. Die Benachteiligung und Mehrarbeit, die sich für mich aus rassistischen Begegnungen und Ereignissen ergibt, überschattet vieles. Dass mir eine Professur vorenthalten wurde, für die ich mich eindeutig qualifiziert hatte, hat mich sehr mitgenommen. Außerdem gab es in den vergangenen zwei Jahren zwei rassistisch motivierte, tätliche Angriffe auf mich und mein Kind hier in Berlin. Rassismus verschärft sich nicht nur im Kultur- und Universitätsbetrieb, sondern auch im Alltag. Es gibt Phasen, in denen sich meine Kraft als endliche Ressource zeigt.
Hast du das Gefühl, die Generation, die du unterrichtest, ist bewusster als die zu deiner eigenen Studienzeit?
Ja. Das liegt auch daran, dass zum Teil schon im schulischen Kontext eine machtkritische Auseinandersetzung mit bestimmten Themen stattfindet. Zum Beispiel wird Kolonialismus im Unterricht inzwischen differenzierter vermittelt und ist endlich auch Teil öffentlicher Debatten um Erinnerungskultur und Restitutionen. Auch über Social Media ist die jüngere Generation mit Repräsentationsdiskursen und intersektionalen Fragen nach Gerechtigkeit und Zugangsbarrieren sehr viel vertrauter. Es gibt ein viel größeres diskriminierungskritisches Bewusstsein und auch mehr Mut, im Unterrichtsraum Machtgefälle zu reflektieren: Was passiert gerade hier vor Ort? Unter uns?
Das ist eigentlich das Wichtigste.
Aktuell kommt es bei der Frage nach dem Umgang mit dem Nahost-Konflikt leider auch in Unterrichts- und Hochschulkontexten zu Spaltungen, die einen Dialog verhindern. Das ist bedauerlich. Ich hoffe, dass wir diese Lagerbildungen perspektivisch wieder auflösen und miteinander sprechen und arbeiten können. In meiner Generation und den noch älteren Generationen wird zwar vieles theoretisch erkannt, aber nur zögerlich in Protest und Veränderung übersetzt. Ich glaube, viele junge Studierende haben besser gelernt, für sich einzustehen, auf Machtgefälle zu reagieren, auch Worte für ein Unbehagen zu suchen, das sie vielleicht noch nicht genau benennen können. Alles in allem bin ich einigermaßen hoffnungsvoll.
Was sollte sich konkret ändern? Hast du eine Wunschliste?
Was uns alle, die wir uns fürs Theater engagieren, mal geeint hat, ist doch die Freude am Erzählen, die Freude an der Fiktion. Auch daran, neue Welten und Rollen zu entwerfen und zu verkörpern. Der Weg dahin führt weg von einer vermeintlichen Diversität, die sehr oberflächlich bleibt und leider oft zu Festschreibungen statt Freiheiten geführt hat – und hin zu einer großen Öffnung und einem umfassenden Abbau von Barrieren. Ich wünsche mir also vor allem, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven am Theater eine größere künstlerische Freiheit erfahren und wieder ins Erzählen und ins Spiel kommen.
|
Das Interview ist ein Auszug aus dem Band „Vielfalt ist kein Drama. Gespräche über Rassismus und Diversität im Theaterbetrieb“. Erschienen im April 2025 in der Reihe „Schriften zu Bildung und Kultur“ der Heinrich-Böll-Stiftung, Band 21.
|
Prof. Dr. Joy Kristin Kalu hat an der FU Berlin Theaterwissenschaft und Nordamerikastudien studiert und forschte für ihre Dissertation an der New York University. Sie arbeitete als Dramaturgin, Kuratorin und Theaterwissenschaftlerin an verschiedenen Kulturinstitutionen in Deutschland und den USA. Von 2017 bis 2022 war sie leitende Dramaturgin an den Berliner Sophiensaelen. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen die Ästhetik des experimentellen Gegenwartstheaters im deutschsprachigen Raum und in Nordamerika, Critical Whiteness und Dekoloniale Strategien sowie das Spannungsfeld von Theater und Therapie.