Friedrich Merz und Emmanuel Macron haben jeweils immer wieder angekündigt, Europas Sicherheit zur Priorität zu machen und Russlands Aggressionen entschiedener entgegen zu treten. Doch eingehalten wurden diese Ankündigungen nicht. Europa braucht jetzt eine Verteidigungsunion, die diesen Namen auch verdient.
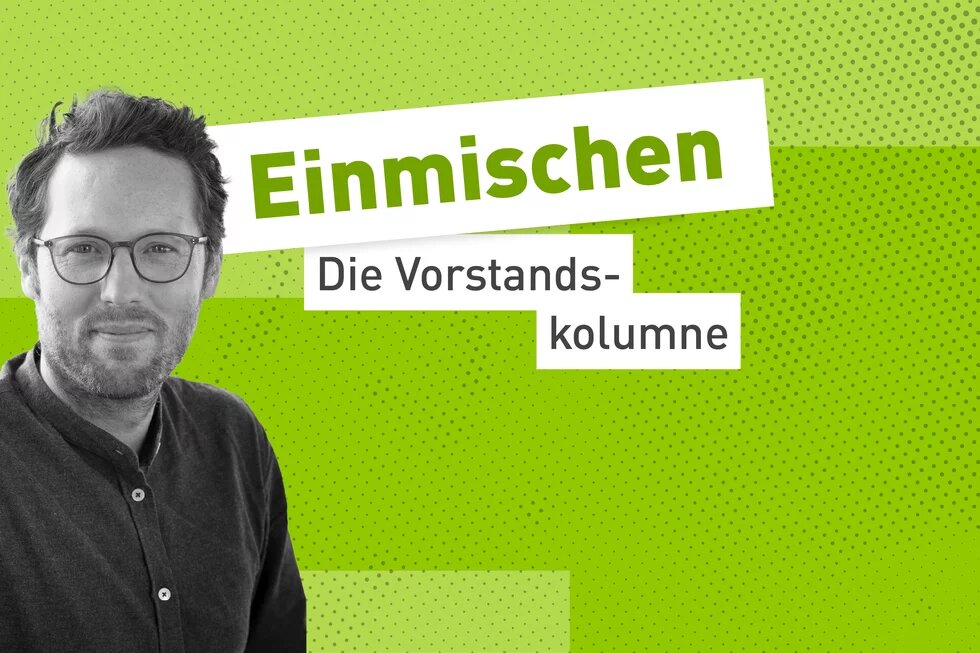
War was? Acht Monate ist es her, dass der US-amerikanische Vizepräsident JD Vance mit seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Europäern die Illusion geraubt hat, auf die USA als Sicherheitsgarant sei weiterhin Verlass. Doch, statt diese Zeit zu nutzen, um – jetzt aber wirklich – in großem Stil in eine unabhängige europäische Sicherheitsarchitektur zu investieren, wie vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wiederholt versprochen, verheddern sich Europas Staats- und Regierungschefs zunehmend in innenpolitischen Querelen und nehmen in den zentralen geo- und sicherheitspolitischen Auseinandersetzungen immer öfter auf der Zuschauerbank Platz. Daran ändert auch der aktuelle Vorstoß der EU-Kommission für einen Drohnenwall nur wenig.
Erschreckenderweise überlassen sie US-Präsident Donald Trump nun offenbar selbst bei der Ukraine-Unterstützung die Führungsrolle. Dem Mann, der den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nun bereits zum zweiten Mal vor der Weltöffentlichkeit gedemütigt hat. Strategische Unabhängigkeit von den USA, die sich Länder wie Grönland einverleiben und absehbar beachtliche Truppenkontingente aus Europa abziehen wollen? Systematische Koordinierung europäischer Streitkräfte und Abwehrfähigkeiten mit Blick auf die immer schärfer werdenden Kriegsvorbereitungen und Aggressionen Russlands im Ostseeraum? Fehlanzeige. Vielmehr entsteht der Eindruck, Europa habe die Ablenkung durch die Trumpsche Waffenruhe in Nahost zum Anlass genommen, sich wieder dem business as usual zuzuwenden. Ein fataler Fehler.
Gemeinsame Europäische Streitkräfte schaffen
Auf der außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung Ende September machte der ehemalige ukrainische Außenminister, Pavlo Klimkin, deutlich, dass Europa im Konflikt mit Russland nicht nur seine Abwehrfähigkeiten verbessern, sondern seine ganze Mentalität ändern müsse. Damit trifft er den Kern des Problems. Wir befinden uns längst in einer neuen Epoche und brauchen dementsprechend epochalere Veränderungen als bloß einen Vierstufenplan mit Blick auf die Personalrekrutierung bei der Bundeswehr. Selbst ein Hans-Werner Sinn erklärt jetzt – übrigens im Einklang mit dem jahrelangen Grünen-Programm - dass es der Schaffung gemeinsamer Europäischer Streitkräfte unter Abschaffung der nationalen Armeen bedürfe.
Nach über zwei Jahrzehnten europäischer Flickschusterei müssen jetzt nun endlich die großen Würfe der Europäischen Einigung realisiert werden. Eine neue Analyse unserer Stiftung, die in Kürze veröffentlicht wird, zeigt, wie die europäische Verteidigungsarchitektur mittlerweile zu einem Flickenteppich aus 200 bilateralen Verteidigungspartnerschaften angewachsen ist. Die aktuellen Entscheidungen zur Drohnenabwehr vertiefen diese Parallelstrukturen eher noch weiter. Dabei hatten sich bereits 1952 die Staats- und Regierungschefs der damaligen Gründungsstaaten der Europäischen Gemeinschaften auf eine Verteidigungsgemeinschaft geeinigt, die nur nie realisiert wurde. Wann, wenn nicht jetzt, ist der Moment gekommen, diese Idee endlich in die Tat umzusetzen?
Europa muss seine gemeinsamen Kräfte stärker bündeln
Für die Staaten der Europäischen Union steht nicht weniger als ihre Existenz als unabhängige, freie und demokratische Republiken auf dem Spiel. Viel zu lange wurden entschiedene Schritte zur stärkeren Bündelung der gemeinsamen Kräfte als eigenständiger Block in der Welt versäumt. Zu Lasten der Interessen von uns Bürgerinnen und Bürgern. Und der Zukunft unserer Kinder in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Das Versprechen Europas droht zu zerbröseln, zerrieben zwischen den autoritären und der europäischen Idee feindselig gegenüberstehenden Akteuren in Moskau, Washington D.C. und Peking.
Die Gründung einer europäischen Verteidigungsunion, die diesen Namen auch verdient, wäre ein Befreiungsschlag und eine Machtdemonstration, die den Menschen in Europa wieder Hoffnung geben würde: auf gemeinsame Selbstwirksamkeit in diesen unsicheren Zeiten. Sie wäre aber vor allem der realistische und notwendige Schritt, um ein glaubwürdiges Zeichen der Verteidigungs- und Handlungsbereitschaft an Russland und in die Welt auszusenden.
Verbunden mit dem ausgestreckten Arm gegenüber all jenen Ländern auch außerhalb der Europäischen Union, die einem solchen Projekt beitreten und engere Bündnisse mit Europa eingehen möchten. Verbunden auch mit dem Signal nach innen, dass die Handlungsfähigkeit der Europäischen Ebene nicht an der Einstimmigkeit eines Europäischen Rates und damit an der Zustimmung eines Viktor Orbán hängt. Angesichts der großen Investitionsbedarfe und der Verantwortung für die Sicherheit der Partner in Europa – allen voran der Ukraine –, bedarf es jetzt echter Führungsstärke. Diesen mutigen Schritt sollten einige zentrale europäische Staaten gehen, darunter neben Deutschland und Frankreich auch Polen, Großbritannien, Italien und Spanien. Eine erste sinnvolle Maßnahme wäre die Schaffung eines europäischen Sicherheitsrates, um bereits auf dem Weg in die Verteidigungsunion Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Nie standen solche epochalen Veränderungen zuvor in Koalitionsvereinbarungen – immer waren sie angewiesen auf mutige Staatslenkerinnen und Staatslenker. Jetzt ist der Moment, Herr Merz und Herr Macron.
