Wenn Menschen Ökosysteme zerstören, darf das nicht folgenlos bleiben. Die EU hat nun anerkannt, dass großflächige Umweltzerstörung strafbar sein kann. Jetzt hat Deutschland die Chance, mit einem Ökozid-Gesetz Verantwortung zu übernehmen – und Vorbild zu werden.
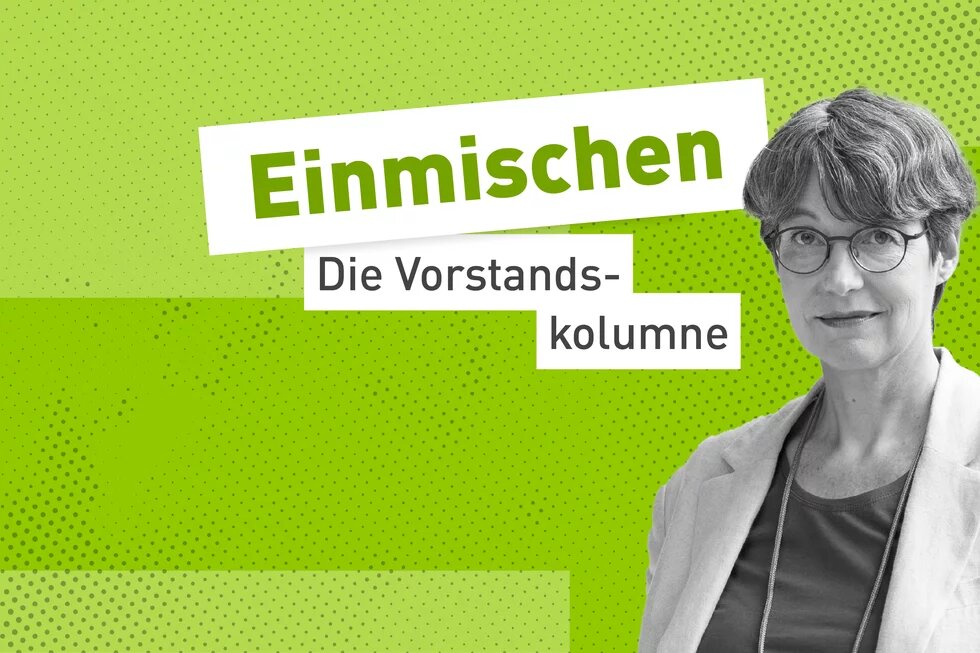
Wenn Wälder brennen, Flüsse vertrocknen und Böden zu Wüsten werden, sprechen wir meist von Klimakatastrophen – selten aber von Verantwortung. Dabei ist die großflächige Zerstörung unserer Lebensgrundlagen kein bloßes Naturereignis, sondern oft auch das Ergebnis menschlichen Handelns. Der Begriff „Ökozid“ beschreibt genau das: die massive Schädigung oder Vernichtung von Ökosystemen durch Menschen – etwa durch Entwaldung, Umweltverschmutzung oder den Raubbau an natürlichen Ressourcen. Aber auch die Umweltzerstörung als Folge von Kriegen schließt der Begriff mit ein.
Europas Signal – und Deutschlands Chance
Mit der Reform des europäischen Umweltstrafrechts hat die EU 2024 erstmals anerkannt, dass solches Handeln strafrechtlich verfolgt werden kann. Für Deutschland ist das mehr als eine technische Rechtsanpassung: Es ist die Chance, Verantwortung zu übernehmen – mit einem eigenen Straftatbestand „Ökozid“, der klarmacht, dass der Schutz der Natur keine Frage des politischen Willens, sondern des Rechts ist. Und der als Gefährdungsdelikt ausgelegt wird.
Ein solcher Ansatz würde ermöglichen, auf Handlungen zu reagieren, die zu massiver Umweltzerstörung führen könnten – und zwar bevor sie eintritt. Das passt gut in die deutsche Rechtsordnung und hätte Vorbildfunktion in Europa und darüber hinaus. Ein aktuelles Gutachten des Ecologic Instituts belegt die rechtliche Umsetzbarkeit. Insbesondere in Zeiten, in denen Umweltschutz unter dem Schlagwort „Entbürokratisierung“ zurückgedreht wird, wäre das ein wichtiges Gegengewicht: wir hätten dann stärkere Leitplanken statt schwächerer Umwelt- und Menschenrechtsstandards.
Recht als Schutzschild für Mensch und Natur
Auch international hat das Thema an Fahrt aufgenommen. Neben EU-Parlament und Europarat diskutieren immer mehr Staaten über eine Verankerung des Ökozid-Straftatbestands im Völkerrecht. Schon in frühen Entwürfen des Rom-Statuts – Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs – war Ökozid als Straftatbestand vorgesehen. Deutschland könnte hier eine aktive Rolle übernehmen.
Ökozid-Recht kann nachhaltiges Wirtschaften fördern: Indem es klare strafrechtliche Standards schafft, schützt es Unternehmen, die verantwortungsvoll mit der Umwelt umgehen, während diejenigen sanktioniert werden, die auf Kosten der Umwelt handeln.
Doch über den juristischen Rahmen hinaus geht es um Verantwortung und globale Gerechtigkeit. Strafrecht dient nicht nur der Sanktion, sondern der Prävention – es signalisiert, was in einer Gesellschaft als untragbar gilt. Ein internationaler Straftatbestand gegen Ökozid würde die großflächige Zerstörung von Ökosystemen als das benennen, was sie ist: ein Angriff auf unsere Lebensgrundlagen.
