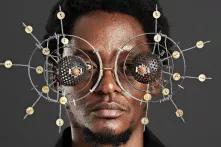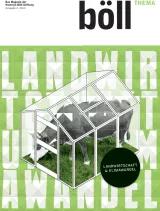Der Journalist und Autor Andrew Rice diskutiert in seinem Beitrag das Thema "Landkauf" und damit Möglichkeiten, in die Landwirtschaft zu investieren, ohne die lokale Bevölkerung zu verdrängen.
Eine Reihe von Faktoren wie etwa Spitzenpreise für Nahrungsmittel, Wasserknappheit oder das Wachstum der Weltbevölkerung haben einen riesigen Markt für Ackerland geschaffen. Reiche, aber ressourcenarme Nationen im Nahen Osten, in Asien und anderswo versuchen, ihre Nahrungsmittelproduktion an Orte auszulagern, wo Felder billig und reichlich vorhanden sind. Da rund 90 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche der Welt bereits genutzt wird, führt die Suche in diejenigen Länder, die bislang am wenigsten entwickelt sind. Eine der letzten großen Flächenreserven ist die 4 Millionen km2 große Guinea-Savannenzone, ein halbmondförmiger Streifen, der im Osten von Äthiopien und sich südlich bis in den Kongo und nach Angola erstreckt. Laut einer Studie werden derzeit nur zehn Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche dieser Zone tatsächlich dafür genutzt.

Perspectives Afrika: In dieser englischsprachigen Publikationsreihe wollen wir Fachleuten aus Afrika eine Plattform bieten, ihre Ansicht zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen ihrer Regionen zu veröffentlichen. Perspectives Africa legt dabei den Fokus auf Standorte im Süden, Osten und Westen des Kontinentes an denen die Heinrich-Böll-Stiftung mit Regionalbüros vertreten ist.
Ausländische Investorinnen und Investoren – manche vertreten Regierungen, andere private Interessen – versprechen, Infrastruktur anzulegen, neue Technologien wie verbessertes Saatgut einzuführen, Arbeitsplätze zu schaffen und die Produktivität untergenutzter Flächen zu steigern, sodass sie nicht nur Märkte in Übersee bedienen, sondern auch mehr Lebensmittel für Afrika produzieren. Verarmte afrikanische Regierungen empfangen solche Investoren mit allzu offenen Armen und bieten ihnen Land zu Schleuderpreisen an. Einige Transaktionen haben viel Aufmerksamkeit bekommen, etwa die Vereinbarung, dass Kenia knapp 40.000 Hektar im Gegenzug für die Finanzierung eines neuen Hafens an die Regierung von Qatar verpachtet, oder dass Südkorea fast 100.000 Hektar in Tansania entwickelt. Aber viele andere Transaktionen in quasi noch nie dagewesenem Maßstab sind ohne viel Aufhebens besiegelt worden.
Während die Befürworter solcher Investitionen ihre potenziellen Vorzüge für den Fortschritt der Landwirtschaft in Afrika südlich der Sahara preisen, schlagen manche Kritiker allerdings Alarm und verurteilen die Investitionen als „Landraub“. Sie behaupten, dass die Transaktionen ausbeuterisch sind, und sie sagen voraus, dass das Ergebnis nicht Entwicklung sein wird, sondern eine Reihe möglicher schlimmer Folgen: Fremdenfeindlichkeit, Unruhen, Staatsstreiche und mehr Hunger.
Theoretisch könnten Investitionen immense Kapitalrückflüsse generieren. In einem Land wie Äthiopien ist die Landwirtschaft extreme Knochenarbeit, aber der Weizenertrag pro Hektar ist nur ein Drittel dessen, was in Europa, China oder Chile geerntet wird. Sogar bescheidene Interventionen könnten dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Würde man modernere Gerätschaften, verbessertes Saatgut und Dünger einsetzen, könnte man den Weizenertrag in der Region des Großen Afrikanischen Grabenbruchs mit seinem reichen Lehmboden verdoppeln. Äthiopien, wie ganz Afrika, ist voll von solchen Gelegenheiten – Situationen, die kluge Investitionen verwandeln könnten, um Portemonnaies wie Bäuche zu füllen. Der Schlüssel, sagen viele Sachkundige, liegt darin, die Menschen in Afrika in den Prozess ihrer eigenen Entwicklung mit einzubeziehen.

Auf der Suche nach Informationen zu Afrika?
➢ Aktuelle Artikel, Publikationen und andere Veröffentlichungen zu und aus Afrika.
Was sollte man tun? Patentlösungen, die immer und überall passen, gibt es nicht. Aber Reformen können viel dazu beitragen, dass landwirtschaftliche Investitionen dem gegenseitigen Vorteil dienen.
Erstens: In Fachkreisen ist man sich über die entscheidende Bedeutung einig, dass man zunächst die Besitzverhältnisse klären muss, bevor Land in andere Hände übergeht. Gerade in Entwicklungsländern ist dies ein heikles Thema, denn dort wird ein beträchtlicher Teil des Landbesitzes nach traditionellen Bräuchen verwaltet, und zwar ohne schriftliche Dokumentation. Es ist wissenschaftlich belegt, dass die wirtschaftliche Produktivität von Land steigt, wenn die Besitzverhältnisse klar sind. Bei einer Weltbankkonferenz im April 2010 zum Thema Landrechte wurde betont, dass sogar rudimentäre Schritte, etwa die Anfertigung von Karten, die Grundbesitz darstellen, große Verbesserungen bewirken können, wenn es um die Interessen von Kleinbauern geht.
Zweitens: Die von landwirtschaftlichen Investitionen betroffenen Menschen müssen in freier Entscheidung ihre Zustimmung nach vorheriger Inkenntnissetzung geben. In der Praxis allerdings ist es leichter gesagt als getan zu bestimmen, was Zustimmung ausmacht und wie sie erlangt wird. Zum Beispiel im Fall Mosambik: Dort werden nur etwa 4 Millionen der 34 Millionen Hektar landwirtschaftlich nutzbares Land auch landwirtschaftlich genutzt, und die Regierung erklärte vor kurzem, dass sie Investitionen aus dem Ausland begrüßen würde. Sie richtete eine Politik der Konsultation mit den Gemeinden vor Ort ein. Aber die Gespräche verliefen schlecht, es gab unzureichende Informationen, und lokale Führer dominierten, sodass Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ausgeschlossen wurden. Es gab enorme Konfusion, die teilweise absichtlich herbeigeführt wurde. Manche Grundstücke wurden dreimal an verschiedene Investoren „verkauft“. Das System wurde letztlich von Chaos überwältigt.
Drittens: Es herrscht allgemein Übereinstimmung darüber, dass weitere Investitionen in die Landwirtschaft der ärmsten Länder der Welt erforderlich sind. Dazu gehört die Finanzierung der Infrastruktur, der landwirtschaftlichen Ausbildung sowie der Forschung, die im Laufe der letzten zehn Jahre in der Hälfte aller afrikanischen Staaten zurückgegangen ist. Allerdings sind die Entwicklungshilfebudgets vieler Gebernationen während der weltweiten Rezession stark beschränkt worden. Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer. Im Vergleich mit den Ländern des Nordens haben sich die Volkswirtschaften Afrikas recht gut geschlagen – der Internationale Währungsfonds hat einen Anstieg des Wirtschaftswachstums in Afrika südlich der Sahara vorhergesagt – und daher ist der Kontinent ein zunehmend attraktiver Ort für private Investitionen. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, in die Landwirtschaft zu investieren, ohne die Bevölkerung hinauszudrängen. David Hallam, Handelsexperte der FAO, hat ein Modell vorgeschlagen, bei dem große kommerzielle Farmen im Besitz internationaler Investoren in einer „symbiotischen Beziehung“ mit Kleinbauern arbeiten, die ihnen ihre Ernte verkaufen und im Gegenzug Geld, Darlehen und technische Unterstützung erhalten. Eine weitere Idee, die unterschiedliche, aber vielversprechende Ergebnisse in Ländern wie Sambia hervorgebracht hat, ist das Modell der „Vertragsbauern“, bei dem die gesamte Produktion auf kleinbäuerlicher Basis geschieht und ein größeres Unternehmen die Ware verpackt und im In- oder Ausland verkauft. In Äthiopien sind bei einem solchen genossenschaftlichen Projekt etwa 300 Menschen beteiligt, die jeweils 1,6 bis 4 Hektar bewirtschaften. Während des europäischen Winters bauen sie grüne Bohnen für den niederländischen Markt an. Ansonsten ziehen sie Mais und andere Feldfrüchte für den lokalen Konsum. Eine Gruppe Bäuerinnen und Bauern in dieser Kooperative sagten, dass das Arrangement zwar nicht perfekt sei, aber doch im entscheidenden Punkt Vorzüge hat: Sie arbeiteten als Selbstständige.
Andrew Rice ist Autor des Buchs The Teeth May Smile but the Heart Does Not Forget: Murder and Memory in Uganda. Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel, den er 2009 im New York Times Magazine veröffentlichte: „Is There Such a Thing as Agro-Imperialism?“