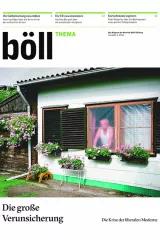![Skulptur Großer Dialog, Draht, Metall, Stoff, Epoxidharz, roter Lack, Größe 145x190x83 cm By Karel Nepraš (Národní galerie v Praze) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons](/sites/default/files/styles/var_desktop/public/uploads/2016/09/dialog.png.jpg?itok=9zrV7BC6)
Gerade in Zeiten, in denen vielerorts mit starken rechtspopulistischen Kräften zu rechnen ist, ist es wichtiger denn je, sich wehrhaft gegen die Gegner einer pluralen offenen Gesellschaft zu stellen. Wie die EU sich gegen undemokratische Entwicklungen in ihrem Inneren wehren kann.
Grundrechtsverletzungen sind in Europa nichts Neues. Man denke an so manchen Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz und der Medien in Italien und Frankreich, an staatliche Korruption und Klientelismus in Griechenland, Rumänien und anderswo. Das Vorgehen der nationalpopulistischen Regierungen in Ungarn und Polen hat allerdings eine neue Qualität.
Beide Regierungen treten offensiv für ein anderes, nämlich «illiberales» Demokratiemodell ein. Eine Mehrheitsherrschaft, die die plurale Gesellschaftsordnung mit kritischer Gegenöffentlichkeit und garantierten Minderheitenrechten infrage stellt. Dieses Ziel versuchen sie mit einem Staatsumbau zu erreichen, der die Freiheit von Verfassungsgerichtsbarkeit, Justiz und Medien nachhaltig einschränken soll. Inwieweit tangiert diese Entwicklung die Gemeinschaft der europäischen Staaten? Und wie soll sie darauf reagieren?
In ihrem Kern als Wertegemeinschaft bedroht
Die Europäische Union ist ein Verbund demokratisch verfasster Rechtsstaaten, eine Gemeinschaft von Demokratien. Beides ist Voraussetzung einer freiwilligen Integration. Nur die transparenten, oft schwerfällig wirkenden demokratischen Verfahren schaffen ausreichend Vertrauen in die übrigen Mitglieder des Staatenverbunds, das es den Nationalstaaten ermöglicht, ihr höchstes Gut– Souveränität– abzugeben. Der Staatenverbund der EU ist damit einzigartig in der Welt. Wird in einem Mitgliedstaat Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eingeschränkt, so trifft es die Gemeinschaft in ihrem Kern und bedroht die Grundlage ihres Miteinanders. Alle EU-Staaten haben deshalb ein hohes Eigeninteresse, dass die demokratische Rechtsstaatlichkeit nicht verletzt wird.
Gebundene Hände
Doch ist die Handhabe der EU als Staatengemeinschaft eingeschränkt. Denn anders als bei EU-Beitrittskandidaten, die die strengen Kopenhagener Kriterien erfüllen müssen, um Mitglied der EU zu werden, verfügt die EU über weniger schlagkräftige Instrumente, wenn es darum geht, undemokratischen Entwicklungen in ihren Mitgliedstaaten entgegenzutreten. Dies gilt umso mehr in Zeiten zunehmender Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten, die an den Grundfesten der EU rühren (Stichwort: Eurokrise, Migrations- und Asylpolitik, Umgang mit dem Austrittsbeschluss Großbritanniens). Auch angesichts der um sich greifenden EU-Skepsis ist die Legitimität der EU, gegenüber ihren Mitgliedstaaten zu intervenieren, eher geschrumpft als gewachsen.
Bislang nur wenig erfolgreich
Aussitzen, Dialog, Sanktionen ... So unterschiedlich die bisherigen Erfahrungen sind, so gemischt ist auch die Bilanz. Wenig erfolgreich, genauer: kontraproduktiv, war der erste Fall einer Intervention. Als im Februar 2000 die österreichische ÖVP eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ einging, beschlossen die übrigen 14 EU-Staaten, die bilateralen Kontakte zu Österreich auf Regierungs- und Arbeitsebene zu reduzieren. Es handelte sich zwar nicht um einen EU-Beschluss dagegen hätte Österreich ein Veto einlegen können. Auch richtete er sich nicht gegen akute Grundrechtsverletzungen, sondern war präventiv gefasst worden und wurde bereits nach einem halben Jahr wieder aufgehoben. Doch gilt dieser gescheiterte Versuch bis heute als abschreckendes Beispiel für Interventionen der EU gegenüber ihren Mitgliedstaaten in puncto Rechtsstaatlichkeit. Diese Erfahrung gilt neben der besonderen historischen
Belastung der deutsch-polnischen Beziehungen auch als Grund dafür, warum die Bundesregierung gegenüber der seit Herbst 2015 amtierenden polnischen Regierung mit besonderer Vorsicht agiert.
Als besonders anfällig für eine Politisierung hat sich das Europäische Parlament erwiesen. Dies zeigte sich im Falle Ungarns. Während die europäischen Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen Sanktionen forderten und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bei dessen Auftritten im Europäischen Parlament scharf kritisierten, stellte sich die Fraktion der Europäischen Volkspartei, der Orbáns Partei Fidesz angehört, weitgehend hinter diesen und wies die Kritik an der 2010 neu eingeführten ungarischen Verfassung zurück. Eine Zweidrittelmehrheit, notwendig für die Zustimmung zu Sanktionen, war ohne die Stimmen der großen EVP-Fraktion aussichtslos.
Artikel 7 EUV – Zu scharf zum Schießen
Dabei verfügt der EU-Vertrag über eine scharfe Waffe. Im Amsterdamer Vertrag von 1997, der die EU mit einer vertieften Integration auf die bevorstehende Erweiterung vorbereiten sollte, wurde in Artikel 7 erstmals ein Verfahren zur Aussetzung der Rechte eines Mitgliedstaats festgelegt (einschließlich der Stimmrechte im Rat), wenn dieser schwerwiegend und nachhaltig die vertraglich geschützten Grundwerte verletzt. Doch gilt es aufgrund der hohen institutionellen Verankerung und der sehr hochgelegten Hürden– Einstimmigkeit im Rat und Zweidrittelmehrheit im Europäischen Parlament– als unwahrscheinlich, dass dieser auch als «nuclear option» bezeichnete Artikel zur Anwendung kommt. Die Gefahr der politischen Eskalation wird als zu hoch eingeschätzt.
Dem Recht mit Recht zur Geltung verhelfen
Erfolgreichere Interventionen waren bisher allenfalls die entpolitisierten, oftmals komplizierten und bürokratisch wirkenden rechtlichen Verfahren. Abgeleitet von den erfolgreich erprobten Dialog- und Vertragsverletzungsverfahren des Binnenmarktes, bei denen der Europäische Gerichtshof (EuGH) angerufen wird, drohte die Europäische Kommission Ungarn nach der Staatsreform, die die Regierungspartei von Ministerpräsident Orbán im Jahr 2010 mit ihrer Zweidrittelmehrheit in nur wenigen Monaten umgesetzt hatte, mit der Eröffnung solcher Verfahren in vier Fällen, die über die gängigen wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten hinausgingen und Fragen der Grundwerte berührten. Es ging um die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragen sowie der Notenbank, vor allem aber der Justiz und der Medien. Gegen Änderungen des ungarischen Wahlrechts, die durch einen Neuzuschnitt der Wahlkreise die Chancen des regierenden Fidesz auf einen erneuten Sieg bei künftigen Wahlen erhöhten, hatte die Europäische Kommission hingegen keine Handhabe. Die Bilanz der Intervention der Kommission ist gemischt: Zwar änderte Ungarn das Mediengesetz und nach längerem Streit auch das Gesetz zur Notenbank, noch bevor die Kommission das Verfahren tatsächlich eröffnete. Insgesamt konnte die Kommission jedoch die autokratische Entwicklung in Ungarn nicht stoppen.
Frühwarnsystem als Schritt in die richtige Richtung?
Als Reaktion auf die Entwicklungen in Ungarn wurde 2014 ein dem Artikel 7 vorgeschaltetes Frühwarnsystem «zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit» eingeführt, das es der Europäischen Kommission erlaubt, mit dem betreffenden Mitgliedstaat einen Dialog aufzunehmen. Dieses EU-rechtlich nicht unumstrittene Frühwarnsystem ist politisch aber weniger heikel. Im Januar 2016 eröffnete die Europäische Kommission erstmals ein solches Vorverfahren gegen Polen. Die Kommission sah die von der Regierung und ihrer Parlamentsmehrheit angestrebte Entmachtung des polnischen Verfassungsgerichts als Verletzung der Grundwerte der EU. Ob sie damit erfolgreich sein wird, wird sich zeigen.
Stärkung der Selbstheilungskräfte im Land
Die EU gründet auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Doch diese zentralen Voraussetzungen ihrer Existenz kann sie nicht selbst schaffen. Auch ihre Mittel, die Einhaltung in den Mitgliedstaaten durchzusetzen, sind äußerst beschränkt. Dem Recht mit Recht zur Geltung zu verhelfen, ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Derzeit wird darüber diskutiert, jährliche Grundrechte-Berichte für alle Mitgliedstaaten einzuführen.
Die Reaktionen der polnischen und der ungarischen Regierung auf die Interventionen der Europäischen Kommission zeigen allerdings, dass rechtliche Verfahren allein wohl nicht helfen werden, wenn sich in einem Land große politische Mehrheiten für einen Demokratieabbau finden. Sie werden EU-Interventionen als unzulässige Einmischungen in ihre nationalen Angelegenheiten verurteilen. So war Orbán sehr erfolgreich darin, jegliche Kritik der EU als antiungarisch abzutun. Daher ist es ratsam, die in ihren Rechten und Freiheiten bedrohte Zivilgesellschaft transnational zu unterstützen, um so die Selbstheilungskräfte im Land selbst zu stärken. Denn nachhaltig können rechtsstaatliche Fehlentwicklungen letztlich nur durch neue politische Mehrheiten behoben werden. Gerade in Zeiten, in denen vielerorts mit starken rechtspopulistischen Kräften zu rechnen ist (man denke nur an Frankreich oder die Niederlande), ist es für das vereinte Europa wichtiger denn je, sich wehrhaft gegen die Gegner einer pluralen offenen Gesellschaft zu stellen.
Der Beitrag ist zuerst in unserem Böll.Thema 2/2016 "Die große Verunsicherung - Die Krise der liberalen Moderne" erschienen.