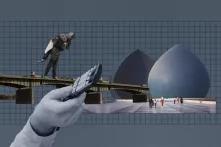„Zwischen Weltreichen und Supermächten, da leben wir, lachen und weinen.“ Avo Kaprealians Essay erzählt - portioniert in sieben Abschnitten, die er Ohrfeigen nennt - die Geschichte der Armenier/innen in Syrien, an deren Anfang und Ende jeweils ein Exodus steht.

Wenn ich heutzutage jemanden von „Freiheit“, „Gerechtigkeit“ oder „Menschenwürde“ reden höre, ist da jedes Mal eine Stimme in mir, die sich vordrängelt und fragt: Wer ist da eigentlich gemeint? Ich als Syrer? Ich als Armenier? Oder einfach nur ich als Mensch? Denn, so traurig es ist: Davon hängt doch jeweils ab, wie solche Worte einzuordnen sind. Meine Freiheit als Syrer ist nicht deckungsgleich mit meiner Freiheit als Armenier. Die Menschenwürde eines Tscherkessen ist nicht die gleiche wie die eines Kurden. Meine Rechte als Individuum variieren je nachdem, welche Staatsangehörigkeit, welchen Aufenthaltstitel oder welche Papiere ich besitze.
Klingt grausam? Mag sein, aber in einer Welt der Weltreiche und Supermächte ist das Realität.
***
Zwischen Weltreichen und Supermächten haben auch kleine Diktaturen ihren Platz. Klein bedeutet nicht, dass sie dadurch weniger Schaden anrichten würden. Die Länder, in denen solche Diktaturen herrschen, gelten schlicht als unwichtig. Da kann die Zahl ihrer Opfer in die Hunderttausende gehen, die Welt schaut seelenruhig dabei zu.
Zwischen Weltreichen und Supermächten kamen wir zur Welt. In Vierteln, die zwar eng waren, dafür aber aufregend, in denen man zwar segregiert lebte, dafür aber miteinander; so schien es uns zumindest damals, naiv, wie wir waren. Es war wohl eher ein Nebeneinanderherleben. Bisweilen waren unsere Lebenswelten so voneinander abgekapselt wie eine Sardinenbüchse von der anderen. Es war die Rede vom „Judenviertel“, vom „Armenierviertel“, vom „Sunnitenviertel“, vom „Alawitenviertel“, vom „Kurdenviertel“ und so weiter, und so fort. Wir warfen uns gegenseitig Allgemeinplätze und üble Zuschreibungen an den Kopf. Jeder feuerte sie von seiner Seite auf alle anderen ab, nur um wenig später selbst zur Zielscheibe zu werden: „Schnösel!“, „Penner!“, „Stinker!“, „Schuhputzer!“, „Schafhirten!“, „Blaublütler!“, et cetera.
Zwischen Weltreichen und Supermächten wandere ich umher. Ich, der ich nie Bürger eines großen Landes war. Ich wandere, nehme von jeder Etappe meines Weges etwas mit und lasse etwas dort zurück. In Syrien war ich Armenier, im Libanon syrischer Armenier, in Deutschland schließlich syrisch-libanesischer Armenier. Und so sammele ich unterwegs immer mehr Identitäten an, bis ich vielleicht eines Tages bei so etwas wie Internationalismus angelangt sein werde - obschon das heutzutage ja aus der Mode gekommen ist.
Früher wurde ich oft gefragt, ob ich Armenier oder Syrer sei, und, warum wir Armenier so sehr an Armenien hängen, wo wir doch qua Geburt Syrer seien. Das ist ein bisschen so, wie wenn man einen Syrer in Deutschland oder einem anderen Exilland fragt: Warum denkst du noch an Syrien? Warum sprichst du deine Sprache noch? Warum erinnerst du, trauerst du, träumst du, verfolgst du die Nachrichten? Warum hast du einen Kloß im Hals? Warum bist du so wütend?
Identität und Assimilation als unversöhnliche Gegenpole - gestern, heute und höchstwahrscheinlich auch noch morgen.
***
Das alles hat zur Folge, dass ich es nicht mehr mag, in der Ich-Form zu sprechen. Zu weit weg scheint mir das Ich mittlerweile in Zeit und Raum. Aber auch die Wir-Form behagt mir nicht. Denn das Wir ist jedes Mal ein völlig anderes, sobald man in ein neues Land kommt und sich dort niederlässt. Aber irgendwie muss man sich ja ausdrücken.
Also, ich. Ich kam als Armenier zur Welt, in Syrien, meinem Heimatland. Das ist weder eine hohle Phrase, noch naiver Kindermund. Es ist die Wahrheit. Zur Welt gekommen bin ich in einem Land, das mich mir selbst nähergebracht hat. Nur war da noch eine andere Heimat in mir. Eine, die mich schon kannte, bevor ich sie überhaupt kennen lernte. Eine, die als Erzählung überlebt hatte - spirituell, geistig, materiell: eine Erzählung vom Schweiße des Angesichts, von Beharrlichkeit und Blut; von Tränen der Trauer und Freude, die ineinanderfließen in der Erinnerung an Massaker und Rettung, an Löcher in der Zeit. Eine Erzählung, die aus der erstarrten Vergangenheit in unseren lebendigen Alltag hinüberstrahlt, bis hinein ins Gedächtnis der Körper und Augen. Eine armenische Erzählung, die mich seit meiner Geburt in Syrien, der „Wiege der Zivilisationen“, begleitet und geformt hat; mich, meine Sprache, meine Freundschaften, meine Erfahrungen und all die Sedimente längst vergangener Zeiten.
***
Aber jedes Mal, wenn wir größer werden in einem Land, wird es uns zu eng.
Und jedes Mal, wenn wir von einem Land träumen, wird es uns zum Albtraum. Beim Militär lehrte man uns, wie man das Land zu schützen und zu lieben habe, und die allererste Lektion, die man uns dort erteilte, lautete: unterwerft euch, lasst euch brechen, werdet zahm.
Jedes Mal, wenn wir durch ein Land ziehen, begeht die Zeit Verrat am Raum und es schneit uns ins Hirn.
Und jedes Mal, wenn wir die Erinnerung an ein Land pflegen wollen, versinken wir in düsteren Akten voller Angst und Blut, voller Luftangriffe und Verschleppungen.
***
Während wir Armenier/innen also unsere verlorene, verratene Heimat in unseren Innenwelten nachbauten, lernten wir in der Welt dort draußen ein Land schätzen, das uns herzlich aufnahm. Und so wuchs uns über unserer ersten Haut eine zweite.
Die Wurzeln des armenisch-syrischen Beziehungsgeflechts reichen bis tief in die Vergangenheit.
Historiker wissen zu berichten, wie die alten Syrer, überdrüssig der dynastischen Streitigkeiten innerhalb des Seleukidenreichs, im Jahr 83 v. Chr. dem armenischen Herrscher Tigranes dem Großen ihre Krone anboten. Dieser trug fortan den Beinamen „König der Könige“ und sollte zu einer der herausragendsten Figuren in der armenischen Geschichte werden.
Zweitausend Jahre waren vergangen, seit Tigranes durch Aleppo gezogen war, als Syrien 1915, dem Jahr des Genozids an den Armenier/innen, und in den Jahren danach eine Art umgekehrter Reminiszenz an Tigranes‘ Marsch erlebte. Nur kamen diesmal Vertriebene an, Deportierte und verstümmelte Leichen.
***
Die Frage der Assimilation: Armenier/innen älterer Generationen berichten mir von den Schulen, die es früher für die armenische Gemeinschaft in Syrien gab, an denen alle Fächer in armenischer Sprache unterrichtet wurden. Sie erzählten mir Geschichten von einfachen, braven Leuten, die nach dem Prinzip des gegenseitigen Respekts lebten. Das alles natürlich, bevor die Arabische Sozialistische Baath-Partei an die Macht gekommen war. Danach gab es nur noch den einen Erzähler, der die eine Erzählung erzählte. Und an die Stelle von Werten und Prinzipien trat nun das Gesetz des Stärkeren.
***
Generationen von Armenier/innen in Syrien wuchsen unter dem Einfluss eines epochalen Traumas heran. Eine Generation vererbte es an die nächste. Über das tägliche Erzählen, über Bücher, Fotos, und alle Arten von Aktivitäten brannte es sich ins kollektive Gedächtnis ein: Der Genozid an den Armenier/innen im osmanischen Reich. Dieses Ereignis war der Grund, weshalb die armenische Gemeinschaft sich ihr eigenes kleines Reich in Syrien einrichten musste: eigene Kirchen, eigene Betriebe, eigene Geschäfte und unzählige Clubs und Vereine. Räume, in denen sie von ihrem Recht, kulturell, sprachlich und als Gemeinschaft zu überleben, Gebrauch machten. Räume um sich zu erinnern und um einen Schmerz zu schützen, der noch nicht versiegt war. Was sie dabei jedoch nie einforderten, war das Recht, innerpolitische Belange zu verfolgen und politische Arbeit in Bezug auf Syrien oder Armenien zu machen.
So bildete sich innerhalb der armenischen Gemeinschaft ein Milieu, das diese wie eine Schutz-schale umschloss. Ein Schneckenhaus, das unter dem Einfluss der großen sprachlichen, religiösen und kulturellen Differenz immer härter wurde.
In einigen syrischen Städten wurde den Armeniern eine Sonderbehandlung zuteil, sowohl seitens der Regierung, als auch seitens der Bevölkerung. Es war eine positive Diskriminierung, freundlich, bisweilen sogar ehrlich warmherzig. Ein Aussondern, dem Respekt und Wertschätzung zu Grunde lagen. Dennoch, ein Aussondern war es, und seine Auswirkungen sollten sich später noch zeigen.
Vielleicht ist es ja so: So fremd man einer Heimat auch sein mag, ist man ihr am Ende doch so nah, wie das Grab dem Erdreich.
Chronik der Ohrfeigen
Erste Ohrfeige: Die Schule
Ich erinnere mich noch gut an einen Tag im Jahr 2000 in Aleppo. Wie wir uns, wie so oft, aus der Schule davonstahlen, um in der Stadt herumzustromern, auf der Suche nach Vergnügungen anderer Art. Wir wollten bummeln, dem Stadttreiben zusehen, essen, Leute kennenlernen und Abenteuer erleben. Spüren, dass wir am Leben waren, unserer überschäumenden Energie freien Lauf lassen. Wir hatten uns vorgenommen, pünktlich zum Unterrichtsende wieder in der Schule zu sein. Und so standen wir wenige Minuten vor dem Schlussgong vor dem Gebäude und warte-ten darauf, dass unsere Freunde und Freundinnen herausströmen würden - unter letzteren natürlich vor allem die besonders Hübschen, deren Blicke wir jederzeit zu erhaschen versuchten. Hormone flossen aufgeregt durch unsere agilen, lebenshungrigen Körper, als plötzlich ein Auto der Sittenpolizei auftauchte - einer Einheit, die über die Einhaltung der öffentlichen Moral wachte, vor allem was körperliche Annäherungen betraf. Ein monströs hässlicher Wagen, dessen not-dürftig über den Rost gepinselter Lack ins Rötliche tendierte. Alles an dem Gefährt war abstoßend und einschüchternd. Noch bevor wir es richtig wahrnahmen, ja bevor es überhaupt zum Stehen kam, sprangen schon einige Beamte heraus. Der Erste von ihnen versetzte mir eine Ohrfeige, durch die mir Hören und Sehen verging. Während in mir die Glückshormone den Stresshormonen das Feld überließen, begriff ich, dass ich auf der Welt war - und zwar ganz konkret in jenem Land. Jenem Land, das, wenn ihm gerade danach war, blitzschnell in etwas Beängstigendes umschlagen konnte.
Ich also schlug einen Haken und brachte mich in sichere Distanz, aber mein drei Jahre älterer Bruder widersetzte sich den Beamten und fing an, sich mit ihnen zu raufen. Irgendwann zerrten sie ihn in den Wagen, zusammen mit einem Freund von uns. Die Sache löste sich auf, als ich es schaffte, mir von jemandem ein Handy zu leihen und meinen Vater anzurufen. Der tätigte nur einen kurzen Anruf, der ausreichte, dass der Wagen auf halber Strecke wieder anhielt und meinen Bruder und unseren Freund freiließ. In jenem Land, in dem oft nur „ein Anruf genügt“, wäscht eine Hand die andere und der Rest ist Vitamin B.
Schock, Schande, Schlottern: „Ich fürchte mich, also bin ich.“
Schock, Schande, Schlottern: „Ich werde beschützt, also bin ich.“
Zweite Ohrfeige: Das Theater
Im Jahr 2005 arbeiteten wir an einem Stück namens Ewige Flamme. Wir wollten es anlässlich des 90. Jahrestages der großen armenischen Tragödie aufführen - den armenischen Genozid durch Deportation, Vertreibung und systematischen Mord, den die osmanische Regierung verübt hatte, genauer gesagt das Komitee für Einheit und Fortschritt, auch bekannt als die Jungtürken.
Wenige Tage vor der Aufführung, wir waren gerade bei den Endproben, erreichte uns die Nachricht: Die Theaterbehörde und alle anderen Stellen, die bei der Genehmigung von Theateraufführungen ein sicherheitstechnisches oder politisches Wörtchen mitzureden hatten, verboten die Aufführung. Warum, war ziemlich eindeutig: Zu jener Zeit waren die Beziehungen zwischen Recep Tayyip Erdogan und Baschar al-Assad noch ausgezeichnet. Letzterer stattete der Türkei zahlreiche Besuche ab, und sein türkischer Amtskollege war im Jahr 2007 bei der Eröffnungsfeier des Aleppo International Stadium im Hamdaniah-Bezirk zugegen - eines der größten Stadien in der arabischen Welt. Sein Bau hatte 27 Jahre gedauert, also etwa 9.700 Tage. Eigentlich hätte es schon zu den Mittelmeerspielen im Jahr 1987, bei denen Syrien Gastgeber war, fertig sein sollen!
Ich kann mich noch gut an den Gesichtsausdruck von Regisseur Krikor Kalash erinnern, einem der bedeutendsten Theaterregisseure und -dozenten in Syrien: Regungslos saß er da, mit seiner stummen Wut, seiner Scham und seiner Verzweiflung, die im Verborgenen brodelten. Kaum wahrnehmbar entfuhr ihm ein Fluch, doch biss er sich rechtzeitig auf die Zunge, während er abwechselnd in die Luft und auf den Boden starrte. Tief Luft holend versuchte er, sein Gleichgewicht wiederzuerlangen. Dann packte er kurzerhand seine Sachen zusammen und eilte aus dem Saal. Wir blickten einander ungläubig an. Geschah das alles gerade wirklich? Dann verließen auch wir den Saal und ließen Kalash damit im Stich. Wir hatten etwas dazugelernt.
Jetzt wussten wir, wie das ging: wie man den Schmerz in uns zum Schweigen verdonnerte und uns mundtot machte. Wir wussten nun, wie es aussah, wenn einer sich auf die Zunge zu biss, die Luft anhielt, ein wenig Dampf abließ - und sich dann aus dem Staub machte.
Als ich mich das letzte Mal mit dem Regisseur Krikor Kalash traf, arbeitete er als Lebensmittel- und Getränkelagerist in einem armenischen Club.
Krikor Kalash ist am 4. Februar 2019 in Aleppo verstorben. Er hatte es abgelehnt, nach Kanada auszuwandern. Seiner Ansicht nach waren die Antragsprozeduren und das Warten vor den Botschaftstoren keines Menschen würdig, eine Verhöhnung seiner elementarsten Rechte. So stand sein Beschluss fest: Er würde bleiben, wo er war, wie auch immer es ihm dort ergehen würde.
Dritte Ohrfeige: Das Kino
Nach und nach lernte ich Syrien besser kennen. Aleppo liegt weit ab vom Schuss, weit ab von allen anderen Provinzen und sogar von sich selbst. Aleppo ist groß, in Aleppo sind Geschichte und Gegenwart Schwestern. Und während sich mein Radius erweiterte, entwickelte ich eine fast schon obsessive Begeisterung für das Kino.
Ich wollte Filme machen, Film studieren. Nur wo? Eine Einrichtung, die auf Filmregie oder -produktion spezialisiert gewesen wäre, gab es nicht - keine Filmhochschule und kein Filminstitut in ganz Syrien!
Dann musste ich wohl ins Ausland. Dafür reichte aber das Geld nicht.
Also doch hierbleiben. Mir noch mehr Filme anschauen, statt selbst welche zu machen.
Wunsch und Wirklichkeit klafften meilenweit auseinander.
Zu einer Zeit, als es noch keine Satellitenschüsseln gab, war die Filmsammlung meines Vaters meine Rettung.
Schließlich ergab es sich, dass ich vom einzigem Institut in Syrien erfuhr, an dem man Theater stu-dieren konnte: dem Institute for Dramatic Arts in Damaskus. Die Entscheidung war schnell gefallen. Ich musste weg aus Aleppo, wieder einen Haken schlagen: Theater studieren, um zum Kino zu finden.
***
Bekanntlich legte das syrische Regime zu Beginn der 80er-Jahre eine besonders harte Gangart ein, die als „Eiserne Faust“ in die Geschichte einging. Tatsächlich sorgte sie für eine gewisse Gleichheit, diese Faust, denn sie bedrohte alle. Alle, außer natürlich, gottbewahre, die Reichen und die mit dem nötigen Maß an Vitamin B.
Hier nahm die Hölle ihren Anfang. Nach außen hin ruhig und friedlich, wurde der Druck im Kessel im Laufe der Jahre stetig höher. Trotz der Strenge des Regimes wurde unser Alltagsleben immer chaotischer. Dieses Chaos und die sich ankündigende Hölle bedingten einander sozusagen symbiotisch.
Nun birgt ja jede Hölle auch ein Höllenfeuer in sich - und Monster. Und Monster gebären be-kanntlich Monster, und Tod gebiert Tod, und Mord gebiert Mord.
Vielleicht sind wir, die in Syrien unter Assads Baath-Partei das Licht der Welt erblickt haben, - besonders alle ab Jahrgang 1980 - einfach als unfertige Leichen auf die Welt gekommen, als Todes-Rohmaterial. Mussten nur noch ein paar Jahrzehnte warten, bis wir endlich zu frischen Lei-chen herangereift sein würden, zu toten und untoten Märtyern.
Vierte Ohrfeige: Die Staatssicherheit
Anfang 2011: Demonstrationen, Revolution, Hoffnung und Angst.
Während meiner Jahre in Damaskus hatte ich das Glück, viele Menschen voller Träume und Wissen kennenzulernen, Dichter/innen, Denker/innen, Künstler/innen. Menschen, die die Grausamkeit des Regimes, das das Land bis in seinen letzten Winkel kontrollierte, am eigenen Leibe zu spüren bekommen hatten. Das Herz der Hauptstadt pulsierte förmlich vor oppositionellen und revolutionären Ideen, mehr als jeder andere Ort, und zwar längst nicht erst seit 2011. Denn in Damaskus kamen sie in ihrer ganzen Diversität zusammen, in all ihren schönen Nuancen und Farben.
All meine Freund/innen waren von der allerersten Demonstration an mit Leib und Seele dabei.
Ich beschoss damals, nach Aleppo zurückzukehren. Meinen Beitrag zu unserem gemeinsamen Kampf wollte ich in meiner Heimatstadt ableisten. Mein Gefühl sagte mir, dass es in solchen Zeiten darauf ankommt, die Dinge visuell festzuhalten und zu dokumentieren. Schließlich sind Bilder Ausdruck und Inhalt zugleich, und oft unsere einzigen Zeugen.
In Syrien sind Kameras gefürchteter als Waffen. Und ich filmte, weswegen ich Anfang 2012 um ein Haar verhaftet worden wäre. Einmal, zweimal, dreimal und beim vierten Mal erwischten sie mich mit der Kamera in der Hand, zusammen mit zwei Freunden von mir, die es nicht mehr schafften, die Aufnahmen von den Demos rechtzeitig von ihren Handys zu löschen. Unsere Gruppe bestand also aus einem Armenier und zwei syrischen Christen, und wir hatten ein schweres Verbrechen begangen: Wir waren im Besitz einer Kamera mit Aufnahmen von Demos darauf!
Und da kam sie auch schon, die vierte Ohrfeige … wobei es diesmal etwas mehr als eine Ohrfeige war. Die Beamten, die uns verhörten, waren sichtlich verstört darüber, wie es sein konnte, dass ein Armenier und zwei Christen gegen das Regime Position bezogen. Hatte man die Minderheiten nicht längst gezähmt? Sie steckten uns eine Weile hinter Gitter. Solange, bis die Wunden, mit denen sie unsere Körper überzogen hatten, nicht mehr zu sehen waren. Dann schickten sie uns zu unseren Freunden und Verwandten zurück: körperlich zumindest wieder heil, wenn auch recht verdreckt, kränklich und abgemagert.
Die Speicherkarte meiner Digitalkamera hatten sie beschlagnahmt. Alles, was ich aufgenommen hatte, war weg und ließ eine große Leere in mir zurück.
***
Ende 2012, ich erinnere mich noch gut, kam es in der armenischen Gemeinde Aleppos zum ersten zivilen Todesopfer. Es war ein junges Mädchen Anfang zwanzig. Eine Mörsergranate hatte sie getötet. Die Trauerfeierlichkeiten fanden in der Kirche unseres Viertels statt, das mehrheitlich von Armenier/innen bewohnt war. Ich weiß noch, wie wir ihren Sarg an uns vorbeiziehen sahen, ihr Foto auf das Dach des Leichenwagens montiert. Ich stand auf dem Balkon und rauchte. Mit einem Auge folgte ich dem Trauerzug, mit dem anderen fixierte ich die dichten Rauchschwaden, die von drüben aufstiegen: Drüben, wo die anderen Nachbarn gerade starben. Die fernen, muslimischen Nachbarn. Die sunnitischen Nachbarn.
Die Kämpfe hatten begonnen, nun war jeder Kriegspartei.
Der Feind stand vor der Tür.
Aber wer war das, der Feind? Es gab ihn in zwei Varianten: den verhohlenen und den unverhohlenen.
Die Türkei gehörte in die erste Kategorie. Verhohlen brachte sie sich vor den Toren des Landes in Stellung - was vor allem die sogenannten Minderheiten in Syrien als Bedrohung empfanden. Ganz offen und unverhohlen hingegen war die Bedrohung, die vom Baath-Regime für die Mehrheit der Bevölkerung ausging, mit all seiner Rückständigkeit, Gewalt und Hinterhältigkeit. Als Marionette Russlands und Irans tarnte es sich seinerseits im Schatten „verhohlener“ Feinde.
So gingen Verhohlenheit und Unverhohlenheit miteinander Hand in Hand.
Damals musste ich wieder an jenen Leutnant im Internierungslager 2011 zurückdenken, wie er zu mir sagte: „Wenn’s uns nicht gäbe, würden sie euch Armenier doch niedertrampeln, diese Bestien. Eure Frauen vergewaltigen würden sie. Und jetzt kommst du und glaubst, du kannst hier aufmucken.“ In der Folgezeit lasen wir immer wieder anti-armenische Hetzschriften, deren Verfasser ausgerechnet Vertreter der syrischen Opposition waren. Ghassan Aboud zum Beispiel, dem ein regimekritischer Fernsehsender gehört, und die vielen anderen, die ebenfalls auf den Zug aufsprangen und Narrative voller Armenierhass in die Welt setzen.
Solche Dinge konnten regelrechte Augenöffner sein: Was für einen selbst ein „unverhohlener“ Feind sein mochte, konnte für den Nachbarn ein „verhohlener“ Feind sein - und umgekehrt. Aber wenn man selbst gerade ängstlich und erschöpft ist, wird man zuweilen blind für diese Nuancen.
Von 2012 an verloren die Armenier/innen Syriens, und ganz besonders diejenigen aus Aleppo, hunderte unschuldiger Zivilisten/innen im Krieg - Frauen, Kinder und Alte.
***
Höllenjahre standen Aleppo bevor, seinem Ost-Teil genau wie seinem West-Teil. Immer höher loderten die Flammen, immer weiter griff das Feuer um sich. Es folgten Jahre ohne Hoffnung, Jahre ohne Horizont, Jahre ohne gesunden Menschenverstand und ohne Mitgefühl. Jahre ohne Wasser, Jahre ohne Strom, Jahre, in denen einem Artilleriesalven und Granatendonner zur vertrauten Geräuschkulisse wurden und Massenmord, Zerstörung, Gestank und dichte Nacht zur Routine.
Eines frühen Morgens im Jahr 2014 wurden wir von lauten Rufen geweckt: „Allahu Akbar! Allahu Akbar!“ hallte es durch unser Viertel. Splittergruppen der bewaffneten Opposition hatten das Armenierviertel erreicht. Stundenlang hörte man das ununterbrochene Trommelfeuer der Gefechte. Patronensalven zischten hin und her, es gab viele Tote. Ich erinnere mich noch an die unbändige Wut, die in jenen Momenten in mir aufstieg. Fiel ihnen denn nichts Besseres ein, als „Allahu akbar“ zu brüllen in einer Gegend, die bekannterweise mehrheitlich armenisch-christlich war? Konnten sie nicht etwas wie „Freiheit“, „Würde“, „Mitgefühl“ oder „Brüderlichkeit“ rufen? Oder eine kleine Ansprache halten und versuchen, die Bewohner/innen des Viertels emotional zu erreichen? Wieso glaubten sie, sich mit der Brechstange durchsetzen zu müssen? Ihre Religion über alles zu stellen und den Armenier/innen aufzuzwingen, anstatt zu versuchen, sie für ihre Sache zu gewinnen?
Zu Beginn der syrischen Revolution, als die Menschen vor Protesten noch in Moscheen zusammenströmten, war diese Art von Religionsverständnis jedenfalls nicht vorherrschend. Für die Demonstrierenden waren Moscheen damals in erster Linie relativ sichere Versammlungsorte, deren sakrale Natur, Symbol- und Geschichtsträchtigkeit sie sich zu Nutzen machten - denn dort konnte ihnen das Regime nicht so einfach zu Leibe rücken. Insofern stand jenes Kriegsgeschrei im armenischen Viertel im totalen Gegensatz zum anfänglichen Geist der Protestbewegung. Jetzt war da eine feindselige, hasserfüllte Haltung, der Wunsch, den Anderen auszuschließen. Immer größer und größer war er geworden und drohte nun, eine tiefe Furche zwischen die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Syrien zu reißen.
Einige Monate später fielen neue, schwere Bomben auf unser Viertel. Nur um Haaresbreite entgingen meine Eltern dem Tod. Unser Haus wurde stark beschädigt, mehrere Nachbarn kamen ums Leben. Einem von ihnen trennte eine Granate den Kopf vom Leib. Sein kopfloser Leichnam blieb einfach im Eingang des Hauses liegen, das er gerade erst bezogen hatte.
Während ich in meinem Denken und Handeln keinen Millimeter von meiner durch und durch oppositionellen Haltung gegenüber dem Regime abrückte, stieg die Zahl der zivilen Opfer unter den Armenier/innen immer weiter an, besonders im Stadtteil Al-Midan - und zwar infolge des Granatenbeschusses der bewaffneten Opposition.
An einem jener Tage, ich stieg gerade die Stufen zu unserem Hauseingang hinauf, bemerkte ich, wie das ganze Gebäude von einer eigenartig düsteren, traurigen Atmosphäre erfüllt war. Die Türen der Nachbarn standen offen. Ein Flüstern und ein Weinen drang aus den Wohnungen, der blasse Schein der Energiesparlampen verstärkte die befremdlich triste Stimmung noch.
In der Wohnung angekommen, erfuhr ich von meiner Mutter, dass unser Nachbar gerade auf einen Schlag seine beiden Schwestern verloren hatte. Sie waren im Granatenhagel getötet worden, der auf das Midan-Viertel niedergeprasselt war. Da fiel mir ein kleines Mädchen auf, das in unserem Wohnzimmer saß. Es war die Tochter eines der beiden Opfer. Sie wusste noch gar nichts davon, dass ihre Mutter nicht mehr lebte. Die Situation war absolut unerträglich. Ich machte mich aus dem Staub. Zwei Wochen lang traute ich mich nicht mehr nach Haus. Ich konnte unserem Nachbarn, der über meine oppositionellen Ansichten im Bilde war, einfach nicht unter die Augen treten.
Was sollte ich ihm sagen? Worüber würde ich mit ihm diskutieren? Wie würde ich mich rechtfertigen können? Wie würde seine Sicht sein? Und wie meine? Sollte ich einfach zu ihm sagen „Gott habe sie selig“? Würde man mir das abnehmen? Alle glaubten doch, als Regimegegner würde ich jedwede Handlungen der Opposition gutheißen, ob sie nun bewaffnet oder unbewaffnet war, kam in ihren Augen auf dasselbe heraus. Sie konnten ja nicht ahnen, dass ich in Wahrheit gegen sie alle war. Gegen alles was geschehen war und alles, was weiterhin geschehen würde.
Ich wollte nichts mehr denken. Nichts mehr fühlen. Konnte unter all dem Druck mein Gleichgewicht nicht mehr halten, inmitten von all dem Wahnsinn und all den wirren Informationen, die in den Medien und Köpfen herumschwirrten und den Lauf der Dinge bestimmten, während sich die Ereignisse mit enormer Geschwindigkeit überschlugen.
Anfang 2015 kehrte ich Aleppo den Rücken. Verließ ich die Stadt, weil sie mich verraten hatte? Oder hatte ich sie verraten, indem ich sie verließ? Ich weiß es nicht.
Zwischen 2011 und 2016 sind über siebzig Prozent der armenischen Bevölkerung Aleppos ins Ausland gegangen. Zu viele Opfer hatten die Armenier/innen gebracht in einem Konflikt, von dem niemand mehr weiß, wie und warum er begonnen hat.
Doch nun zurück zu den Ohrfeigen.
Fünfte Ohrfeige: Das Prä-Exil
2016 – 2019
Erst im Libanon lernte ich meine syrischen Landsleute richtig kennen. Dort erst erfuhr ich, was Syrischsein bedeutet, und was es früher bedeutet hat. Ich spürte, wie sich meine Identität, die ich mir im Laufe der Jahre zwischen den zwei Polen Aleppo und Damaskus aufgebaut hatte, neu konstituierte.
Im Libanon, in jenen Zeltstädten, die man mit bösartiger Achtlosigkeit mitten im Nirgendwo am Straßenrand verteilt hatte, wo es im Winter bitterkalt und im Sommer brütend heiß war, lernte ich viele Syrerinnen und Syrer aus ganz unterschiedlichen Regionen kennen - aus Städten die einen, aus abgelegenen Dörfern und vergessenen Landstrichen die anderen. Von den meisten dieser Gegenden hatte ich bis dahin so gut wie gar nichts gewusst.
Ein unerträglicher Albtraum drückte diese Menschen Tag für Tag nieder: Man hatte sie mitten in die Hölle verbannt und weil man sie zu den Anhängern der syrischen Revolution rechnete, ließ man ihre Behördengänge und Anträge ins Nichts laufen. Man nutzte sie aus als Mittel zum Zweck, um in ihrem Namen Gelder anzuhäufen oder um, mal von syrischer, mal von libanesischer Seite Druck auf die jeweilige Gegenseite auszuüben.
Im Libanon sah ich, wie diese Menschen es schafften, trotz alldem ihren Humor nicht zu verlieren und wie sie hartnäckig an der Hoffnung auf ein besseres Leben festhielten. Zwei Dinge habe ich dort gelernt: Je beklemmender das Leben wird, desto weiter werden die Herzen, und Gerechtigkeit ist ein Wort, dass immer mit „Un-“ beginnt.
Sechste Ohrfeige: Das Exil
Deutschland, 2020
Aus der Ferne verfolge ich die Nachrichten. Meistens auf dem Smartphone, manchmal auch am Laptop, um die Fotos und Videos besser betrachten zu können. Ich lese die Meldung: „Erdogan-Regierung bedient sich syrischer Kämpfer, um Aserbaidschan in seinem Krieg gegen das armenische Arzach (Bergkarabach) zu unterstützen“. Ich recherchiere, ob die Meldung stimmt. Und je mehr sie sich als wahr bestätigt, desto mehr recherchiere ich.
Siebte Ohrfeige - nahtlos auf die sechste folgend
Nach 45 Tagen erbitterter Gefechte, unter Einsatz international geächteter Waffen und gegen wackeren Widerstand, endet der Krieg in Armenien wie ein drittklassiges Drehbuch. Er endet, während ich in Deutschland herumsitze. Ich, der die dortige Geografie nicht einmal kennt, umso mehr dafür aber die Geschichte. Diese siebte Ohrfeige hat mich folgendes gelehrt: Wer die Geografie verliert, gewinnt zumindest die Geschichte. Und so haben wir inzwischen Routine darin, Teil einer Geschichte der Besiegten zu sein, einer Geschichte von Tyrannei, gewaltsamer Unterdrückung und Ungerechtigkeit.
Der Krieg, den Aserbaidschan gegen das armenische Arzach angezettelt hatte, endete mit Hinterzimmervereinbarungen, unterzeichnet von Persönlichkeiten, die über das Schicksal ganzer Nationen bestimmen. Der Krieg, der die Ursache so vieler zerborstener Körper und so vieler vergossener Tränen war, endete mit dem Schweigen der internationalen Gemeinschaft. Er endete mit der Vernichtung von Existenzen und Hoffnungen. Er endete mit Zwang und Gewalt. Er endete als Teil eines Spiels, bei dem Armeen und Großmächte untereinander darüber wetteifern, wer mehr Geld und Macht besitzt. Beim Gedanken an dieses Spiel wurden meine Erinnerungen wieder die eines Syrers. Ich, der doch versucht hatte, zu vergessen, erinnerte mich jetzt zurück. Wie in einem fahldüsteren Wachtraum wusste ich plötzlich wieder genau, dass die Ungerechtigkeit das Sagen hat. Dass die Dinge kompliziert sind, und dass die Rechnungen nicht aufgehen. Dass die öffentliche Meinung egal ist, und dass sich die freiheits- und demokratieliebenden Länder nicht um alles scheren. Ich wusste wieder, dass die Vorhaben der Mächtigen sich stets rentieren und die Bevölkerungen diejenigen sind, die stets verlieren. Dass die Menschen, besonders die Ärmsten der Armen, völlig sinn- und zwecklos sterben, einfach so, als Kollateralschäden, ohne, dass jemand es auf sie abgesehen haben muss. Sie sterben als Zahlen in Statistiken, in Eil- und Randmeldungen, die die Medien in Umlauf bringen und die wir konsumieren, hinter unseren Laptops in unseren fernen Exilländern. Ich wusste wieder, dass wir Zahlen sind. Und Zahlen sind unsterblich!
***
Ende 2020, ein neuer Tag in einem neuen Land. Ein Land, in das sich hunderttausende von Syrer/innen zu Fuß aufgemacht hatten, um durch labyrinthische Nächte voller Not und Kälte zu irren, bevor sie es erreichten.
Ein ausgelaugter Körper und Erinnerungen an zwei Heimatländer: eines davon so entstellt, dass es kaum mehr wiederzuerkennen ist; das andere erneut in Stücke gerissen, über seinem Kopf das drohende Fallbeil.
Russland und die Türkei sind eifrig dabei, sich Bergkarabach, ihre neue Beute, untereinander aufzuteilen und sie für ihre jeweiligen Interessen zu verwerten. Ich sehe dabei zu, wie dieses Stück Land, seine Bewohner, seine Geschichte, seine Gegenwart zum Joker werden.
Das Internet transportiert mich in Sekundenschnelle von hier nach Syrien, von dort weiter nach Armenien und wieder zurück. Welchen Nachrichten sollen wir folgen? Wollen wir nicht einfach den Rechner herunterfahren? Wenn ich könnte, würde ich vergessen. Ich kann es aber nicht.
Zwischen Weltreichen und Supermächten, da leben wir, lachen und weinen. Empfinden Angst und Schmerz, Trauer und Verzweiflung. Brechen auf, erheben uns, zünden Kerzen an. Pflanzen Rosen, träumen. Rufen zum Krieg auf. Rufen zum Frieden auf. Blasen zum Angriff. Fordern Rache. Doch stets haben jene Weltreiche und Supermächte ein Wörtchen mitzureden.
Zwischen Russland, Iran und der Türkei, zwischen Amerika und Europa, habe ich weder als Armenier überlebt, noch als Syrer. Soviel kann ich über mich persönlich sagen. Das ließe sich natürlich auch guten Gewissens bis zu einem gewissen Grad verallgemeinern.
***
Heutzutage stehen wir also ratlos da, mit all unseren Verletzungen, vor unseren verlorenen Schlachten und zerplatzten Träumen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Im Irak? In Palästina? Im Jemen? Im Libanon? In Armenien? Oder noch weiter weg: in Afrika, zum Beispiel?
Heutzutage lernen wir unsere Siebensachen zusammenpacken, sie in Sichtweite auszubreiten und im Auge zu behalten. Damit wir immer, wenn alles vorbei ist, wieder bei null anfangen können. Es bleibt uns nichts Anderes übrig, als es immer und immer wieder von Neuem zu versuchen. Im Leben kommt es ja auch nicht immer auf das Ergebnis an. Das Wichtige ist, dass man den ersten Schritt tut.
Übersetzung aus dem Arabischen: Rafael Sanchez hat 2002 einen Magister in Romanistik/Arabistik gemacht und 2016 einen Master in Fachübersetzen Arabisch/Deutsch/Englisch. War mehrere Jahre in arabischen Ländern unterwegs, mit beruflichen Aufenthalten in Jordanien, Jemen und Marokko. Seit 2008 freiberufliche Übersetzungstätigkeit für diverse Online- und Printmedien (Qantara.de, Fikrun wa Fann, taz, Tagesspiegel), das Goethe-Institut sowie das Internationale Literaturfestival Berlin.
Übersetzung aus dem Arabischen & Kuration: Sandra Hetzl (*1980 in München) übersetzt literarische Texte aus dem Arabischen, u.a. von Rasha Abbas, Mohammad Al Attar, Kadhem Khanjar, Bushra al-Maktari, Aref Hamza, Aboud Saeed, Assaf Alassaf und Raif Badawi, und manchmal schreibt sie auch. Sie hat einen Master in Visual Culture Studies von der Universität der Künste in Berlin, ist Gründerin des Literaturkollektivs 10/11 für zeitgenössische arabische Literatur und des Mini-Literaturfestivals Downtown Spandau Medina.
Dieser Beitrag ist Teil unserer Serie „Blick zurück nach vorn“. Anlässlich von zehn Jahren Revolution in Nordafrika und Westasien schildern die Autor/innen dabei aus verschiedensten Kontexten, was sie hoffen, wovon sie träumen, was sie sich fragen und woran sie zweifeln. In ihren literarischen Essays wird deutlich, wie wichtig die persönlichen Auseinandersetzungen sind, um politische Alternativen zu entwickeln, und was jenseits der großen Ziele erreicht wurde.
Mit dem anhaltenden Kampf gegen autoritäre Regime, für Menschenwürde und politische Reformen beschäftigen wir uns darüber hinaus in multimedialen Projekten: In unserer digitalen scroll-story „Aufgeben hat keine Zukunft“ stellen wir drei Aktivist/innen aus Ägypten, Tunesien und Syrien vor, die zeigen, dass die Revolutionen weitergehen.