Desinformation untergräbt Vertrauen und Demokratie. Doch es gibt wirksame Gegenstrategien. Wie wir gemeinsam mit Politik, Medien, Plattformen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft ein resilientes Informationsökosystem schaffen können.
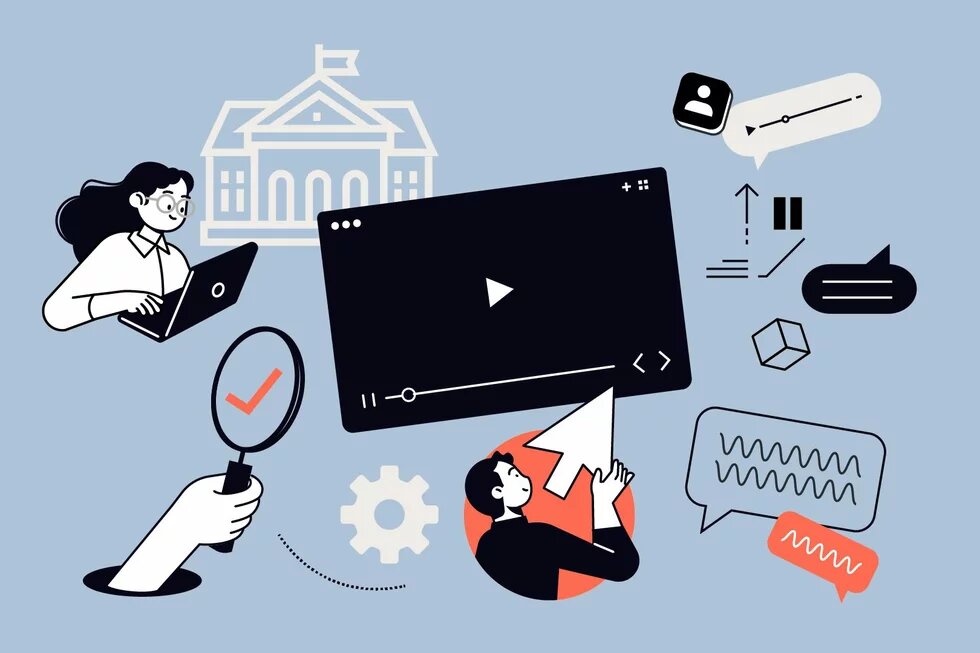
2024 verging keine nationale Wahl rund um den Globus ohne gezielte Desinformationskampagnen. Gleichzeitig kapern einflussreiche Tech-Milliardäre zunehmend digitale Informationsräume und beeinflussen so Diskurse; selbst die Durchsetzung europäischer Digitalgesetze zum Schutz dieser Räume wird zum Spannungsfeld (geo-)politischer Interessen. Unsere digitalen Öffentlichkeiten stehen unter massivem Druck. Der Global Risk Report 2025 des Weltwirtschaftsforums zählt Miss- und Desinformation erneut zu den größten globalen Risiken. Diese Einschätzung spiegelt sich in der wachsenden Sorge vieler Bürger*innen wider, die manipulierte Informationen zunehmend als Bedrohung für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt wahrnehmen.
Desinformation ist auch eine Vertrauenskrise
Es zeigt sich: Desinformation ist kein Randphänomen mehr, sondern systemische Bedrohung einer digitalen demokratischen Öffentlichkeit. Sie zielt nicht allein auf kurzfristige Überzeugung, sondern auf langfristige Destabilisierung – auf das Aushöhlen demokratischer Prozesse und die Delegitimierung der Werte offener Gesellschaften. Gleichzeitig greift der Fokus auf Desinformation allein zu kurz, denn diese entfaltet ihre Wirkung in einem öffentlichen Klima, in dem Vertrauen bereits brüchig ist – Vertrauen in Medien, in Institutionen, in die Wissenschaft und in die gesellschaftliche Fähigkeit, Dinge gemeinsam auszuhandeln.
Desinformation ist kein Randphänomen mehr, sondern systemische Bedrohung einer digitalen demokratischen Öffentlichkeit.
Diese Vertrauenskrise ist nicht bloß Kontext, sondern selbst Teil des Problems. Die Fragmentierung und strategische Instrumentalisierung des Informationsökosystems untergräbt gesellschaftlichen Konsens – und erschwert damit die Lösung von Krisen: von akuten Katastrophen bis hin zu langfristigen Herausforderungen wie Migration oder Klimawandel. So hat die Verbreitung von Falschinformationen zu Hurricane Helene im September 2024 sowohl die Zuweisung von Mitteln für die Katastrophenhilfe erschwert als auch Einsatzkräfte direkt bedroht, wie eine Analyse des Institute for Strategic Dialogue (ISD) zeigt. Kurz gesagt: Eine durch Desinformation stark beeinträchtigte Informationsumwelt macht jede Krise schwerer lösbar.
Was ist das digitale Informationsökosystem?
Analog zu natürlichen Ökosystemen beschreibt das Informationsökosystem die Gesamtheit aller Akteur*innen, Infrastrukturen und Dynamiken, die an der Erzeugung, Verbreitung und Bewertung von Informationen beteiligt sind. Dazu zählen politische Institutionen, Medienunternehmen, soziale Plattformen, zivilgesellschaftliche Akteure und nicht zuletzt die Nutzer*innen selbst. In digitalen Informationsökosystemen sind diese nicht nur Konsument*innen sondern auch Ersteller*innen und Verbreiter*innen von Informationen. Waren Individuen früher hauptsächlich Empfänger*innen von Informationen, kann heute jede*r Inhalte – auch Desinformationen – erzeugen und verbreiten. Damit wächst die Verantwortung des Einzelnen und die Sicherung von Informationsqualität wird stärker zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.
Ein Ökosystem ist dabei kein statisches Gebilde, sondern ein hochdynamisches System, in dem technische, ökonomische und soziale Dynamiken zusammenwirken. Gerät dieses Zusammenspiel aus dem Gleichgewicht – etwa durch manipulative Eingriffe, ökonomische Fehlanreize oder Vertrauensverluste – hat das direkte Auswirkungen auf die Qualität öffentlicher Diskurse, auf die Informationslandschaft und damit auch auf die demokratische Stabilität.
Desinformation zu bekämpfen, heißt die Akteur*innen im Informationsökosystem zu verstehen
Desinformation ist kein rein technisches oder regulatorisches Problem. Die Ursachen für ihre Verfänglichkeit liegen tiefer: im Vertrauensverlust gegenüber demokratischen Institutionen, in der Schnelllebigkeit einer digitalen Informationswelt und in gesellschaftlicher Fragmentierung. Wer diese Dynamik verstehen will, muss das Informationsökosystem als Ganzes betrachten. Denn das Zusammenspiel aller Akteur*innen entscheidet darüber, wie resilient eine demokratische Gesellschaft ist.
Desinformation ist kein rein technisches oder regulatorisches Problem. Die Ursachen für ihre Verfänglichkeit liegen tiefer.
Die ambivalente Rollte des Staates im Informationsökosystem
Demokratische Regierungen stehen vor einem doppelten Auftrag: Sie müssen den digitalen Raum vor Manipulation, gezielter Desinformation und systematischem Missbrauch schützen – ohne dabei die Meinungsfreiheit zu gefährden. Dieses Spannungsverhältnis erfordert ein klug gestaltetes Instrumentarium, das die eigene Rolle kritisch mitdenkt und flexibel auf neue Herausforderungen reagieren kann.
Mit dem Digital Services Act (DSA) geht die EU einen wichtigen Schritt: Große Plattformen sind verpflichtet, algorithmische Risiken zu analysieren, Transparenz über Inhalte und Moderation herzustellen und unabhängige Forschung zu ermöglichen. Damit wird erstmals ein strukturierter Regulierungsrahmen geschaffen, der die Verantwortung von Plattformen ernst nimmt. Gleichzeitig gilt: Rechtsvorgaben allein genügen nicht. Regulierung muss umsetzbar und überprüfbar - und zugleich flexibel genug, um nicht nur auf Entwicklungen zu reagieren, sondern ihnen auch vorausschauend begegnen zu können. Wer tiefer in den Digital Services Act einsteigen möchte, findet hier einen ausführlichen Überblick in unserem begleitenden Artikel.
Der Staat trägt zudem Verantwortung für die Stärkung einer resilienten demokratischen Öffentlichkeit, etwa durch die Förderung von Medienbildung, den Schutz kritischer digitaler Infrastruktur und die Finanzierung unabhängiger journalistischer Angebote.
Wichtig ist dabei ein klar umrissener staatlicher Handlungsrahmen: Nur wenn transparent ist, was der Staat wie reguliert – und was nicht, lassen sich Zensurvorwürfe entkräften und Vertrauen stärken. Eine nationale Anti-Desinformationsstrategie kann hier Orientierung schaffen und den politischen Umgang mit Desinformation sichtbar, nachvollziehbar und demokratisch legitimiert machen.
Plattformen in der Verantwortung: Design ändern, nicht nur Inhalte löschen
Soziale Netzwerke haben den Zugang zu Information demokratisiert: Noch nie war es so einfach, sich zu informieren, zu vernetzen, sich selbst politisch zu äußern. Doch diese Möglichkeiten haben auch Schattenseiten. In sozialen Medien verbreiten sich Falschinformationen oft schneller als Fakten – nicht zufällig, sondern strukturell. Polarisierende und emotionalisierende Beiträge, Desinformation oder Verschwörungserzählungen erzielen mehr Engagement und werden deshalb von Algorithmen bevorzugt ausgespielt.
Die Geschäftsmodelle vieler Plattformen beruhen auf Aufmerksamkeit – nicht auf Qualität oder Wahrhaftigkeit. Als Gatekeeper der digitalisierten Öffentlichkeit verzerren algorithmische Empfehlungsmechanismen die Sichtbarkeit von Inhalten und begünstigen bestimmte Akteur*innen und Narrative. Unser derzeitiges digitales Informationsökosystem ist somit kein neutraler Raum: Es produziert systematische Schieflagen in der öffentlichen Wahrnehmung. So zeigte eine Analyse von über 200.000 Datenspenden während der Bundestagswahl 2021, dass Inhalte der AfD im Instagram-Newsfeed tendenziell weiter oben angezeigt wurden als Beiträge anderer Parteien.
Plattformen tragen daher eine zentrale Verantwortung: Es reicht nicht, Inhalte nur zu moderieren, sie müssen technisch so gestaltet sein, dass die Verbreitung von Inhalten, die ein systemisches Risiko darstellen, begrenzt wird. Dazu gehören: Datenzugänge für unabhängige Forschung, Transparenz über algorithmische Entscheidungen, die sichtbare Integration von Prebunking-Formaten und Faktenchecks.
Die Umsetzung des Digital Services Act muss konsequent erfolgen: Plattformen sind zu verpflichten, ihre technischen Strukturen an demokratischen Standards auszurichten. Zugleich braucht es, insbesondere auch auf politischer Ebene, die gezielte Förderung alternativer Plattformmodelle, um Vielfalt und Wettbewerbsdruck zu stärken.
Medien und Journalismus: Gegengewicht zur Aufmerksamkeitslogik
Journalismus ist ein zentraler Akteur im digitalen Informationsökosystem – mit der Verantwortung, gesellschaftliche Wirklichkeit vielstimmig, unabhängig und kritisch abzubilden. Qualitativ hochwertiger, sorgfältig recherchierter Journalismus kann Desinformation wirksam entgegentreten – allerdings nur, wenn er auch sichtbar und glaubwürdig ist. In sozialen Medien konkurrieren journalistische Inhalte mit emotionalisierten, algorithmisch verstärkten Beiträgen. Gleichzeitig ermöglichen diese Plattformen aber auch aufzuzeigen, wo etablierte Medien – etwa durch einseitige Quellenwahl oder blinde Flecken in der Berichterstattung – ihrem demokratischen Auftrag nicht immer gerecht werden. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, Relevanz gegen Reichweite durchzusetzen, sondern auch Vertrauen zurückzugewinnen, indem journalistische Akteure ihre Verantwortung für Perspektivenvielfalt, ethische Standards und redaktionelle Transparenz nicht nur konsequent einhalten, sondern auch reflektieren und erklären.
Besondere Bedeutung kommt dem Lokaljournalismus zu: Er schafft Vertrauen vor Ort, liefert Orientierung und klärt auf – wird aber wirtschaftlich zunehmend ausgedünnt. Deshalb ist eine gezielte Förderung dringend notwendig. Gleichzeitig muss sich Journalismus an veränderte Bedingungen in einem digitalen Informationsökosystem anpassen, neue Formate entwickeln und gleichzeitig nachhaltige (teilweise neue) Finanzierungsmodelle entwickeln. Gegenwärtige Beispiele zeigen, dass dies bereits passiert: Auf Abo-Modelle für journalistische Inhalte setzen mittlerweile fast alle etablierten Medien, wie SPIEGEL oder Die ZEIT. Die Tagesschau hat einen eigenen TikTok Kanal, der mit auf die Plattform zugeschnittenen Inhalten bespielt wird. Momentan testet die ARD darüber hinaus vermehrt interaktive journalistische Formate auf Twitch.
Forschung und Zivilgesellschaft als demokratische Frühwarnsysteme
Ein widerstandsfähiges Informationsökosystem beginnt bei den Nutzer*innen selbst. Damit Menschen Informationen verstehen, einordnen und kritisch bewerten können, braucht es systematische Vermittlung von Nachrichten- und Digitalkompetenz. Bildungsangebote, die diese Fähigkeiten stärken, sind zentrale Voraussetzung für eine informierte Öffentlichkeit – und damit für eine lebendige Demokratie. Diese Arbeit zivilgesellschaftlicher Initiativen braucht sichtbare Unterstützung und verlässliche Finanzierung. Wie sich insbesondere junge Menschen informieren und wo ein solcher Kompetenzaufbau stattfinden sollte, lesen Sie in einem weiteren Artikel des Dossiers zu politischer Medienbildung.
Damit Menschen Informationen verstehen, einordnen und kritisch bewerten können, braucht es systematische Vermittlung von Nachrichten- und Digitalkompetenz
Doch Aufklärung allein genügt nicht. Um manipulative Dynamiken frühzeitig zu erkennen und effektive Gegenstrategien zu entwickeln, braucht es kontinuierliches Plattformmonitoring. Ohne systematisches Monitoring bleiben viele Angriffe auf öffentliche Diskurse unerkannt – mit potenziell weitreichenden Folgen für die Integrität und das Vertrauen in das digitale Informationsökosystem.
In den letzten Jahren haben sich zunehmend zivilgesellschaftliche Akteur*innen etabliert, die Monitoring-Tools nutzen oder fördern, um evidenzbasierte Empfehlungen für die Gestaltung digitaler Plattformen zu erarbeiten und Risiken frühzeitig zu identifizieren. Ziel ist es, anekdotische Beobachtungen durch wissenschaftlich belastbare Analysen zu ersetzen. Initiativen wie CeMAS oder das Institute for Strategic Dialogue ISD zeigen, wie zivilgesellschaftliches Monitoring erfolgreich funktionieren kann.
Gleichzeitig steht unabhängige Forschung vor erheblichen Herausforderungen: Das Forschungsfeld ist fragmentiert und der Zugang zu relevanten Plattformdaten oft eingeschränkt. Zudem gerät Wissenschaft insgesamt zunehmend unter Druck: Sie wird politisch instrumentalisiert, angezweifelt und angefeindet, was das Vertrauen in sie schwächt. So wurde beispielsweise das Stanford Internet Observatory, das Desinformationen während der US-Wahlen analysierte, durch politischen und juristischen Druck aus konservativ-republikanischen Kreisen stark geschwächt und musste 2024 den Großteil seines Teams entlassen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtiger denn je, die Wissenschaft zu stärken, ihre Erkenntnisse klar und transparent zu kommunizieren und ihre gesellschaftliche Wirkung zu stärken.
Strategien für ein resilientes Informationsökosystem
Ein resilientes Informationsökosystem aufzubauen, bedeutet mehr als lediglich Desinformation zu bekämpfen. Es geht darum, demokratische Debattenräume zu sichern – nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen, Transparenz und echte Pluralität. Dafür ist eine umfassende, demokratisch legitimierte Gestaltung des digitalen Raums notwendig. Wesentliche Voraussetzungen dafür sind ein stabiles und integres politisches System, eine wirksame Regulierung sozialer Netzwerke, das Vertrauen in professionelle Medien sowie eine informierte und medienkompetente Öffentlichkeit.
Erforderlich sind dafür verlässliche Strukturen und eine politische Kultur, die Vielfalt und Widerspruch nicht nur aushält, sondern als Teil demokratischer Aushandlung anerkennt – und zugleich faktenbasierte Debatten stärkt. Ein widerstandsfähiges Informationsökosystem entsteht dann, wenn alle in ihm enthaltenen Akteur*innen ihre jeweilige Verantwortung ernst nehmen und konstruktiv ineinanderwirken.


