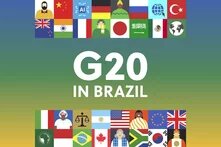Viele G20-Versprechen zur Bekämpfung der Hungerkrise blieben bisher folgenlos. Südafrikas Präsidentschaft bietet die Chance, internationale Unterstützung für bewährte Lösungen zu gewinnen, die lokale Ernährungssysteme stärken und nachhaltige Lebensgrundlagen fördern.

Austin/Johannesburg – Bei der Übernahme der G20-Präsidentschaft im Dezember wählte Südafrika „Solidarität, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit” als Thema. Diese Vision ist keineswegs ein leerer Slogan, sondern spiegelt die Grundsätze wider, auf denen jede glaubwürdige internationale Reaktion auf die heutige Hungerkrise aufbauen muss.
Angetrieben durch Klimakrise, Konflikte und Ungleichheit nimmt die Ernährungsunsicherheit weltweit zu. Die Instrumente zu ihrer Bekämpfung sind bereits vorhanden. Die Herausforderung besteht darin, den politischen Willen zum Handeln zu mobilisieren. Die G20-Präsidentschaft Südafrikas bietet eine einzigartige Gelegenheit, genau das zu tun.
Bewährte Programme ausbauen statt neue Initiativen starten
Brasilien stellt ein bemerkenswertes Vorbild dar. In den letzten zwei Jahren gelang es dem Land, 40 Millionen Menschen aus der Ernährungsunsicherheit zu befreien und damit von der Hungerkarte der Vereinten Nationen gestrichen zu werden. Um dies zu erreichen, führte die Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva die von seinem Vorgänger Jair Bolsonaro abgeschafften Maßnahmen wieder ein, stärkte Schulmahlzeitenprogramme durch die Beschaffung von kleinbäuerlichen und indigenen Landwirtschaftsbetrieben, erhöhte den Mindestlohn und erkannte das Recht auf Nahrung gesetzlich an.
Keine dieser Maßnahmen ist experimentell. Es handelt sich um bewährte und erprobte Lösungen, deren Erfolg zeigt, dass die Beseitigung des Hungers nicht von technologischen Innovationen abhängt, sondern von politischem Mut.
Die Beseitigung des Hungers hängt nicht von technologischen Innovationen ab, sondern von politischem Mut.
Als Brasilien im vergangenen Jahr den Vorsitz der G20 innehatte, versuchte es, seine innenpolitischen Erfolge zu exportieren, insbesondere durch die Gründung der Globalen Allianz gegen Hunger und Armut. Konkrete Ergebnisse bleiben jedoch aus, da viele Mitglieder der Allianz – insbesondere multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) – weiterhin technische, marktorientierte Lösungen fördern, die die Eigentumsrechte von Unternehmen über die Grundbedürfnisse der Menschen stellen.
Anstatt neue Initiativen und Plattformen zu starten, sollte die oberste Priorität der G20 darin bestehen, bereits bewährte Programme zu konsolidieren und auszuweiten. Der Mechanismus der Zivilgesellschaft des UN-Ausschusses für Welternährungssicherheit bietet einen soliden, inklusiven Raum für globale Debatten. Was jetzt benötigt wird, ist eine konkrete politische Agenda, die es progressiven Führungskräften und Beamten ermöglicht, nationale Maßnahmen zur Bekämpfung des Hungers voranzutreiben.
Wie Südafrika seinen politischen Spielraum nutzen sollte
Zugegebenermaßen bleibt Südafrika nicht viel Zeit, bevor es den Vorsitz der G20 an die Vereinigten Staaten übergibt – den einzigen Mitgliedstaat, der sich konsequent weigert, das Menschenrecht auf Nahrung anzuerkennen. Aber in der verbleibenden Zeit kann sich Südafrika noch für wichtige politische Instrumente zur Bekämpfung des Hungers einsetzen.
Vier solcher Instrumente stechen besonders hervor. Erstens stärkt die öffentliche Beschaffung von Lebensmitteln für Schulmahlzeiten und Ernährungsprogramme bei lokalen Familienbetrieben sowohl die Ernährungssicherheit als auch die Lebensgrundlagen im ländlichen Raum. Zweitens können öffentliche Nahrungsmittelspeicher und Instrumente zur Preisstabilisierung Verbraucher*innen vor Preisspitzen schützen und gleichzeitig die Einkommen der Landwirt*innen sichern. Drittens sorgen soziale Sicherungssysteme – von existenzsichernden Löhnen und Geldtransfers bis hin zu universellen Sozialleistungen – dafür, dass sich Haushalte eine gesunde Ernährung leisten können. Und schließlich könnten Gesetze, die das Recht auf Nahrung verankern, dazu beitragen, Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie nicht entsprechend handeln.
Wichtig ist, dass die Staats- und Regierungschefs der G20 erkennen, dass sie sich nicht den politischen Prioritäten der multilateralen Entwicklungsbanken unterordnen müssen.
Ebenso wichtig ist, dass die Staats- und Regierungschefs der G20 erkennen, dass sie sich nicht den politischen Prioritäten der multilateralen Entwicklungsbanken unterordnen müssen. Durch ihre Sitze in den Vorständen dieser Institutionen verfügen sie bereits über die Macht, die internationale Unterstützung von der exportorientierten Agrarindustrie hin zu lokalen Ernährungssystemen und klimaresistenter bäuerlicher Landwirtschaft zu verlagern.
Wenn es der südafrikanischen Regierung ernst damit ist, ein gerechteres und nachhaltigeres globales Ernährungssystem zu fördern, sollte sie dem Beispiel ihrer Zivilgesellschaft folgen, die seit langem an vorderster Front im Kampf gegen den Hunger steht. Anstatt eine weitere Runde hochrangiger Diskussionen mit wenig Nachwirkung einzuberufen, muss sie sich darum bemühen, öffentliche Verpflichtungen zu sichern, die über die G20-Präsidentschaft der USA hinaus Bestand haben.
Lokale Initiativen stärken Ernährungssouveränität
Die südafrikanischen Entscheidungsträger*innen scheinen sich der Bedeutung dieser Herausforderung bewusst zu sein. Auf dem jüngsten UN-Gipfel zur Bestandsaufnahme der Ernährungssysteme (UNFSS+4) in Addis Abeba bekräftigte Landwirtschaftsminister John Steenhuisen das Engagement seines Landes für Ernährungssouveränität. Zum ersten Mal wird in dem vorgeschlagenen Nationalen Ernährungsplan das Konzept der Agrarökologie als Weg zu nachhaltiger Landwirtschaft, Biodiversität und Klimaresilienz anerkannt. Der Rat für Agrarforschung wurde außerdem mit der Entwicklung eines nationalen Agrarökologie-Rahmenwerks beauftragt, das sich auf einheimische Nutzpflanzen konzentriert.
Während sich die Räder der Regierungsführung oft nur langsam drehen, können es sich die Basisgemeinden nicht leisten zu warten. Während der COVID-19-Pandemie stießen Wissenschaftler*innen auf ein lebendiges Netzwerk von 78 Kleinbäuer*innen, darunter überwiegend Frauen, die in der Provinz KwaZulu-Natal eine Vielzahl von Obst- und Gemüsesorten anbauten. Durch den Verkauf ihrer Überschüsse vor Ort unterstützten diese Bäuer*innen Unternehmen im gesamten Umgungundlovu-Distrikt, von informellen Händler*innen und informellen Marktständen bis hin zu spaza shops [informelle Lebensmittelgeschäfte, Anm. d. Red.], Schulen und kommunalen Märkten.
Hunger wird nicht in Konferenzsälen bekämpft, sondern in Küchen, Schulen und auf Feldern.
Diese Erfahrung zeigt, wie lokale Ernährungssysteme sowohl den Lebensunterhalt als auch die Gemeinden sichern. Hunger wird nicht in Konferenzsälen bekämpft, sondern in Küchen, Schulen und auf Feldern. Um erfolgreich zu sein, brauchen lokale Erzeuger*innen politische Unterstützung und die notwendigen Ressourcen, um zu gedeihen.
Die G20 muss die Hungerkrise frontal angehen, sonst riskiert sie, den Rest ihrer Glaubwürdigkeit zu verlieren. Südafrika kann eine Vorreiterrolle übernehmen, indem es die Ernährungsgerechtigkeit ganz oben auf seine Agenda setzt und damit zeigt, dass „Solidarität, Gleichheit und Nachhaltigkeit“ keine abstrakten Ideale sind, sondern für das Überleben der Menschheit unerlässlich sind.
Dieser Artikel wurde erstmals auf der Website von Project Syndicate veröffentlicht.