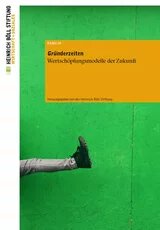Deutschland muss sein Geschäftsmodell verändern, um langfristigen nachhaltigen Wohlstand zu generieren. Um die Wirtschaft innovativ zu halten, braucht es massive Investitionen in die Infrastrukturen sowie in Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Dieser Text ist eine gekürzte Version des Vorworts zum Sammelband "Gründerzeiten - Wertschöpfungsmodelle der Zukunft".
Die Zahl 0,2 Prozent ist die Chiffre für das Sorgenkind der europäischen Union. 0,2 Prozent steht aktuell für das Wachstum der Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2024. Es sind nicht allein Expert*innen, die dies besorgt. Die schlechten Zahlen manifestieren sich auch in Kritik an der Bundesregierung im Allgemeinen und im Besonderen an der Wirtschaftspolitik von Bündnis 90/Die Grünen. 58 Prozent der Deutschen finden, dass die Grünen sich zu wenig um Wirtschaft und Arbeitsplätze kümmern. Dem ließe sich entgegenhalten, dass das grün geführte Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz das Land nach dem 24. Februar 2022 sicher durch eine tiefe Energiekrise geführt und der Strukturwandel der Energieversorgung richtig Fahrt aufgenommen hat. Doch was grüne Politik angeht, darf kein Zweifel bestehen: Wer sich um politische Verantwortung bewirbt, muss diese auch übernehmen, wenn die Umstände besonders schwierig und die Resultate unbefriedigend sind. Die Ursachen für die wirtschaftlichen Probleme der Gegenwart reichen allerdings mehrere Dekaden zurück und beruhen vielfach auf einem (unausgesprochenen) Konsens großer Teile der politischen und ökonomischen Eliten. Dieses Land ist ökonomisch lange gut gefahren mit einem Kurs der Bequemlichkeit, der aber zugleich Ursache der aktuellen Misere ist. Wirtschaftliche Umbrüche drohen als Folge. Sie heizen die politische Debatte an.
Hinter dem Streit um die richtige Wirtschaftspolitik steht ein tiefgreifender Konflikt, der sich aktuell innerhalb der Wirtschaft selbst abspielt. Es geht um den Erhalt und die Verlängerung bestehender versus neuer, innovativer Geschäftsmodelle. Wo grüne Wirtschaftspolitik hier verortet wird, zeigt ein Blick auf den Start-up-Monitor, einer jährlichen Umfrage des Start-up-Verbands: Die Gründerinnen und Gründer der innovativsten Unternehmen in Deutschland unterstützen demnach zu 41,3 Prozent Bündnis 90/Die Grünen, gefolgt von der FDP mit 21,4 Prozent. Das Wortspiel Gründerzeiten verweist auf eine mögliche Rolle, die die grüne Strömung für die Gründerinnen und Gründer der neuen Geschäftsmodelle von morgen übernehmen kann.
Die Transformation der deutschen Wirtschaft ist bereits im Gange
Doch wäre es zu kurz gegriffen, eine Konfliktlinie nur zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen zu suchen: Er durchzieht auch die großen Industrien hierzulande. Besonders deutlich wird dies in der Automobilindustrie, wo die Unternehmen beständig zwischen Investitionen in neue Antriebsmodelle und der Verteidigung der bestehenden Geschäftsmodelle schwanken und zum Teil Innovation nur sehr langsam aufgenommen haben. Insofern widersprechen wir mancher Stimme im grünen Spektrum, die primär von einem Konflikt zwischen fossil und post-fossilen Modellen ausgehen. Dieser Konflikt spielt sicherlich eine bedeutende Rolle in der Auseinandersetzung um die wirtschaftliche Zukunft des Landes, eine relevante noch dazu; unsere Analyse geht aber tiefer.
Für uns ist die Dekarbonisierung die Voraussetzung für eine erfolgreiche Erneuerung, aber weder alleiniger Anlass noch Ursache oder einziges Ziel.
Wir gehen davon aus, dass Diagnosen aus manchen grünen Kontexten hier zu kurz greifen: Die Transformation der bundesrepublikanischen Wirtschaft und Industrie wird zu oft auf die Dekarbonisierung aller ökonomischen Aktivitäten reduziert. Für uns hingegen ist die Dekarbonisierung die Voraussetzung für eine erfolgreiche Erneuerung, aber weder alleiniger Anlass noch Ursache oder einziges Ziel. Stattdessen gehen wir davon aus, dass eine umfassende Transformation längst im Gange ist. In vielerlei Hinsicht sind die geforderten Gründerzeiten also längst da, aber es gilt, den richtigen Rahmen für diese wirtschaftliche Dynamik zu setzen. Dies könnte sich als eine der Lehren aus den letzten Jahren in wirtschaftspolitischer Verantwortung erweisen.
Schließlich ist die Erneuerung der bundesrepublikanischen Wirtschaft bereits in vollem Gang. Sie wird die energetischen Grundlagen neu legen, Produktionstechniken verändern und Produktpaletten zukunftsfit machen. Hier gilt es, den ordnungspolitischen Kompass so auszurichten, dass ein kluges Zusammenspiel von staatlichen Impulsen und wirtschaftlicher Eigendynamik wirken kann. Nur so entstehen marktfähige Modelle. Wir möchten weder den aktuellen Zustand subventionieren – wie etwa den Verbrennermotor – noch in nicht marktfähige Modelle – wie zum Beispiel bei der Batterietechnologie – investieren. Unser Anliegen ist es deshalb, Deutschlands Business-Case in Gänze zu überdenken.
Wirtschaftspolitik wird in Zukunft nicht mehr von Wissenschafts- und Innovationspolitik zu trennen sein.
Der Wohlstand Deutschlands beruht noch immer auf den technologischen Innovationen der dritten Welle der Industrialisierung: Chemie, Maschinenbau und Automobilität. Die deutsche Wirtschaft ist in großen Teilen innovations-avers geworden. Die Stärke des Euros hat zu einer falschen Gewissheit der eigenen Stärke und zur Behäbigkeit der deutschen Wirtschaft geführt. Abzulesen etwa bei der Digitalisierung.
Deutschland muss sein Geschäftsmodell verändern
Eine große Herausforderung also liegt darin, die Wirtschaft in Deutschland permanent und dauerhaft innovativ zu halten. Hohe Löhne und die Abwertungen anderer Währungen waren solche Mechanismen über viele Jahre hinweg. Ähnliche Mechanismen wieder zu schaffen ist auch deshalb so entscheidend, weil die Innovationszyklen kürzer werden. Wir sehen seit 2019, dass Deutschland Probleme hat, das globale Tempo zu halten, wenn die äußeren Bedingungen sich verschlechtern. Massive Investitionen in die Infrastrukturen sowie in Bildung, Wissenschaft und Forschung sind die conditio sine qua non. Wirtschaftspolitik wird in Zukunft nicht mehr von Wissenschafts- und Innovationspolitik zu trennen sein.
Weiterhin gilt: Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, aber er ist immer noch der beste Investor in die Bedingungen, in die Grundlagen und in die Infrastrukturen der Zukunft. Denn neue Geschäftsmodelle sind dann gut, wenn sie ihre ökonomische Tragfähigkeit beweisen; die Finanzierung von Infrastrukturen ist dagegen oftmals kein betriebswirtschaftlich ertragreiches Geschäft. Sie beweisen ihre Wirksamkeit im gesamtgesellschaftlichen Nutzen. Des Weiteren gilt es für den Staat, Mechanismen zu finden, weiteres privates Kapital zu aktivieren.
Der Ausgang der Debatte über die Finanzierung der notwendigen Rahmenbedingungen entscheidet darüber, ob Deutschland in der Lage sein wird, sein Geschäftsmodell zu verändern und langfristigen nachhaltigen Wohlstand generieren kann. Ohne massive staatliche Investitionen oder Risikoübernahmen wird diese tiefe Erneuerung nicht möglich sein.
Die Chance für grüne Politik liegt in der Entwicklung eines Zielbildes für die Unterstützung der neu entstehenden Geschäftsmodelle. Anders gesagt: Sie liegt in genau diesen Gründerzeiten.