Ein geeintes Europa heißt heute nicht mehr: alle gleichzeitig. In zentralen Fragen wie Verteidigung, Digitalisierung oder Schlüsseltechnologien braucht es Bündnisse der Willigen - innerhalb und jenseits der EU.
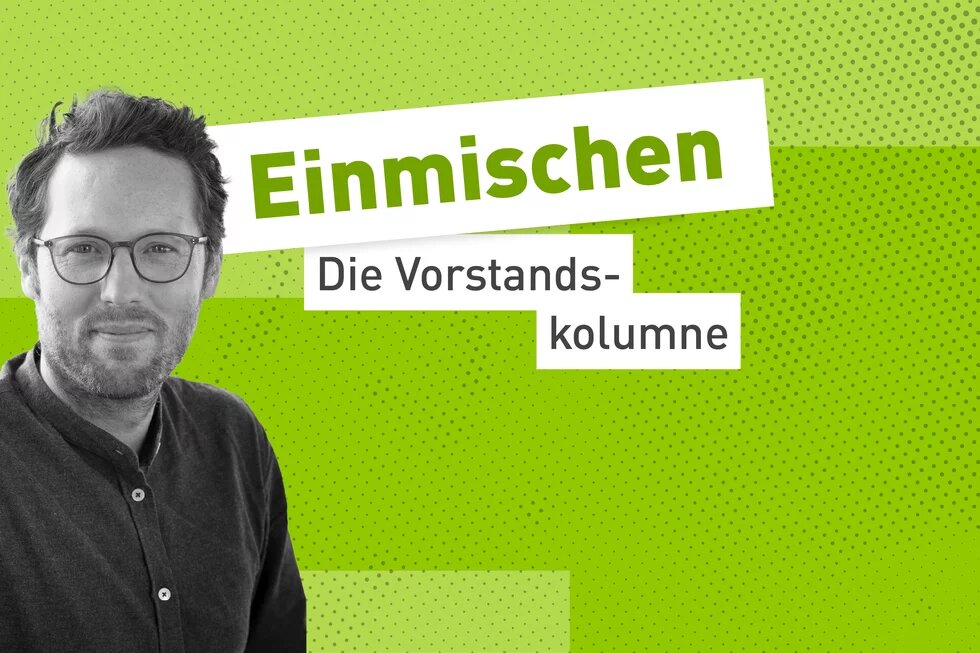
In den vergangenen Jahren hat die EU wichtige Fortschritte gemacht, wie etwa bei der inneren Sicherheit, der Stabilisierung der Eurozone, dem Green Deal und der Regulierung digitaler Märkte. Und auch auf den russischen Angriffskrieg reagierte die Union in ungewohnter Geschlossenheit mit koordinierten Sanktionspaketen, gemeinsamer Energiepolitik und klarer Rückendeckung für die Ukraine. Dennoch: 75 Jahre nach der Schuman-Erklärung und 40 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Abkommens droht die Europäische Union von außen zerrieben und von innen blockiert zu werden. Um das zu verhindern, braucht es jetzt das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Partner.
Die EU wird so massiv herausgefordert wie nie zuvor. Die Rede von US-Vizepräsident J. D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz war ein Wendepunkt in der europäischen Selbstverortung. Europa muss erkennen: Der einstige Schutzpatron Amerika zieht sich nicht nur zurück, er begreift Europa zunehmend als Wettbewerber - wenn nicht als Gegner. Donald Trumps Regierung und ultralibertäre Tech-CEOs aus den USA stellen sich offen gegen das europäische Modell einer freiheitlich-demokratischen Ordnung in sozialer Marktwirtschaft. Während sie die EU zunehmend fürchten, scheinen die europäischen Spitzen Angst vor der eigenen Wirkmächtigkeit bekommen zu haben.
Deutschland agiert oft bremsend.
Nationale Egoismen lähmen die EU
Besonders die deutsche Politik hat sich zunehmend aus der aktiven Gestaltung des europäischen Projekts zurückgezogen. Diese Tendenz hat konkrete Folgen: In der Verteidigungspolitik, beim Green Deal oder in der Digitalpolitik agiert Deutschland oft bremsend. Paris und Warschau schauen zunehmend irritiert auf Berlin. Ein weiteres Warnsignal war die europäische Reaktion auf die von Joe Biden angestoßene amerikanische Investitionsoffensive im Rahmen des Inflation Reduction Acts: Statt mit einer gemeinsamen industriepolitischen Strategie zu antworten, dominierten Unsicherheit und Abwehrreflexe.
Zugleich lähmen nationale Egoismen immer wieder notwendige Reformen: Wenn ein Viktor Orbán im Rat mit Veto droht oder europa- und demokratiefeindliche Kräfte Regierungen prägen, wie in Italien, den Niederlanden, zeitweise in Österreich oder Polen, dann ist klar: Ein gemeinsames Voranschreiten in der EU ist oft nicht möglich. Positive Mehrheiten im Rat oder im Parlament lassen sich kaum finden. Stattdessen dominiert eine Allianz der Neinsager - selbst gegenüber dringlichen Projekten der Kommission. Und es ist wenig wahrscheinlich, dass in dieser Lage ein groß angelegter Sprung zur europäischen Republik breite Begeisterung auslösen könnte. Dazu fehlen glaubwürdige Narrative und sichtbare Repräsentanz.
Es braucht Staaten, die gemeinsam vorangehen.
Stillstand bedeutet Risiko
Was es jetzt braucht, ist ein handlungsfähiges System der Vertiefung in zentralen Bereichen. Glücklicherweise bietet die EU dafür längst die Möglichkeit: Im Rahmen "verstärkter Zusammenarbeit" können Staaten vorangehen - ganz im Sinne der Methode, die bereits das Schengener Abkommen und die Eurozone hervorgebracht und damit maßgeblich zur Integration Europas beigetragen hat. War diese Methode in den vergangenen Jahren - wie etwa beim Fiskalpakt - vor allem die letzte Ausfahrt zur Krisenbewältigung, muss sie jetzt zum zentralen Instrument für die Vertiefung der EU werden.
Es geht um die gemeinsame Beschaffung und Koordinierung in einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, um Investitionsprogramme für Schlüsseltechnologien, um den Aufbau einer unabhängigen digitalen Infrastruktur und um die Begründung internationaler Industriepartnerschaften - für all das braucht es Staaten, die gemeinsam vorangehen. Sie sollten es dürfen. Und diese Bündnisse sollten offen sein für die Zusammenarbeit mit engen Partnern wie Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Südkorea oder Japan - sowie mit neuen, aber zentralen Akteuren einer multilateralen Weltordnung und -wirtschaft wie Brasilien, Indien oder Südafrika.
Ein solches Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten wurde immer wieder gefordert - unter anderem von Joschka Fischer, der im Verfassungskonvent zentrale Grundlagen dafür schuf. Doch aus Angst vor Spaltung blieb es meist bei der Idee. Heute liegt das Risiko nicht in der Differenz, sondern im Stillstand. Und gerade kleinere Staaten - etwa im Baltikum oder Mitteleuropa - könnten durch flexiblere Bündnisse mehr Einfluss gewinnen als im Einstimmigkeitsbetrieb. Nicht zuletzt öffnet dieser Weg die Türen für einen schnellen Beitritt der Länder des Westbalkans sowie der Ukraine und Moldaus.
Der Text erschien zuerst in der FAZ, am 01. Juli 2025.
