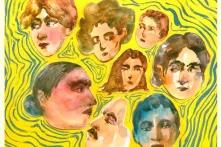Unabhängige Medien im Südkaukasus sind Druck, Desinformation und Kürzungen der Finanzmittel ausgesetzt. Lesen Sie unseren aktuellen Bericht über die Herausforderungen – und die Widerstandsfähigkeit – der Medien in der Region.

Staatliche Repressionen, Fehlinformationen und Desinformation, Kürzungen der Gebermittel, fehlende kommerzielle Märkte, Arbeit im Exil – die Herausforderungen für unabhängige Medien im Südkaukasus sind vielfältig und unterschiedlich. In Aserbaidschan und Georgien hat der Druck der Regierung auf den Sektor – und auf den Zugang der Öffentlichkeit zu unvoreingenommener Berichterstattung – ein beispielloses Ausmaß erreicht. Während Armenien seine Position im aktuellen Weltindex für Pressefreiheit verbessern konnte, sind Medien und Journalisten weiterhin anfällig für finanziellen Druck und politische Einmischung.
Um das Bewusstsein zu schärfen, für Medienfreiheit einzutreten und den Austausch zu fördern, unterstützte die Heinrich-Böll-Stiftung Südkaukasus die Teilnahme von sechs Journalist*innen aus der Region am Weltkongress des International Press Institute, der vom 23. bis 25. Oktober 2025 in Wien stattfand. Außerdem veranstalteten wir eine Nebenveranstaltung mit dem Titel „Berichterstattung über Grenzen hinweg: Medien, Druck und Zusammenarbeit im Südkaukasus“.
Ohne Zugang zu verlässlichen Informationen ist es unmöglich, fundierte Meinungen zu bilden. Ohne freie Medien kann Demokratie nicht gedeihen.
Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr aus den Berichten von drei renommierten Journalist*innen aus Aserbaidschan, Georgien und Armenien. Sie beschreiben die Herausforderungen, denen sich die Medien im Südkaukasus gegenübersehen, skizzieren aktuelle Trends und finden dennoch (einige) Hoffnungsschimmer.
Aserbaidschan: Der hohe Preis des Journalismus in Aserbaidschan
„Journalismus ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebenseinstellung.“ Diese Worte stammen von der aserbaidschanischen Journalistin Aytac Tapdig, die derzeit zusammen mit Kolleg*innen von Meydan TV, einer unabhängigen Nachrichtenplattform, hinter Gittern sitzt. Tapdig gehört zu den 25 Journalisten, die seit November 2023 im Rahmen dessen, was sie als „Massaker an den Medien in Aserbaidschan“ bezeichnet, verhaftet wurden. Unabhängiger Journalismus war in Aserbaidschan schon immer mit Risiken verbunden, aber noch nie in diesem Ausmaß. Trotz der Gefahren versuchten die Medien, der Öffentlichkeit zu dienen und die Behörden zur Rechenschaft zu ziehen. Dafür zahlen sie weiterhin einen hohen Preis.
Eine 150 Jahre alte Branche
Im Juli dieses Jahres feierte Aserbaidschan das 150-jährige Jubiläum seiner nationalen Presse. Präsident Ilham Aliyev lobte die „unabhängigen, starken und modernen Medien” des Landes und behauptete, die Regierung habe die Voraussetzungen für freie Aktivitäten geschaffen, die wirtschaftlichen Grundlagen des Journalismus gestärkt und Reformen zum Schutz der Medienvertreter*innen durchgeführt. Für Außenstehende mag dies glaubwürdig klingen. Für die inhaftierten Journalist*innen, ihre Familien, Kolleg*innen im Exil und Verfechter*innen der Pressefreiheit könnte die Realität jedoch nicht weiter von diesen Worten entfernt sein.
Letztes Jahr sagte die Chefredakteurin von Meydan TV, Aynur Elgunesh, bei derselben Gelegenheit gegenüber Jam News, dass die Medien in Aserbaidschan „tot” seien, nur dass niemand mehr da sei, um die Leiche zu „begraben”. Seit diesem Interview wurde Elgunesh selbst verhaftet und muss sich wegen falscher Schmuggelvorwürfe vor Gericht verantworten – dieselben Anschuldigungen, die auch gegen viele andere Journalisten erhoben werden. „Nur eine Handvoll Menschen sind noch übrig“, sagte sie damals, „die versuchen, eine Leiche wiederzubeleben. Ohne Pluralismus, ohne Meinungsfreiheit und ohne die Freiheit, die Fehler der Regierung aufzuzeigen, gibt es keine Presse in diesem Land.“
Eine der Autorinnen dieses Artikels, die Reporterin Fatima Movlamli, wurde ebenfalls inhaftiert. Wie andere sieht auch sie sich erfundenen Anschuldigungen gegenüber, die darauf abzielen, Meydan TV zu schwächen und kritische Berichterstattung zu unterbinden.
Repression hinter der Rhetorik
Entgegen dem offiziellen Lob für „starke Medien“ haben die Behörden Aserbaidschans restriktive Gesetze, willkürliche Verhaftungen und Einschüchterungen eingesetzt, um sicherzustellen, dass der Journalismus auf staatliche Propaganda reduziert wird. Diese Strategie ist nicht neu: Unabhängige Stimmen sind seit Jahrzehnten Zensur und Schikanen ausgesetzt.
Verhaftungen und Einschüchterungen von Journalist*innen waren bereits in den 1990er Jahren an der Tagesordnung. Mitte der 2000er Jahre verboten die Behörden die lokale Weiterverbreitung ausländischer Sender. Anfang der 2010er Jahre gerieten Blogger*innen und Aktivist*innen in den sozialen Medien zunehmend ins Visier.
Bei einer Razzia im Jahr 2014 wurden zahlreiche prominente Mitglieder der Zivilgesellschaft inhaftiert. Kurz darauf wurden Websites unabhängiger Medien wie Meydan TV und Radio Liberty gesperrt. Ihre Büros wurden durchsucht und weitere Reporter*innen inhaftiert. In diesem Jahr entzogen die Behörden internationalen Medien die Akkreditierung. In den letzten zwei Jahrzehnten wurden die Gesetze zugunsten der Behörden und der Elite verschärft: Unternehmen waren nicht mehr verpflichtet, ihre Eigentumsverhältnisse offenzulegen, Verleumdungs- und Beleidigungstatbestände wurden auf Online-Inhalte ausgeweitet und Verfassungsänderungen gewährten dem Präsidenten und seiner Frau lebenslange Immunität vor Strafverfolgung.
In jüngerer Zeit wurden mit einem Mediengesetz von 2022 (geändert 2025) neue Lizenz- und Registrierungsanforderungen eingeführt, die den Berufsstand weiter einschränkten. Die kumulative Wirkung war die Beseitigung des Raums für unabhängigen Journalismus.
Der Preis der Wahrheit
In einer Reihe von Scheinprozessen wurden allein in diesem Sommer mindestens sieben Journalist*innen verurteilt und erhielten aufgrund falscher Anschuldigungen Haftstrafen zwischen sieben und neun Jahren. Viele weitere stehen vor laufenden Ermittlungen. Im Exil lebende Blogger*innen und Kritiker*innen wurden in Abwesenheit verurteilt.
Wie Tapdig während einer Anhörung zu einer weiteren Verlängerung ihrer Untersuchungshaft vor Gericht erklärte, werden diejenigen, die sich an diesen Verfolgungen beteiligen, „eines Tages nacheinander für das Überleben und den Schutz des Aliyev-Regimes benutzt und dann weggeworfen werden. Sie werden aus dieser Welt scheiden, ohne zu wissen, was freier Wille bedeutet.“ Sie fügte hinzu: „Die Herausforderung für uns Journalist*innen beginnt jetzt. Wir werden die Behörden, die uns bisher durch unsere Nachrichten, Recherchen und Videoberichte kennen, in unserem Prozess von Angesicht zu Angesicht bloßstellen. Bereiten Sie sich gut vor, seien Sie ein wenig kreativ, und durch Sie werden wir die Regierung Aliyev zur Rechenschaft ziehen.“
Diese Worte spiegeln sowohl die Widerstandsfähigkeit als auch die tragische Realität des aserbaidschanischen Journalismus wider. Hinter Gittern sehen sich Journalist*innen weiterhin als Fachleute mit der Pflicht, die Wahrheit aufzudecken, selbst wenn ihnen ihre Freiheit genommen wurde. Unterdessen beharrt die Regierung darauf, von Reformen und „wirtschaftlicher Unabhängigkeit der Medien“ zu sprechen – eine hohle Erzählung, die im Widerspruch zu den Lebenserfahrungen derer steht, die wegen ihrer Arbeit zum Schweigen gebracht wurden.
Der Kontrast zwischen Rhetorik und Realität könnte nicht größer sein. Was bleibt, ist die Entschlossenheit von Menschen wie Tapdig und Elgunesh, die weiterhin an die Mission des Journalismus glauben, selbst wenn sie dafür ihre Freiheit opfern müssen.
Georgien: Georgiens unabhängige Medien unter Druck
„Unterstützen Sie Georgiens bedrängte Zivilgesellschaft und unsere unabhängigen Medien. Setzen Sie sich für die Menschen auf den Straßen, für die Journalisten hinter Gittern, für eine Gesellschaft ein, die sich weigert, sich zu beugen. Georgien Ihre Unterstützung anzubieten, ist nicht nur ein Akt der Solidarität – es ist eine pragmatische Entscheidung. Ein weiteres repressives Regime in der Nachbarschaft würde die Sicherheit Europas gefährden. Georgien jetzt im Stich zu lassen, würde Russlands Aggression belohnen.“ Dies ist ein Auszug aus einem Brief von Mzia Amaghlobeli, der am 27. September in The Guardian veröffentlicht wurde.
Mzia Amaghlobeli, eine georgische Journalistin, befindet sich in Haft – sie ist die erste Journalistin, die in Georgien verhaftet wurde. Die Anklagepunkte und das Urteil gegen sie sind unverhältnismäßig und politisch motiviert.
Die Anschuldigungen und Gerichtsverhandlungen gegen Mzia Amaghlobeli waren für die georgischen Medien ein Beweis dafür, dass es in Georgien keine unvoreingenommenen Anklagen und Gerichte für freie und kritische Journalist*innen mehr gibt. Wir stehen der Macht einer Regierung gegenüber, deren Ziel es ist, uns zum Schweigen zu bringen.
Der Beginn des unverhüllten Terrors
Gewalt, Verfolgung, Einmischung in berufliche Aktivitäten und aggressive Rhetorik sind für georgische Journalist*innen im letzten Jahr zum Alltag geworden.
Am 3. September, während ich bei einer Kundgebung in der Nähe des Wahlhauptquartiers der Regierungspartei meiner journalistischen Arbeit nachging, griffen mich Vertreter der Jugendorganisation „Georgian Dream“ an – einer schlug mich, der andere spuckte mich an. Ihre Gesichter waren nicht verdeckt. Ich forderte die Polizei auf einzugreifen, aber niemand rührte sich.
Vier Tage später, während einer Kundgebung am selben Hauptquartier, stahl dieselbe Person einem unserer Journalist*innen sein Mobiltelefon und griff ihn körperlich an. Von beiden Vorfällen gibt es Videoaufnahmen. Auch diesmal verbarg er sein Gesicht nicht.
In der Vergangenheit wurden Verbrechen gegen Journalist*innen hauptsächlich von maskierten, nicht identifizierbaren Personen begangen. Bei den Ermittlungen wurde oft argumentiert, dass keine Verdächtigen gefunden werden konnten, was in den meisten Fällen absurd war und als Schutz für die an den Verbrechen Beteiligten diente. Trotz formeller Ermittlungen und öffentlicher Identifizierung wurden keine Angreifer vor Gericht gestellt. Die offenen Angriffe auf Journalist*innen durch Personen, die direkt mit Georgian Dream verbunden sind, Anfang September ohne Masken, sind eine neue Stufe des Terrors.
Die Regierungspartei sagt uns, dass es in Georgien kein Gesetz für unabhängige Journalist*innen gibt und dass es keine Strafverfolgungsbehörden gibt. Sie schützen uns nicht und die Angreifer haben völlig freie Hand – sie handeln unter garantierter Straffreiheit und machen sich nicht einmal mehr die Mühe, sich zu verstecken.
Das Ziel von Georgian Dream ist klar: Wir sollen unsere Arbeit nicht mehr fortsetzen. Das Umfeld ist feindselig, Gewalt gegen uns wird geduldet und durch die Äußerungen der Vertreter der Regierungspartei noch weiter verschärft.
Aufgrund unserer kritischen Haltung gegenüber der Regierung warf uns der Vertreter von Georgian Dream, Shalva Papuashvili, vor, durch unsere journalistische Tätigkeit Straftaten zu begünstigen. Er beschuldigte auch die britische Botschaft „Extremismus zu unterstützen“, weil sie den Medien eine Förderung gewährt hatte.
Der Bürgermeister von Tiflis, Kakha Kaladze, kommentierte die Videos, die Gewalt gegen Journalistinnen zeigen, und sagte, er sehe dort keine Frauen, sondern Menschen, die „ihr Gesicht verloren“ hätten.
Dies ist eine groß angelegte Kampagne der Entmenschlichung und Diskreditierung, die die unabhängigen georgischen Medien bedrängt. Das Sicherheitsgefühl unter Journalist*innen ist praktisch auf null gesunken.
Laut der neuesten Studie des Zentrums für Medien-, Informations- und Sozialforschung (CMIS) wurden im vergangenen Jahr 434 Vorfälle gegen Journalist*innen, Medienunternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für Medienrechte in Georgien einsetzen, registriert.
Während der Proteste im Jahr 2024 glich der Angriff auf Maka Chikhladze, eine Journalistin eines der führenden oppositionellen Fernsehsender, einer Szene aus einem Horrorfilm. Dennoch war es Realität: Ein maskierter Angreifer griff sie live während der Sendung an und ihr Kameramann wurde brutal zusammengeschlagen. Obwohl die Identität der Angreifer wahrscheinlich bekannt ist, wurde bis heute niemand festgenommen. Auch für die Gewalt gegen andere Journalist*innen wurde niemand verhaftet.
Neben der physischen Bedrohung hat der „Georgische Traum“ den unabhängigen Medien im Namen der „Transparenz“ den Krieg erklärt.
Die unabhängigen Medien in diesem Land haben aufgrund fehlender Geschäftsmöglichkeiten und der politischen Zurückhaltung, sie zu unterstützen, Schwierigkeiten, sich zu behaupten. Das Gesetz über Zuschüsse schreibt die Genehmigung der Regierung vor, damit Medienorganisationen Finanzmittel erhalten können. Dies ermöglicht es der Regierung, Zuschüsse für unabhängige Medien, die der Regierung kritisch gegenüberstehen, zu blockieren. Dieses System wurde bereits genutzt, um einen Präzedenzfall gegen solche Medien zu schaffen.
Die Regierungspartei ist sich bewusst, dass die Ressourcen für unabhängige Medien in Georgien knapp sind und hat daher Gesetze erlassen, die diese diskreditieren und unterdrücken. Sie behauptet, unabhängige Medien seien „Agenten“ und könnten nur unter staatlicher Kontrolle Fördermittel erhalten.
Aufgrund unserer sowjetischen Geschichte und nicht nur deshalb hat die Registrierung eines Medienunternehmens in Georgien als „Agent ausländischer Einflussnahme” eine negative Konnotation und wird als gegen die Interessen des Landes gerichtet wahrgenommen.
Während der Sowjetzeit hat Georgien diese Phase der Geschichte bereits einmal durchlaufen, als Georgier, die sich gegen die bolschewistische Regierung stellten, zu „Feinden des Volkes” erklärt wurden und unter dem Label „ausländische Agenten” Opfer von Verfolgung und Vernichtung wurden.
Wir wollen diese diskreditierenden Regeln, deren Hauptziel es ist, das Vertrauen der Öffentlichkeit in uns zu zerstören, nicht akzeptieren.
Heute stehen die Medien in Georgien kurz vor dem Aus. Angesichts des Ausmaßes der physischen Bedrohungen, der feindseligen Gesetzgebung und der Beschränkungen des Zugangs zu Informationen scheint eine Fortsetzung der Arbeit oft unvorstellbar – doch noch unvorstellbarer ist es, Georgien ohne unabhängige und kritische Medien zu verlassen.
Deshalb kämpfen wir weiter dafür, unseren Beruf in unserem eigenen Land zu bewahren, um dem georgischen Volk zu dienen, das trotz des Terrors immer noch seine Stimme erhebt, unabhängige Plattformen sucht und bereit ist, seine unterschiedlichen Meinungen gegenüber dem Rest der Gesellschaft furchtlos zu äußern.
Abschließend möchte ich diesen Text mit den Worten von Mzia Amaghlobeli aus einer ihrer ersten Nachrichten aus dem Gefängnis beenden:
„Ich habe nicht die Absicht, die Agenda des Regimes zu akzeptieren. Freiheit ist wertvoller als das Leben.“
Armenien: Ein Blick auf die Medienrealität in Armenien
Seit der Samtenen Revolution 2018 hat Armenien kontinuierlich Fortschritte in Bezug auf Medienfreiheit, Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung gemacht. Das Land nimmt nicht nur in seiner unmittelbaren Nachbarschaft (der Südkaukasusregion), sondern weltweit eine führende Position in Sachen Internetfreiheit ein. Mit nur drei Millionen Einwohnern könnte man argumentieren, dass Armenien über eine unverhältnismäßig große Anzahl von Medien verfügt. Über zwei Dutzend Fernsehsender und Hunderte von Online-Medien sind im Land tätig.
Während die meisten Fernsehsender politisch gebunden sind, hat das armenische öffentlich-rechtliche Fernsehen nach wie vor die höchsten Zuschauerzahlen und die größte Reichweite in allen Regionen des Landes. Neben staatlichen Mitteln erzielt das nationale öffentlich-rechtliche Fernsehen auch Einnahmen aus Werbung, was von anderen Fernsehsendern als Herausforderung angesehen wird, da sie argumentieren, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen den gesamten Werbemarkt in Armenien dominiert.
Unabhängige Medien
Die einzigen unabhängigen und überwiegend webbasierten Medien in Armenien sind diejenigen, die als gemeinnützige Organisationen oder Stiftungen registriert sind, wodurch sie Zuschüsse von internationalen Geberorganisationen erhalten können. Die oben genannten Medien verfolgen eine redaktionelle Politik nach eigenem Ermessen, was jedoch Herausforderungen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und langfristigen strategischen Planung mit sich bringt. Während einige dieser Medien beispielsweise eine starke Online-Präsenz im Bereich Video haben, können sie keine Einnahmen aus ihrer Produktion über die Monetarisierungsoptionen von YouTube erzielen, da es in Armenien keine Werbung über diesen Kanal gibt. YouTube ist in diesem Land einfach nicht offiziell vertreten. Es gibt jedoch erfolgreiche Beispiele für unabhängige Medien, die Patreon und andere Crowdfunding-Tools zur Generierung von Einnahmen nutzen.
Obwohl die Qualität der Berichterstattung insgesamt mit zahlreichen Herausforderungen verbunden ist, angefangen bei der Ausbildung und Schulung armenischer Journalist*innen bis hin zu politisierten Medien (Zugehörigkeit zu politischen Gruppen), Fehlinformationen, Desinformation, Fake News und hybriden Medienbedrohungen, gibt es hoffnungsvolle Anzeichen für unabhängige Faktenprüfungsgruppen und investigativen Journalismus. In den meisten Fällen sind Faktenprüfungs- und investigativjournalistische Medien jedoch ebenfalls auf finanzielle Unterstützung aus dem Ausland angewiesen.
In den letzten zehn Jahren und insbesondere nach dem Krieg von 2020 in Bergkarabach gibt es zahlreiche Beispiele für externen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung, insbesondere in Bezug auf Sicherheitsfragen, und das Problem der Medienkompetenz ist ein Schlüsselbereich, in dem noch viel Arbeit zu leisten ist. Insbesondere nach dem 44-tägigen Krieg in Bergkarabach ist das allgemeine Vertrauen der armenischen Gesellschaft in die Medienberichterstattung sehr gering. Die Menschen stehen der Berichterstattung in den Medien sehr skeptisch gegenüber, insbesondere wenn es um sicherheitsrelevante Themen geht. Dies führt zu einer Situation, in der externe Akteure wie Aserbaidschan und Russland oder mit diesen verbundene Medien, Meinungsmacher*innen und Influencer*innen oft auf der Grundlage von Falschmeldungen oder durch Manipulationen einen dominanten öffentlichen Diskurs schaffen.
Die Cybersicherheit ist eine weitere Herausforderung, insbesondere für unabhängige Medien in Armenien. Während sich das Land auf wichtige Parlamentswahlen im Juni 2026 vorbereitet, ist mit ausländischen Einmischungen aus Russland zu rechnen, wie dies bereits 2025 in Moldawien und Rumänien der Fall war. Unabhängige Medien werden höchstwahrscheinlich eines der Hauptziele sein, weshalb aus Sicht der Cybersicherheit ein großer Bedarf an zusätzlichen Vorbereitungen besteht. Es gibt bereits Beispiele für Hackerangriffe über die Signal-App, von denen bekannte Journalist*innen und Redakteur*innen betroffen waren und die Cybersicherheitsexperten mit vom Kreml geführten Hackergruppen in Verbindung bringen.
Selbstregulierung der Medien und redaktionelle Richtlinien
Eine 2007 gegründete Selbstregulierungsstelle für Medien vereint über 80 armenische Medienunternehmen. Diese Institution genießt unter Medienfachleuten und Medienunternehmen hohes Ansehen und hat sich zum Ziel gesetzt, die Qualität journalistischer Standards und Produktionen positiv zu beeinflussen. Die Organisation vereint sowohl in Eriwan ansässige als auch regionale Medienorganisationen und hat sich bisher als unabhängig funktionierende Institution bewährt. In den Diskussionen um das neue Mediengesetz Armeniens wird auch die Möglichkeit erörtert, dieser selbstorganisierten Ethik-Regulierungsbehörde einen rechtlichen Status zu verleihen, was dieser wichtigen Organisation in Zukunft letztlich mehr Gewicht und Ansehen verschaffen würde.
Die Ausbildung und Schulung unabhängiger Journalist*innen ist ein weiterer problematischer Bereich im Land. Zwar gibt es an der größten armenischen Universität, der Staatlichen Universität Eriwan, einen Fachbereich für Journalismus, doch hat die Fakultät für die zukünftigen Reporter*innen Armeniens keinen großen Mehrwert gebracht. Unsere eigene Medienorganisation hat versucht, mit Absolvent*innen der Journalismusabteilung der YSU zusammenzuarbeiten, und dabei festgestellt, dass die Fähigkeiten und die Berichterstattungskompetenzen der angehenden Journalist*innen auf einem niedrigen Niveau sind. Daher hat eine der erfolgreichsten Organisationen für investigativen Journalismus, Hetq, eine Medienfabrik gegründet, die in den letzten Jahren maßgeblich zur Ausbildung junger professioneller Reporter*innen beigetragen hat. Eine weitere Initiative der US-Botschaft in Armenien ist das Zentrum für unabhängigen Journalismus, das an der American University of Armenia gegründet wurde.
Wie zu Beginn dieses Artikels erwähnt, ist die Gesamtsituation der Medienfreiheit in Armenien im Vergleich zu den letzten drei Jahrzehnten auf einem historischen Höchststand. Diese Realität ist jedoch möglicherweise nicht nachhaltig, da sie auf dem politischen Willen der Regierungspartei basiert, die von einem ehemaligen Journalisten und derzeitigen Premierminister Armeniens geführt wird. Langfristig sind institutionelle und rechtliche Garantien für die Medienfreiheit erforderlich.
Der Artikel erschien zuerst hier: ge.boell.org
Diese Sprachversion wurde mit Deepl übersetzt.