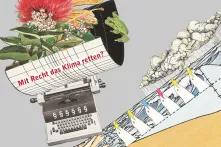Die EU verpflichtet ihre Mitgliedstaaten, schwere Umweltstraftaten härter zu bestrafen. Auch Deutschland muss handeln. Was genau die neue „Ökozid“-Regelung verlangt und worauf es jetzt bei der Umsetzung ankommt – ein kompakter Überblick.

1. Hintergrund der Aufnahme einer „Ökozid“-Regelung in die Richtlinie
Im Jahr 2024 hat die EU ihre Umweltstrafrechtsrichtlinie aus dem Jahr 2008, durch eine umfassende Neuregelung ersetzt. Die neue Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, bestimmte Umweltstraftatbestände in ihre nationalen Rechtssysteme einzuführen, Mindestmaße der Höchststrafen für natürliche Personen sowie der maximalen Sanktionen für juristische Personen vorzusehen und die Strafverfolgung durch eine Reihe von Maßnahmen (z.B. wirksame Ermittlungsinstrumente, ausreichende Ressourcen, angemessene Behördenzusammenarbeit und ein Mindestmaß an statistischen Daten) zu stärken.
In den Trilog-Verhandlungen setzte das Europäische Parlament die Aufnahme von qualifizierten Straftaten durch, die katastrophale Umweltfolgen herbeiführen, die mit „Ökozid“ vergleichbar sind. Dies sind Umweltstraftaten nach der Richtlinie, die
- ein Ökosystem von beträchtlicher Größe oder ökologischem Wert, einen Lebensraum innerhalb eines geschützten Gebiets oder die Luft-, Boden- oder Wasserqualität zerstören oder
- entweder irreversibel oder dauerhaft großflächig und erheblich schädigen.
Der Begriff „Ökozid“ ist bisher vor allem aus der Diskussion um eine Ausweitung des Rom-Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs bekannt, insbesondere aus dem Vorschlag eines Ökozid-Straftatbestands durch das Unabhängige Expertengremium für die rechtliche Definition von Ökozid (IEP). Außerdem haben einige Staaten bereits eine Regelung für „Ökozid“ in ihr Strafrecht aufgenommen, etwa Frankreich und Belgien.
Dieser Beitrag soll einen kurzen Überblick über die „Ökozid“-Regelung der neuen Umweltstrafrechtsrichtlinie geben und Umsetzungsmöglichkeiten in Deutschland aufzeigen. Er beruht auf einem Rechtsgutachten, das ich im Mai 2025 für Stop Ecocide Deutschland erstellt habe (Die Umsetzung der "Ökozid"-Regelung der überarbeiteten Umweltstrafrechts-Richtlinie in deutsches Recht | Ecologic Institut). Abschließend wird knapp auf den kürzlich veröffentlichten Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums eingegangen.
2. Vorgaben der neuen Umweltstrafrechtsrichtlinie zu „Ökozid“
Wenn als Folge einer der Handlungen, die die Mitgliedstaaten in ihren nationalen Rechtssystemen als Umweltstraftaten bestrafen müssen (der sog. Grundtatbestand), die in der Einleitung genannten „Ökozid“-artigen Folgen eintreten (die sog. Qualifikation), müssen die Mitgliedstaaten nach der Richtlinie zwingend eine strengere Bestrafung vorsehen. Für natürliche Personen ist dies eine Freiheitsstrafe, die bis zu acht Jahren betragen kann (sog. Mindesthöchststrafe). Juristische Personen können unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls für solche Straftaten verantwortlich sein. In diesem Fall müssen die – nicht notwendigerweise strafrechtlichen – Sanktionen strenger sein als diejenigen für den Grundtatbestand. Die Geldstrafen bzw. Geldbußen für „normale“ Umweltstraftaten betragen je nach Kategorie maximal 5 bzw. 3 % des jährlichen weltweiten Gesamtumsatzes oder einen festen Beitrag von bis zu 40 bzw. 24 Mio. Euro.
Voraussetzung der strengeren Bestrafung ist, dass die Tatbestandsvoraussetzungen der qualifizierten Straftat erfüllt sind. Dazu müssen erstens die Vorgaben der Richtlinie hinsichtlich der Grundtatbestände und der Qualifikation erfüllt sein. Wenngleich einzelne Begriffe wie das „Ökosystem“ von der Richtlinie definiert werden, enthält die „Ökozid“-artige Folge eine Fülle von sog. unbestimmten Rechtsbegriffen wie „dauerhaft“ oder „großflächig“. Diese müssen entweder von den Mitgliedstaaten präzisiert oder von den Strafverfolgungsbehörden, letztlich den Gerichten, ausgelegt werden.
Außerdem muss die Tatbestandsverwirklichung vorsätzlich und rechtswidrig erfolgen. Es ist nicht eindeutig, ob die Richtlinie Vorsatz nicht nur für den Grundtatbestand, sondern auch für die Qualifikation verlangt. Wie im deutschen Strafrecht (vgl. § 11 Abs. 2 StGB) dürfte für eine vorsätzliche Begehung ausreichen, dass die schwere Folge fahrlässig herbeigeführt wurde. Rechtswidrig ist die Tat, wenn sie gegen EU-Umweltrecht oder nationales Umsetzungsrecht verstößt. Zu beachten ist, dass die Rechtswidrigkeit nicht generell durch eine Genehmigung ausgeschlossen wird. Obwohl das Umweltstrafrecht grundsätzlich nicht bestrafen soll, was verwaltungsrechtlich erlaubt ist (sog. Verwaltungsakzessorietät), sieht die Richtlinie Ausnahmen für die rechtsmissbräuchliche Erlangung der Genehmigung oder offensichtliche Verstöße gegen bestimmte einschlägige Anforderungen vor.
3. Umsetzungsvorschläge für Deutschland
a) Regelung für natürliche Personen
Die „Ökozid“-Regelung der Umweltstrafrechtsrichtlinie bedarf der Umsetzung in Deutschland, da es im deutschen Recht bisher keine Regelung für „Ökozid“-artige Fälle gibt. Zwar regelt § 330 des Strafgesetzbuchs (StGB) den besonders schweren Fall einer Umweltstraftat, wozu auch die Beeinträchtigung eines Gewässers, des Bodens oder eines Schutzgebiets im Sinne des § 329 Abs. 3 gehört, die nicht, nur mit außerordentlichem Aufwand oder erst nach längerer Zeit beseitigt werden kann (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2). Diese partielle Überschneidung genügt den Anforderungen der Richtlinie aber nicht, wie u.a. an der fehlenden Erfassung von Ökosystemen deutlich wird.
Vor diesem Hintergrund bieten sich zwei grundsätzliche Möglichkeiten an, die „Ökozid“-Regelung in deutsches Recht umzusetzen. Die erste Option besteht darin, in § 330 StGB einen zusätzlichen besonders schweren Fall einer Umweltstraftat aufzunehmen, der den Vorgaben der Richtlinie entspricht. Dies müsste im Absatz 2 erfolgen, da nur dort Qualifikationstatbestände geregelt sind, die zwingend zu einem strengeren Strafrahmen führen. Der Wortlaut des § 330 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 StGB könnte als Ausgangspunkt für die Anpassungen an die Richtlinie genommen werden. Als Strafrahmen sollten nicht die von der Richtlinie vorgesehenen maximal acht Jahre Freiheitsstrafe übernommen werden, sondern in Entsprechung zu den anderen Fällen des § 330 StGB (außer der Todesverursachung) eine Mindesthöchststrafe von zehn Jahren. Eine Herausforderung bliebe der Umgang mit den unbestimmten Rechtsbegriffen der Richtlinie. Dabei könnten die Definitionen im Vorschlag des IEP für einen völkerstrafrechtlichen Ökozid-Straftatbestand (s.o.) sowie die Umsetzungsvorschläge für EU-Mitgliedstaaten im Manual for a National Criminalisation of Ecocide bis zu einem gewissen Grad weiterhelfen.
Die andere Möglichkeit besteht darin, bereits die Gefahr einer „Ökozid“-artigen Folge unter Strafe zu stellen. Dies wäre mit der Richtlinie vereinbar, da diese lediglich Mindestanforderungen stellt. Das Anknüpfen an die bloße Gefährdung hätte den Vorteil, dass nicht ein irreversibler oder dauerhafter Umweltschaden abgewartet zu werden braucht, und dass der in der Praxis oft schwierige Nachweis, wem der Schaden zugerechnet werden kann, entfiele. Wird jedoch wie in den bestehenden Fällen des § 330 StGB mit Gefährdungsfolge das Vorliegen einer konkreten Gefahr gefordert, ist dessen Nachweis auch nicht einfacher zu führen. Stattdessen könnte aber an die Eignung der betreffenden Handlung, die „Ökozid“-artige Folge herbeizuführen, angeknüpft werden. Diese generelle Gefahr müsste im Einzelfall festgestellt werden, ggf. unter Heranziehung eines Sachverständigen. Um die Vorverlagerung der Strafbarkeit auszugleichen, sollte bei dieser alternativen Option Vorsatz oder zumindest Leichtfertigkeit (grobe Fahrlässigkeit) bzgl. der schweren Folge verlangt werden. Als Regelungsort kommt entweder ebenfalls § 330 StGB oder ein eigener „Ökozid“-Straftatbestand in Betracht.
b) Regelung für Unternehmen
Auch für juristische Personen besteht Anpassungsbedarf im deutschen Recht. Die sog. Verbandsgeldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ermöglicht es unter bestimmten Bedingungen, für Straftaten des Leitungspersonals oder für Aufsichtspflichtverletzungen, die Straftaten durch Mitarbeiter unterhalb der Leitungsebene wesentlich erleichtert haben, gegen das Unternehmen eine sog. Verbandsgeldbuße zu verhängen. In diesen Fällen gilt aber eine maximale Bußgeldhöhe von 10 Mio. Euro, die nur zum Zweck der Abschöpfung des unrechtmäßig erlangten Vorteils überschritten werden darf.
Insoweit gibt es ebenfalls zwei grundsätzliche Umsetzungsmöglichkeiten. Entweder wird die Umsetzung der Umweltstrafrechtsrichtlinie zum Anlass genommen, einen neuen Anlauf zu einem eigenständigen Gesetz über Unternehmenssanktionen zu nehmen, nachdem der Entwurf eines „Verbandssanktionengesetzes“ im Jahr 2021 gescheitert war. Die Sanktionen sollten dann an den Jahresumsatz anknüpfen, was die wirtschaftlichen Verhältnisse kleinerer Unternehmen berücksichtigt. Innerhalb der Umsetzungsfrist von zwei Jahren wäre ein solcher Weg jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen.
Der einfachere, wenn auch weniger ambitionierte Weg bestände in einer Reform des OWiG. In diesem Fall böte sich eine Anpassung der bestehenden absoluten Bußgeldbeträge an. In beiden Fällen sollte sich die für „Ökozid“-artige Fälle strengere Sanktionierung an dem Strafrahmen für natürliche Personen orientieren. Nach der Systematik der Richtlinie käme man damit auf 8 % des Jahresumsatzes bzw. 64 Mio. Euro. Nach der Systematik des StGB, die für eine Bestrafung natürlicher Personen mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe spricht, wären jedoch 10 % bzw. 80 Mio. Euro angemessen.
4. Umsetzung der Richtlinie im Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums
Der am 17.10.2025 veröffentlichte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafrechts – Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1203 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) sieht vor, die „Ökozid“-Regelung der Richtlinie als neuen Qualifikationstatbestand in § 330 Abs. 2 Nr. 1 und 2 neuer Fassung StGB umzusetzen. Dieser setzt voraus, dass die Ökozid-artigen Folgen tatsächlich eintreten (sog. Erfolgsqualifikation). Für Unternehmen wird eine Umsetzung im OWiG dergestalt vorgesehen, dass die Höchstbeträge der Verbandsgeldbußen bei Straftaten oder entsprechenden Aufsichtspflichtverletzungen einer Leitungsperson auf 40 Mio. bei Vorsatz bzw. 20 Mio. Euro bei Fahrlässigkeit erhöht werden. Eine strengere Verbandsgeldbuße für den Fall, dass es sich bei der vorsätzlichen Straftat um den neuen Qualifikationstatbestand des § 330 Abs. 2 Nr. 1 bzw. 2 StGB handelt, hält das BMJV für entbehrlich, da bereits § 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) die Möglichkeit vorsehe, Unternehmen bei nachweislich schweren Verfehlungen durch den zusätzlichen Ausschluss von Vergabeverfahren strenger zu sanktionieren.
In Bezug auf natürliche Personen folgt der Referentenentwurf somit der ersten der unter 3 a) dargestellten Umsetzungsmöglichkeiten, nämlich eine enge Anlehnung an die Vorgaben der Umweltstrafrechtsrichtlinie, auch wenn der Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe darüber hinausgeht. Wie gut dieser Weg in der Strafverfolgungspraxis funktionieren wird, insbesondere bzgl. der angesprochenen Nachweisschwierigkeiten, wird sich zeigen. Hinsichtlich der Verbandsgeldbuße für Unternehmen folgt der Entwurf der zweiten der unter 3 b) dargestellten Umsetzungsmöglichkeiten, der Umsetzung im OWiG. Bedauerlicherweise wurde somit die erneute Gelegenheit versäumt, ein modernes Gesetz über Unternehmenssanktionen einzuführen. Außerdem erscheint der gewählte Weg jedenfalls in Bezug auf die maximale Bußgeldhöhe von 20 Mio. Euro für fahrlässige unternehmensbezogene Straftaten unvereinbar mit der Richtlinie, die für bestimmte Umweltstraftaten, die auch leichtfertig begangen werden können, eine Sanktion in Höhe von bis zu 24 Mio. Euro verlangt.
[1] Richtlinie 2008/99/EG vom 19.11.2008 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt, ABl. L 328, S.28.
[2] Richtlinie (EU) 2024/1203 vom 11.4.2024 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt und zur Ersetzung der Richtlinien 2008/99/EG und 2009/123/EG, ABl. L 2024/1203 vom 30.4.2024.
[3] Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, Commentary and Core Text, Juni 2021, (zuletzt aufgerufen am 11.11.2025).
[4] Working Group on the National Criminalisation of Ecocide, Manual for a National Criminalisation of Ecocide, Stand 12. Februar 2025, (zuletzt aufgerufen am 11.11.2025).
[5] Gesetz zur Änderung des Strafrechts – Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1203 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (zuletzt aufgerufen am 11.11.2025).
[6] Siehe S. 68 f. des Referentenentwurfs, ebenda.