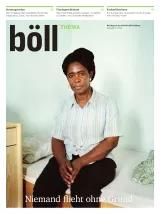Michael Oberts Reportage im SZ- Magazin über die brutalen Geschäfte mit eritreischen Flüchtlingen auf der Sinai-Halbinsel wurde in ganz Deutschland mit Entsetzen aufgenommen. Petitionen wurden lanciert, deutsche Tageszeitungen, Radio- und TV-Sender griffen das Thema auf, dem Autor wurde der Otto-Brenner-Preis verliehen. Für Böll.Thema erinnert er sich an seine Recherchen, die ihn immer mehr aus der Routine seines Berufsstandes rissen und auch Grundsätze ins Wanken brachten: Denn Michael Obert entschied sich, Partei zu ergreifen für diese Menschen, die auf der Flucht gedemütigt, misshandelt, umgebracht werden, und um Hilfe für sie zu bitten. Was hat sich verändert für die Menschen in Eritrea, für Selomon, den Protagonisten seiner Reportage, der die Folter schwer verstümmelt überlebt hat?
Zum ersten Mal hörte ich von den Foltercamps auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel bei einer Reise durch Ostafrika im Herbst 2010. Auf ihrem Weg nach Israel sollen afrikanische Migrant/innen von Beduinen gefangen genommen und in Wüstencamps gefoltert worden sein, um Lösegelder zu erpressen. Afrika ist groß. Unfassbare Geschichten werden überall erzählt. Ich staunte und vergaß es wieder. Mehr als ein Jahr später saß ich in Mogadischu in einem zerbombten Haus. Granatsplitter steckten in den Wänden, draußen krachten Schüsse. Die Frau im zerschlissenen Gewand erzählte mir weinend von ihrer Tochter. Auf dem Weg nach Libyen, wo diese auf ein Flüchtlingsboot nach Europa gehofft hatte, sei sie entführt und in den Sinai verschleppt worden. Regelmäßig klingelte bei ihrem Bruder, der in London lebte, das Telefon. Wenn er abnahm, hörte er seine Schwester am anderen Ende der Leitung um Hilfe schreien, während sie gefoltert wurde. Damals waren die Lösegeldforderungen noch vergleichsweise moderat. "10.000 Dollar!", schrien die Beduinen ins Telefon. "Oder wir schlitzen deine Schwester auf." Heute, keine zwei Jahre später, verlangen die Menschenhändler bis zum Fünffachen.
Tausende namenlose Leichen
Das war im Frühjahr 2012. Ich kam zurück und fing an zu recherchieren. Die Foltercamps und der damit verbundene vermutete Organhandel waren von den Medien zwar gestreift worden, eine fundierte Reportage gab es nicht. Und wie sich herausstellte, ging es nicht nur um ein paar vereinzelte afrikanische Migranten, wie ich zuerst angenommenhatte. Es ging um Tausende von Menschen. Sie wurden – und werden bis heute – auf bestialische Weise gefoltert und ermordet. Ihre namenlosen Leichen verrotteten damals in der Wüste. Aber niemand schien sich dafür zu interessieren. Der Nordsinai ist ein Territorium ohne Recht und Gesetz. Während Urlauber/innen im Süden der Halbinsel an Hotelstränden in der Sonne baden, versetzen bewaffnete kriminelle Banden und militante Islamisten den Norden in Angst und Schrecken. Sie verüben Bombenanschläge auf Gasleitungen und feuern mit Maschinengewehren und Raketen auf Polizeistationen und Checkpoints. Immer wieder gibt es Tote. Experten fürchten, auf dem Sinai könnte eine neue Operationsbasis für das Terrornetzwerk al-Qaida entstehen.
In diesem Chaos gehen die Kidnapper und Folterer – laut den Vereinten Nationen eines der weltweit grausamsten Netzwerke des Menschenhandels – unbehelligt ihren blutigen Geschäften nach. Über die Menschenrechtsorganisation Physicians for Human Rights konnte ich in Tel Aviv mehrere Opfer ausfindig machen, die es nach ihrer Freilassung aus dem Sinai nach Israel geschafft hatten; darunter Selomon, der Protagonist meiner Reportage, der in den Foltercamps beide Hände verloren hatte.
In Tel Aviv sprach ich mit den Opfern, um danach mit ihren unfassbar grausamen Geschichten im Gepäck in den Sinai aufzubrechen und dort gemeinsam mit dem Fotografen Moises Saman nach den Camps und den Folterern zu suchen. Rund 1.000 afrikanische Migrant/innen, so die Schätzungen, sollten zu der Zeit auf der Halbinsel gefangen gehalten und gefoltert werden. Die ägyptische Geheimpolizei, die Schmuggler, die Islamisten, die Menschenhändler – niemand wollte uns hier haben. Wo immer wir nach den tausend afrikanischen Geiseln und den Foltercamps der Beduinen fragten – beim Gouverneur, bei der Militärführung, bei den Generälen der Grenzpatrouillen –, schlossen sich die Türen, wurden Telefongespräche unterbrochen und eben noch freundliche Gesichter zu steinernen Masken. Es war, als suchten wir nach Gespenstern.
In die Stammesgebiete der Beduinen, jenseits der Stadtgrenzen von al-Arish, wagen sich nicht einmal die ägyptische Polizei oder das Militär. Islamisten und Schmuggler sind bis an die Zähne bewaffnet. Es dauerte Tage, bis wir jemanden fanden, der bereit war, uns dorthin zu begleiten. "Die Banden sehen ein fremdes Auto mit zwei Weißen auf dem Rücksitz", erklärte uns Abdel, ein Beduine mit spitz zulaufendem Wieselgesicht, den wir über Kollegen der New York Times ausfindig machten. "Sie handeln schnell: Erst nehmen sie euren Wagen, dann seid ihr dran." Zwei Optionen hätten wir in einem solchen Fall: "Entführung oder eine Kugel in den Kopf." Abdel sprach nur Arabisch. Wir arbeiteten mit einem vertrauenswürdigen Ägypter zusammen, den ich bereits kannte und der für uns ins Englische übersetzte. In einem Beduinentaxi umfuhren wir die Checkpoints am Ortsausgang von al-Arish und folgten den Wüstenpisten durch die Stammesgebiete in Richtung israelische Grenze.
Ohne Leute wie Abdel, ohne einen exzellenten Fixer, kommt in Gegenden wie dem Sinai keine hochkarätige Geschichte zustande. Es war Abdel, der uns für ein Tageshonorar von 200 Dollar zu anonymen Massengräbern, zu Beduinenscheichs und in die Nähe der Foltercamps brachte. Doch Abdel war weit mehr als ein Informantenlieferant. Weitab jeglicher rechtsstaatlicher Struktur, in einem wüstenhaften Gebiet von der Größe Bayerns, in dem es keine Polizei, kein Militär, keine Gesetze gibt – in einem solchen Niemandsland ist der Fixer auch die Lebensversicherung des Journalisten. Schon nach den ersten Häusern in al-Mehdia, das als gefährlichster Ort auf dem Sinai gilt, tauchten Pick-ups mit aufgebockten Maschinengewehren auf; dahinter junge Beduinen, die Gesichter mit rotweißen Tüchern vermummt, die Finger am Abzug. Abdel streckte den Kopf aus dem Fenster – sie kannten ihn und winkten uns durch. "Wenn du hier nicht dazugehörst", sagte er, "bist du tot."
Tee trinken mit einem Mörder
Ohne Abdel gäbe es meine Reportage nicht. Ich erinnere mich noch genau, wie sich am Ende unserer Reise durch die Stammesgebiete die Sonne dem Horizont näherte, wie wir uns auf einer Matte in der Wüste niederließen – um Tee zu trinken mit einem Mörder. Es hatte unzählige Telefonate und Abdels ganze Überredungskunst gebraucht, bis sich einer der Folterer bereit erklärte, mit uns zu sprechen. Von dem massigen Beduinen in Pumphose wollten wir wissen, was in einem vorgeht, wenn man Afrikaner zu Tode quält.
"Nichts", sagte er und lächelte. "Ich bekam regelmäßig mein Geld." Der Lohn des Folterknechts: knapp 120 Euro im Monat. Der Mann ließ keinerlei Anzeichen von Mitgefühl erkennen. Stattdessen erzählte er, wie die Beduinen Frauen in Strohzäune einrollten und anzündeten; wie sie ein Baby von der Brust der Mutter rissen, es erwürgten und damit Fußball spielten; wie sie ein Erdloch mit Glut füllten, einen Metallrost darüber legten und ihre Opfer auf die glühenden Stäbe warfen. "Afrikanisches Barbecue", sagte der Mann und nippte an seinem Tee. "Schwarzes Fleisch."
Ich hatte die Zeugenaussagen der Opfer in Tel Aviv studiert, Hunderte Seiten der Interviews gelesen, die Physicians for Human Rights über mehrere Jahre mit Opfern geführt hatte. Was der Folterer nun erzählte, deckte sich in allen Einzelheiten mit meinem Vorwissen. Auch Abdel ließ keinen Zweifel daran: Was der Mann sagte, stimmte.
Natürlich war der Name unseres Fixers nicht Abdel. Ihn zu anonymisieren, hat ihn aber nicht gerettet. Jahrelang hatte er auf Schleichwegen ausländische Journalisten durch den Sinai geführt, zu Schmugglertunnels, zu radikalen Islamisten und zuletzt uns zu Menschenhändlern und Folterern. Wenige Wochen nach unserer Abreise holten ihn bewaffnete Männer ab; monatelang fehlte von ihm jede Spur. Als er wieder auftauchte aus den Kerkern der ägyptischen Regierung, war er bis auf die Knochen abgemagert, sein Blick der eines gebrochenen Mannes.
Enorme Hilfsbereitschaft
Nach Erscheinen der Reportage im SZ-Magazin war das Echo umwerfend. Mich erreichten Hunderte von Mails und Briefen. Mir unbekannte Leser recherchierten meine private Telefonnummer und weinten am anderen Ende der Leitung. Petitionen wurden lanciert, deutsche Tageszeitungen, Radio- und TV-Sender griffen das Thema auf. Nach dem Erstabdruck im SZ-Magazin wurde die Reportage komplett oder in Auszügen unter anderem veröffentlicht in Tagesanzeiger Magazin (Schweiz), Die Presse (Österreich), Sunday Times Magazine und Dagens Næringsliv (Norwegen) sowie in einer Reihe englischsprachiger Blogs. Um die enorme Hilfsbereitschaft meiner Leserinnen und Leser nicht verpuffen zu lassen, formulierte ich mit der Hilfsorganisation medico international in Frankfurt einen spontanen Spendenaufruf für die offene Klinik der Physicians for Human Rights, die in Tel Aviv seit Jahren Folteropfer versorgen. Über 30.000 Euro sind seither eingegangen.
Das Auswärtige Amt lud mich zu Beratungsgesprächen ein, was von deutscher Seite aus gegen den Menschenhandel auf dem Sinai unternommen werden könnte. Ich empfahl, politischen Druck auf die ägyptische Regierung auszuüben, damit diese die Täter im eigenen Land zur Verantwortung ziehe und den Menschenhandel auf dem Sinai beende. Ich empfahl konkrete Projekte, unter anderem in den Flüchtlingscamps der Vereinten Nationen im Sudan, aus denen eritreische Flüchtlinge unter den Augen von UN-Soldaten massenweise von Menschenhändlern entführt werden.
Die deutschen Außenpolitiker schrieben alles ganz genau auf und stellten in Aussicht, noch im selben Jahr konkrete Projekte zu lancieren. Doch am Ende wurde die deutsche Bundesregierung meines Wissens nicht aktiv. Weder im Sinai noch in Ägypten noch im Sudan oder in Eritrea. Meine E-Mail-Anfragen blieben unbeantwortet.
Acht Monate Martyrium
Und die Horrormeldungen aus dem Sinai reißen nicht ab: Lastwagen voller entführter Flüchtlinge kommen weiterhin dort an. Und alle erwartet dasselbe grausame Schicksal, wie es der Protagonist meiner Reportage durchleiden musste. Selomon, den jungen Eritreer, hängten die Folterer tagelang an Eisenketten an die Decke. Als er heruntergelassen wurde, waren seine Hände abgestorben. Er würde seine Finger nie mehr spüren. Acht Monate dauerte sein Martyrium. Dann konnte seine Schwester das Lösegeld von 30.000 Dollar bezahlen. Am 26. Juni 2012 werfen die Beduinen Selomon in der Nähe der israelischen Grenze in die Wüste. Er hat die Hälfte seines Körpergewichts verloren, wiegt nur noch wenig mehr als 40 Kilo, kann nicht mehr stehen, kaum mehr sprechen. Drüben in Israel müssen Chirurgen einen Großteil seiner Hände amputieren.
Nach einer sogenannten Grundregel des Journalismus, die oft bemüht wird, solle sich ein Journalist mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Dann bin ich kein Journalist. Und will keiner sein. Ich bin kein Schreibroboter. Ich bin ein Mensch. Unter Menschen. Was ich unterwegs erlebe, schmerzt manchmal. Und manchmal fließen Tränen. Und manchmal ruft eine innere Stimme: Handle! Setz dich ein! Betrüge dein Gewissen nicht mit irgendwelchen Grundregeln. Monatelang versuchte ich, in Deutschland ein Krankenhaus zu finden, wo die Handstummel von Selomon versorgt werden könnten.
Wie es weitergeht
Fast ein halbes Jahr nach Erscheinen im SZ-Magazin flog schließlich ein deutscher Mikrochirurg nach Tel Aviv, um ihn zu untersuchen. Nach einem Jahr ist es mir mit verbündeten Lesern und Aktivisten endlich gelungen, Selomon nach Deutschland zu holen. Vor wenigen Wochen wurde er in einem Münchner Klinikum an der rechten Hand erfolgreich operiert und ist derzeit in Reha-Behandlung, um seine Greiffähigkeit zu trainieren. Finanziert wurde das alles von Lesern meiner Reportage.
Aktuell wohnt Selomon bei Freunden in privater Unterkunft und besucht einen Deutschkurs. Sein Asylverfahren läuft und sieht vielversprechend aus. Sobald Selomon offiziell in Deutschland aufgenommen ist, will er studieren. Informatik, das Fach, mit dem er vor seiner Odyssee durch die Fänge der Menschenhändler in Eritrea begonnen hat und für das er eine große Leidenschaft hegt.
Dieser Text erschien in der aktuellen Ausgabe von Böll.Thema.