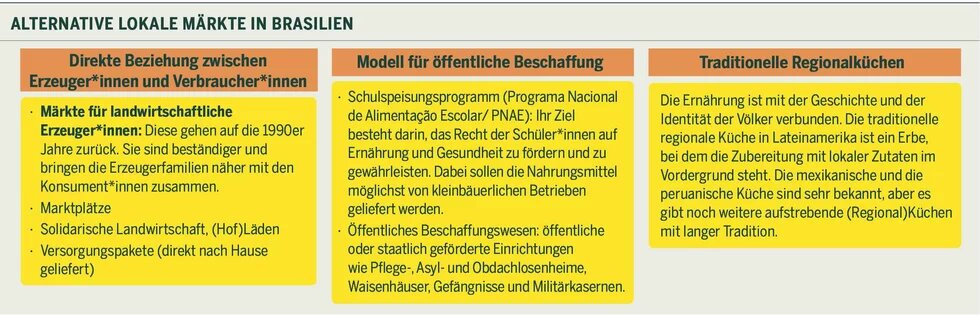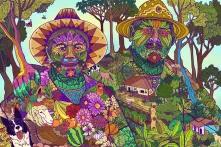Eine der größten Herausforderungen für die Umsetzung agrarökologischer Prinzipien ist die Logistik: wie kommen Lebensmittel, die auf dem Land erzeugt werden, zu Verbraucher*innen andernorts. Erprobte Konzepte können helfen, diese Herausforderungen zu überwinden.

Eine der größten Herausforderungen für die Umsetzung agrarökologischer Prinzipien ist die Logistik: wie kommen Lebensmittel, die auf dem Land erzeugt werden, zu Verbraucher*innen andernorts. Alternative Vertriebswege, Märkte und andere Konzepte, wie die sogenannte community-supported agriculture (CSA) [Anmerk. d. Redaktion: im deutschsprachigen Raum solidarische Landwirtschaft], wurden entwickelt, um diese Herausforderungen zu überwinden.
Freihandelsabkommen und andere staatliche Politikinstrumente unterstützen ein agrarindustrielles System, welches viele Zwischenschritte erfordert, um Lebensmittel zu erzeugen, zu transportieren und zu vermarkten. Früher war es üblich, dass Produkte innerhalb einer bestimmten Region blieben und etwa im Rahmen regionaler Land- und Viehwirtschaftsmessen gehandelt wurden. Erzeuger*innen und Verbraucher*innen trafen regelmäßig aufeinander, sie schufen über das eigentliche Geschäft hinaus Verbindungen miteinander. Heutzutage legen Lebensmittel oft lange Transportwege zurück. Agrarökologische Betriebe versuchen, wieder kürzere und somit engere Handelsbeziehungen wiederherzustellen, damit Gemeinschaften ihre Überschüsse zu fairen Preisen und unter menschenwürdigen Bedingungen vermarkten können.
Seit 1998 gibt es in Brasilien das Netzwerk Rede Ecovida, eine dezentrale Organisation, die inzwischen mehr als 27 regionale Zentren hat, die 352 Gemeinden erreichen. 340 Bäuer*innen, rund 4.500 Familien und 20 Nichtregierungsorganisationen sind über das Netzwerk verbunden und haben sich über inzwischen 120 verschiedene Märkte mit eigenen Vermarktungswege zusammengeschlossen.
Auch in Brasilien gibt es mehr und mehr Initiativen, die als „Landwirtschaft der geteilten Verantwortung“ („Agricultura de Responsabilidade Compartilhada“) oder „community-supported agriculture “ bekannt sind und die (Klein)Bäuer*innen und Verbraucher*innen näher zusammenbringen. In der Stadt Florianópolis gibt es beispielsweise die sogenannten „Zellen verantwortungsbewusster Verbraucher*innen“ („Células de Consumidores Responsáveis“). Dahinter verbirgt sich eine Ein- und Verkaufsgemeinschaft, in der Verbraucher*innen einen solidarischen Jahresbeitrag zahlen und dafür jede Woche Lebensmittel erhalten – der je nach Ernte variieren kann. Auf diese Weise teilen sich Verbraucher*innen und Erzeuger*innen mögliche Risiken etwa bei Ernteausfall, und die (Klein)Bäuer*innen haben sichere jährliche Einkünfte und können sich auf den Anbau konzentrieren.
Erzeuger*innen auf dem Land und Verbraucher*innen in der Stadt tauschen sich regelmäßig aus. Auch die (Klein)Bäuer*innen stehen viel im Austausch miteinander, wie das Beispielt der Organisation der Bio-Kakaobäuer*innen von Chontalpa im mexikanischen Bundesstaat Tabasco zeigt. Hier sind 642 Erzeuger*innen organisiert, die durchschnittlich 1,7 Hektar Land bewirtschaften und seit 15 Jahren nicht nur den Kakaobedarf der Region decken, sondern auch Biodiversität dieser bewahren. Einer ihrer Sprecher erklärt: „Zunächst müssen wir sicherstellen, dass wir Kakao für den Konsum in der Region haben: Wir benötigen ihn tagtäglich für Pozol [Anmerk. d. Übersetz.: Ein dickflüssiges, nahrhaftes Getränk aus Kakao und Mais, das vor allem im Süden Mexikos, in den Bundesstaaten Tabasco und Chiapas, konsumiert wird, wo das traditionelle Getränk ursprünglich herstammt], ein Getränk, das uns Energie für die Arbeit gibt. An erster Stelle stehen wir, dann teilen wir den Rest mit dem Markt.“
Was vor Ort nicht konsumiert wird, geht in die Städte, vor allem den lokalen Märkten treffen städtische und stadtnahe Erzeuger*innen sowie Verarbeitungsbetriebe von Lebensmitteln aufeinander. In Lima in Peru gibt es ca. 20 Märkte, auf denen besonders Frauen aus diversen Organisationen zusammentreffen, etwa das Netzwerk zur Förderung der Urbanen Landwirtschaft und Ernährungssicherheit (Red Promotora de Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria/ RED-PRAUSA) , der aus Stadtgärtner*innen bestehenden Vereinigung COSANACA und der Vereinigung Monticelo. Peruaner*innen haben ein besonderes Verhältnis zur peruanischen Gastronomie und Esskultur, und die direkte Zusammenarbeit von Köch*innen und (Klein)Bäuer*innen ist verbreitet. Ein Beispiel dafür ist die Gastronomie-Festival MISTURA, die jedes Jahr rund 30.000 Menschen verköstigt und das Bewusstsein für die Qualität peruanischer Produkte untermauert. Dort treffen 350 Bäuer*innen aus allen Regionen Perus zusammen, und jedes Jahr nehmen mehr als 50 Restaurants, 70 Food Trucks und etwa 16 sogenannte rustikale Küchen teil.
Ein weiteres Beispiel für gute Zusammenarbeit zur Förderung der Agrarökologie sind die lokalen Märkte in Uruguay. Der Atlántida-Markt in Canelones ist aus einem Projekt der Nationalen Kommission für ländliche Entwicklung, des Agrarökologischen Netzwerks, des Slow Food Vereins und der Einwohnerkommission der Stadt Estación Atlántida hervorgegangen. Auf dem Markt sollen agrarökologische Produkte direkt vermarktet werden. In Argentinien wurden im Rahmen einer vom Interregionalen Netzwerk der agrarökologischen Verbrauchsknotenpunkte (Red Interregional de Nodos de Consumo Agroecológico) organisierten Erhebung etwa 30 agrarökologische Gemeinden, 21 sogenannte Verbrauchsknotenpunkte, 125 Märkte, über 300 Gemüsegärten mit Direktverkauf und 15 gemeinschaftlich betriebene Kompostierungsanlagen erfasst. Zu diesen Initiativen kommen Projekte von Bauern- und Kleinerzeugerorganisationen wie der Ländliche Verband für Produktion und Verwurzelung (Federación Rural para la Producción y el Arraigo), das Bündnis der Landarbeiter*innen und die Nationale indigene Kleinbauernbewegung La Vía Campesina hinzu, die verschiedene Strategien für ihre agrarökologischen Erzeugnisse verfolgen: kurze Vermarktungswege, Lager und Märkte im ganzen Land.
In Mittelamerika sind die Vertriebsmethoden ebenfalls sehr unterschiedlich. In Honduras gibt es Organisationen wie das Lateinamerikanische Netzwerk für gemeinschaftliche Vermarktung (Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria/ RELACC), in Nicaragua das Nicaraguanische Handelsnetz und in Costa Rica ein ausgedehntes Netz von Bio- und agrarökologischen Läden und Märkten, verkauft aber auch direkt an der Haustür, was während der COVID19-Pandemie sehr stark nachgefragt war.
Agrarökologische Vermarktungskreisläufe stärken Frauen in ländlichen Gebieten: mit ihren Betrieben können sie Geld verdienen und Perspektiven entwickeln, die mehr als die unbezahlte Sorgearbeit in Haus und Hof umfassen. In Kolumbien sind im Verwaltungsbezirk Antioquia in den 1990er Jahren bäuerliche Frauenorganisationen entstanden, die u.a. Märkte aufgebaut haben, um ihre Produkte zu verkaufen. Dazu gehören die Frauenvereinigung von Caramanta, die Vereinigung der organisierten Frauen von Yolombó und die Subregionale Vereinigung der Frauen des Südwestens (ASUBMUS). Letztere wurde 2008 gegründet und umfasst rund 300 Frauen aus 14 Gemeinden der Region Antioquias. Die Stärke dieser Netzwerke beweist, dass Märkte nicht nur dem Handel dienen, sondern auch dem Erfahrungsaustausch und der Stärkung bäuerlich-feministischer Bewegungen.
Um den agrarökologischen Ansatz zu stärken, fördern viele Bäuer*innenorganisationen in Lateinamerika die Strukturen und Netzwerke, über die Nahrungsmittel vertrieben werden. Während das Agrobusiness den Bäuer*innen ihre Erzeugnisse oft zu Spottpreisen abkauft, den Zwischenhandel monopolisiert und die Nahrungsmittel auf ihren Warencharakter reduziert, wollen Bäuer*innen, die agrarökologisch anbauen, ihre Produkte der Allgemeinheit auf Märkten auch in großen Mengen und zu fairen Preisen für Bäuer*innen und Konsument*innen anbieten.
Übersetzung aus dem Portugiesischen: Barbara Leß-Correia Mesquita
Redaktion: Lateinamerika-Referat und Lena Luig
Dieser Beitrag erschien zuerst auf Portugiesisch im Agrarökologie-Dossier des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro.
Autor*innenkollektiv des lateinamerikanischen Agrarökologie Dossiers
Mitarbeiter*innen der Heinrich-Böll-Stiftung: Ingrid Hausinger (Büro San Salvador, Zentralamerika), Marcelo Montenegro (Büro Rio de Janeiro), Emilia Jomalinis, Joana Simoni, Maureen Santos (zuvor Büro Rio de Janeiro), Dolores Rojas und Jenny Zapata (Büro Mexiko-Stadt); Natalia Orduz Salinas (zuvor Büro Bogotá), Gloria Lilo (zuvor Büro Santiago de Chile), Pablo Arístide (Büro Buenos Aires)
Wissenschaftliche Mitarbeit: Rodica Weitzman, Marcus Vinicius Branco de Assis Vaz, Dulce Espinosa und Luis Bracamontes, Julián Ariza, Irene Mamani Velazco, Henry Picado Cerdas, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
Gastautor*innen: Giuseppe Bandeira, Júlia Dolce, Nemo Augusto Moés Côrtes
Quellen und weiterführende Literatur auf Spanisch bzw. Portugiesisch:
Érika Ramírez (2020). “Campo mexicano, atrapado entre el coyotaje agrícola y el transportista”. Contralínea.
Evelia Oble Vergara (2015). “Proceso de corte y comercialización de la naranja en el norte de Veracruz, México”. Ecodigma año 11.
Células de Consumidores Responsáveis (CCR)
Alberto Gómez Perazzoli et al (2018). Abastecimento alimentar redes alternativas e mercados institucionais. (orgs.). Chapecó: UFFS; Cabo Verde: UNICV.
Mariana Castillo (2019). “Producción de cacao en la Chontalpa”. El Universal.
Clara Craviotti y Paula Palacios (2013). “La diversificación de los mercados como estrategia de la agricultura familiar”. Revista de Econo- mia e Sociologia Rural vol. 51.
Fernando Alvarado et al. (2015). “Perú: Historia del movimiento agroecológico 1980-2015”. Agroecología vol. 10, n.° 2.
Gobierno de Canelones (2020). Soberanía, ciudadanía e identidad. Relato de la gestión de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones 2015-2020.
“Las rutas sanas del alimento”. Red Interregional de Nodos de Consumo Agroecológico.
Delphine Prunier et al. (eds.) (2020). Justicia y soberanía alimentaria en las Américas: desigualdades, alimentación y agricultura. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, École Urbaine de Lyon y Fundación Heinrich Böll.
Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca – REDMAC.