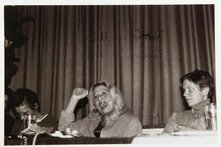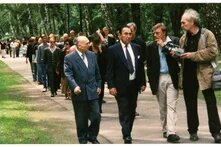KZ-Überlebende Sinti und Roma: Der schwere Weg zur Anerkennung
Ceija Stojka und Otto Rosenberg werden als Romni und Sinto verfolgt und ins KZ deportiert. Nach der Befreiung kehren sie nach Österreich und Berlin zurück. Doch die Stigmatisierung bleibt – und der Weg zu ihrer Anerkennung ist lang.
Wissenschaftliche Beratung: Insa Eschebach
Es ist Frühling 1945, als Otto Rosenberg mit Zehntausenden Häftlingen aus den frontnahen Konzentrationslagern nach Bergen-Belsen gebracht wird. Er ist 18 Jahre alt und ein Berliner Sinto. Mit neun Jahren war er in den sogenannten „Zigeunerplatz Marzahn“ eingewiesen worden, ein Zwangslager in Berlin. 1943 wurde er in das sogenannte „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau deportiert. Über das KZ Mittelbau-Dora und Buchenwald bringt man ihn nach Bergen-Belsen. „Eigentlich war ich mit der Kraft schon am Ende. Wenn ich meinen Arm hochhielt, sah ich, das war nur noch Knochen, mit Haut überzogene Knochen.“
Zwangslager Marzahn
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 begann die systematische Ausgrenzung und Verfolgung von Sinti*zze und Rom*nja. Im Zuge der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 1936 richtete die Berliner Polizei auf dem Gelände zwischen Parkfriedhof und Falkenberger Weg eines der ersten kommunalen Zwangslager ein.
Am 16. Juli 1936 wurden rund 600 Sinti*zze und Rom*nja von ihren Stellplätzen und aus ihren Wohnungen nach Marzahn gebracht und dort unter Bewachung der Polizei festgehalten. Etwa 1.000 Menschen lebten zeitweise in überfüllten Holzbaracken und Wohnwagen unter extrem schlechten Bedingungen. Mangelnde Versorgung und katastrophale Hygiene führten zu schweren Krankheiten.
Mit dem Befehl Heinrich Himmlers vom 16. Dezember 1942 begann die Deportation der in Deutschland verbliebenen Sinti*zze und Rom*nja. Ab März 1943 wurden sie aus Marzahn in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt.
Quelle:
KZ Ravensbrück
Im Dorf Ravensbrück bei Fürstenberg (Havel) befand sich von 1939 bis 1945 das größte Frauenkonzentrationslager im Deutschen Reich. Wie alle nationalsozialistischen Konzentrationslager unterstand auch das KZ Ravensbrück der Verwaltung und Kontrolle der SS. Neben dem Hauptlager richtete die SS 1941 auch ein Männerlager und 1942 ein Lager für jugendliche Mädchen ein.
Mehr als 140.000 Menschen wurden im KZ-Ravensbrück inhaftiert: 120.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1.200 weibliche Jugendliche. Die Gefangenen kamen aus über 30 Ländern, darunter aus Deutschland, Polen, Frankreich und Italien. Auch Jüdinnen und Juden sowie Sint*izze und Rom*nja aus ganz Europa wurden in Ravensbrück inhaftiert. Die Gefangenen mussten unter härtesten Bedingungen arbeiten, unter anderem in Werkstätten und Fabriken. Zehntausende starben an Mangelernährung, Krankheiten, Misshandlungen, medizinischen Versuchen, Erschießungen oder in der 1945 eingerichteten Gaskammer.
Kurz vor Kriegsende konnte das Rote Kreuz etwas 7.500 Häftlinge des KZ Ravensbrück evakuieren, während über 20.000 Häftlinge zu „Todesmärschen“ in Richtung Nordwesten gezwungen wurden. Am 30. April 1945 befreite die Rote Armee das Lager, in dem sich noch etwa 2.000 Menschen befanden.
Quelle:
Ceija Stojka ist elf Jahre alt. Seit einigen Wochen ist auch sie in Bergen-Belsen interniert. Sie stammt aus einer Roma-Familie, die in Österreich mit Pferden handelte. Man hatte ihr und ihren Verwandten den schwarzen Winkel angeheftet, für „Arbeitsscheue“. „Nun waren wir alle gekennzeichnet: der letzte Abschaum der Menschheit.“ Gemeinsam mit ihrer Familie wurde sie 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert, ein Jahr später wird sie in das Frauen-KZ Ravensbrück überstellt. Ihr Vater wurde 1941 in Dachau ermordet.
Otto Rosenberg (1927–2001)
Otto Rosenberg wuchs in Berlin bei seiner Großmutter auf und wurde 1936 mit anderen Berliner Sinti*zze und Rom*nja in das Zwangslager Berlin-Marzahn (damals „Zigeunerrastplatz Marzahn“ genannt) eingewiesen. Im April 1943 wurden der 16-Jährige und seine Familie in das KZ Auschwitz deportiert. Sein Vater, die Großmutter, seine zehn Geschwister und weitere Verwandte kamen im Porajmos, dem Völkermord an den Sinti*zze und Rom*nja, ums Leben. Otto Rosenberg überlebte außer Auschwitz auch die Konzentrationslager Buchenwald, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen, wo er – völlig entkräftet – befreit wurde.
Otto Rosenberg kehrte nach Berlin zurück, gründete eine Familie und engagierte sich in den folgenden Jahrzehnten politisch. Er war langjähriges Mitglied der SPD, Vorstandsmitglied im Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und Vater von vier Söhnen und drei Töchtern, darunter die Sängerin Marianne Rosenberg und Petra Rosenberg, langjährige Vorsitzende des Landesverbandes Berlin-Brandenburg der Deutschen Sinti und Roma.
Im Jahr 1998 erschienen seine Erinnerungen, aufgezeichnet von Ulrich Enzensberger, unter dem Titel „Das Brennglas“.
Biographische Skizze von Insa Eschebach.

Ceija Stojka (1933–2013)
Ceija Stojka wuchs in einer Familie auf, die den Lovara-Roma angehörte und als Pferdehändler durch Österreich reiste. Nachdem ihr Vater 1941 in das KZ Dachau deportiert worden war, wurde Ceija gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Kathi 1943 im sogenannten Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau interniert und von dort 1944 in das Frauen-KZ Ravensbrück überstellt. Das Kriegsende und ihre Befreiung erlebte die damals 11-Jährige im KZ Bergen-Belsen und kehrte von dort gemeinsam mit ihrer Mutter zurück nach Österreich, wo Ceija ihre Schwestern Kathi und Mitzi wieder traf. Von ihrer Großfamilie, die etwa 200 Personen umfasste, überlebten sechs die NS-Verfolgung.
Im Nachkriegs-Österreich lebte Ceija Stojka als Marktfahrerin vom Verkauf von Teppichen, brachte drei Kinder zur Welt und veröffentlichte 1988 ihr erstes Buch „Wir leben im Verborgenen. Erinnerungen einer Rom-Zigeunerin“; 1992 folgte der Band „Reisende auf dieser Welt. Aus dem Leben einer Rom-Zigeunerin“. 1989 begann sie zu malen, u.a. Szenen aus den Konzentrationslagern. Ihre Werke wurden in Deutschland, Österreich, Tschechien und Japan ausgestellt.
Ceija Stojka ist für ihr Lebenswerk mehrfach ausgezeichnet worden, u.a. 2005 mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich.
Biographische Skizze von Insa Eschebach.

Panzer, die durch Zäune brechen
Ceija sieht, wie die riesigen Tannenbäume unter lautem Krachen hinter dem Zaun fallen. Ein Panzer durchbricht das Lagergitter und rollt bis zu ihr. Ceija zittert am ganzen Körper. Ein Soldat kommt auf sie zu: „Ich bin Engländer. Ihr seid jetzt alle frei.“ Er bindet ihr eine Fahne als Schürze um und gibt ihr Brot, Konserven, Käse und Zigaretten. Sie läuft damit zu ihrer Mutter.
„Wo hast du das gestohlen? „Ich habe nicht gestohlen. Die Engländer sind schon da. Schau, du musst vor die Toten gehen, dann wirst du es sehen.“
Die britischen Truppen befreien das Konzentrationslager Bergen Belsen am 15. April 1945. Sie versorgen Otto mit Knäckebrot und rühren etwas Nahrhaftes aus dem an, was sie haben, „Schokoladensuppe oder etwas Ähnliches“. Otto hat Angst vor den Uniformierten. Zusammen mit seinem Onkel, seinem Cousin und einem weiteren Mann macht er sich auf in Richtung Lüneburger Heide.
Nach wenigen Tagen heißt es im Lager: „Los, alles auf die Lastwagen. Das Lager Bergen-Belsen wird von uns angezündet, wegen Seuchengefahr.“ Es brennt schon, als Ceija und ihre Mutter auf die Lastwagen springen.
Ein Schiff als Herberge und ein KZ als Auffanglager
Von überall schallt das Rattern der Maschinengewehre über die Lüneburger Heide. Nach wenigen Kilometern bricht Otto zusammen und erwacht erst wieder in einem Krankenhaus in Celle. Panisch will er aus dem Bett klettern. Jemand legt ihm beruhigend Hände auf seinen Brustkorb und drückt ihn sanft zurück ins Kissen: „Sie brauchen keine Angst mehr zu haben“, sagt eine Krankenschwester. „Sie sind jetzt frei. Es ist vorbei. Es ist vorbei.“
Die Engländer bringen die befreiten Frauen „in schöne Neubauhäuser“, in denen SS-Männer gelebt hatten. Ceija und ihre Mutter bekommen Kleider, Schuhe, Mäntel und Mützen „und alles, was ein Mensch braucht“. Sie bleiben einige Wochen, dann fahren sie „mit Fuhrwerken, Lastautos, Kohlenzügen, mit allem Möglichen, was Räder hatte, heimwärts in Richtung Österreich, mit der Hoffnung, unsere Angehörigen wiederzufinden“.
Nach mehreren Wochen ist Otto wieder kräftig genug, um mit seinem Cousin Willi in Richtung Berlin aufzubrechen. Sie marschieren mehrere Tage durch die Heide, bis sie ein Bauernhaus erreichen und dort Quartier nehmen.

Sie fangen ein Pferd, beackern ein Feld und spielen mit den Kindern, die Bäuerin verpflegt sie. Die kurze Zeit dort verändert ihn, wie er später erzählen wird: Er sei voller Rachegefühle gegenüber den Deutschen gewesen. Doch er besinnt sich auf seinen Glauben.
„Ich war, als ich sie verließ, ein anderer Mensch geworden. Wenn auch noch nicht ein ganz normaler. Ein bisschen meschugge war ich noch immer.“
Ceija und die anderen erreichen Linz. So wie die Roma seit jeher ihre Orte hatten, an die sie wiederkehrten, war die Urfahrbrücke als Treffpunkt ausgemacht worden, für diejenigen, die den Krieg überstehen würden.
Als sie dort ankommen, lagern schon einige Männer und Frauen dort. „Sie alle waren uns bekannt.“ Ein verlassenes Schiff am Ufer dient ihnen als Herberge.
Otto und Willi gelangen auf ihrem Weg zum ehemaligen KZ-Außenlager Salzwedel, das nun ein britisches DP-Lager ist. Man stellt ihnen Pässe aus, „mit roter Tinte kamen unsere Daumenabdrücke drauf“, und gibt ihnen reichlich Essen. Otto weiß, er will hier so schnell es geht weg: „Solange wir immer nur auf Lagerinsassen stießen, war unsere Gefangenschaft nicht vorbei“. Er lernt eine junge ungarische Romni kennen. Gemeinsam gelangen sie an die Elbe. Dort steigen sie in einen Zug nach Berlin.
An einem warmen Frühlingstag sucht Ceija nach vierblättrigen Kleeblättern. Als sie aufblickt, sieht sie einen Punkt am Horizont, der sich auf sie zubewegt. „Schau, da kommt jemand!“, ruft sie ihrer Mutter zu. Es ist ihre Schwester Mitzi. „Man kann sich diese Freude denken! Sie hatte ein rotes Dirndlkleid an, ihre Haare waren noch ganz kurz, lauter kleine Löckchen hatte sie auf dem Kopf. Nun waren wir nicht mehr allein.“
Sie bleiben noch einige Tage mit den Rückkehrern zusammen. Dann werden zwei Pferde vor einen Wagen gespannt. „Sie nahmen uns mit nach Wien, wo wir nach einigen Tagen ankamen.“
Rückkehr nach Berlin und Wien: Ein zerstörtes Zuhause
In Berlin sucht Otto das Lager in Marzahn auf. Niemand ist mehr dort, und es ist zum Teil abgebrannt. Er findet Unterschlupf bei seiner Tante, die in einer Laube in Friedrichsfelde lebt. Die Familie zieht nach Britz, ein Ort, an dem die „Bewohner alle Nazis gewesen waren“, die Häuser stehen nun leer. Sie leben dort eine Weile, doch er will nicht in den Häusern der Deutschen bleiben.
Um Lebensmittelkarten zu erhalten, muss sich Otto beim Arbeitsamt melden. Er erhält den Auftrag, Rohre zu verlegen, „eine Arbeit wie im KZ“. Er lehnt ab:
„Wie schnell die wieder auf uns gekommen sind! Dass wir so schwer arbeiten sollten! Die Nazis saßen hinter den gleichen Schreibtischen, hinter denen sie vorher gesessen waren.“
Als Ceija, ihre Mutter und ihre Schwestern in Wien ankommen, finden auch sie ihr Zuhause zerstört vor. Sie kommen bei Bekannten unter, dann weist man ihnen eine verlassene Wohnung im neunzehnten Bezirk zu. Ceija findet es schön dort, doch sie müssen sie bald wieder verlassen, wie die nächste auch. „Circa vier Monate waren wir dort. Dann ist entnazifiziert worden und die Nazis sind wieder zurückgekommen.“
Otto sucht Rückkehrer auf, hoffend, jemand wisse etwas über seine Familie. Polinnen aus Ravensbrück versichern ihm, seine Mutter lebe noch, sie sei sogar in Berlin. Als er sie findet, nimmt er sie fest in den Arm: „Was ist mit den anderen?“, fragt er. „Die sind alle tot.“ Sein Vater, die Großmutter, seine zehn Geschwister und weitere Verwandte wurden ermordet. Sie und bis zu einer halben Million weitere Menschen sind dem Porajmos, dem Völkermord an den Sinti und Roma, zum Opfer gefallen. Nur etwa fünftausend der Deportierten überleben.
Ottos Gefährtin will zurück nach Ungarn, sie fühlt sich einsam, und sie versteht nicht, wie man in Deutschland bleiben kann. Sie tritt die Heimkehr an, doch Otto bleibt in Berlin. Seine Mutter hat überlebt, aber sie ist sterbenskrank.
Eines Tages steht ein Mann vor der Tür der Stojkas. „Ich war mit euren zwei Brüdern im KZ, wir sind miteinander befreit worden. Hansi und Karli geht es ganz gut, sie sind noch in Deutschland“, sagt er. Ceija und ihre Familie lachen und weinen und tanzen. Einige Tage später sind sie zu sechst, zwei Brüder, drei Mädchen und die Mutter. Neben dem Vater wurde auch ihr jüngster Bruder Ossi im Konzentrationslager ermordet. Sechs von zweihundert Menschen, die zu ihrer Großfamilie gehörten, haben überlebt.
In Wien beginnt der Wiederaufbau, doch für die Familie ist kein Platz. Sie zieht im Winter 1945 in ein Waaghaus in Preßbaum bei Wien, das ein Mann ihnen überlässt.
„Mama erzählte ihm unsere Lage, es traf ihn so sehr, dass er Mama den Wohnwagen schenkte, und noch dazu konnten wir ihn auf seinem Grund stehen lassen. Das war wieder ein gutes Zeichen, um nicht ganz zu verzweifeln. Irgendwie geht es doch weiter.“
Otto beteiligt sich an Schwarzmarktgeschäften auf dem Alexanderplatz und dem Rosenthaler Platz. Er und ein Freund helfen, den Schutt in den zerstörten Straßen wegzuräumen. Sein Freund ist erbost darüber. „Habe ich das kaputtgeschlagen, oder wer?“ Otto sieht das anders, „Berlin ist doch unsere Stadt“.

Er fährt immer wieder aufs Land, um zu hamstern. In Röbel, wenige Stunden nördlich von Berlin, lernt er eine Sintezza kennen. Sie war wie er in Auschwitz-Birkenau gewesen und in Ravensbrück inhaftiert.
Otto zieht zu ihr und ihrer Verwandtschaft in eine Baracke im Wald. Fast nur Frauen sind dort, die er immer wieder gegen Fremde beschützt. Otto verdient sich etwas, indem er Pferde auf dem Land erwirbt und in der Stadt verkauft, bis der Magistrat den Handel untersagt.
Ceijas Mutter lernt einen Mann kennen, und sie entschließen sich, wieder loszuziehen. Im April 1947 fahren sie in einem offenen Pferdewagen los. „Von jetzt an waren die Landstraßen, die Wiesen und Wälder unser Zuhause.“
Sie ziehen von einem Wiesenmarkt zum nächsten, tauschen Waren mit den Landwirten und überwintern in Gasthöfen, wo Ceija fleißig lesen übt. Schon bald bekommt Ceija eine kleine Schwester.
Als sie in die Zone der Sowjets hinübergelangen wollen, werden Ausweise verlangt. Ceija hat keinen, da sie minderjährig ist, aber man glaubt ihr nicht. Sie fahren zum Amt nach Jois, dem Heimatort von Ceijas Mutter. „Ja, den Identitätsausweis kann ich dir schon ausstellen“, sagt der Beamte. „Aber höre jetzt gut zu, du Zigeunerin. Dass du dir ja nicht erlaubst, irgendwann einmal bei unserer Gemeinde zu betteln. Hast du mich verstanden? Ich will dich hier bei uns nie wieder sehen!“ Als Cejia das Amt verlässt, denkt sie: „Mein Gott, ist dieser Mensch arm, arm an seinem eigenen verbissenen Leben.“
Das Leben in der Nachkriegsgesellschaft: Keine Entschädigung und späte Anerkennung
Nach sieben Jahren trennt sich Otto von seiner Freundin. „Sie konnte keine Kinder bekommen. Man hatte ihr im KZ übel mitgespielt. Da wir keine Familie waren, war kein rechter Zusammenhalt da.“ Er zieht zurück nach Berlin in einen Wohnwagen. Bald lernt er Christel kennen. Sie heiraten 1953 und bekommen sieben Kinder. Er geht viel aus und trinkt, aber fängt sich. Christel hilft ihm, sich zu erden.
„Sie war in meinem Leben immer der ausgleichende Pol. Denn was mir andere Böses angetan hatten nach Willkür der Deutschen, das hat sie mir Gutes getan.“ (Otto Rosenberg)
Immer wieder fragen ihn seine Kinder, was die Nummer, die auf seinen Arm tätowiert ist, bedeutet. „Ich kam nicht zur Ruhe“. Schließlich lässt er ein Motiv darüber stechen. „Jetzt verdeckt ein Engel diese Schande, und: Er schützt davor, dass sich all die schlimmen Dinge, die damals passieren, wiederholen.“
Ceija ist inzwischen Mutter geworden, ihr Sohn wächst ohne Vater auf. Später lernt sie einen Mann kennen, der zu ihr in den Wohnwagen zieht. Sie führt ihn ins Geschäft ein, und sie bekommen zwei Kinder, die sie allein großzieht. „Zwischen Arbeiten und dem Großziehen der Kinder verging die Zeit. Und obwohl ich immer jemanden hatte, war ich trotzdem immer allein.“
„Bald kam der Wohlstand ins Land, und das Von-Haus-zu-Haus Geschäft ging auch vorbei.“

Ceijas kleine Schwester Kathi erhält einen Gewerbeschein, die Familie kann nun Teppiche auf den Märkten verkaufen. Auch Ceija wird Marktfahrerin und lebt mit ihren drei Kindern in einer Wohnung in Wien. „Endlich brauchten wir uns nicht mehr zu schämen, und die Tafel mit der Aufschrift ‚Betteln und Hausieren verboten‘ zählte ab nun nicht mehr für uns.“
In den Fünfzigerjahren stellt Otto einen Antrag auf Entschädigung. „Zigeuner. Wanderbetrieb. Hat keine Bindung an die Stadt Berlin“, heißt es in der Ablehnung, er wäre „kein echter Deutscher“. Als er eine Wiedergutmachung für die Ermordung seiner Familie beantragt, soll er Nachweise bringen. Doch die Nazis hatten seiner Familie alle Papiere genommen. „Sagen Sie uns, wo ihre Mutter begraben liegt. Dann müssen wir eine Exhumierung vornehmen“, sagt der Beamte. Otto wirft den Schreibtisch um und schreit. Er erhält nur einen Bruchteil des Geldes, das ihm zugestanden hätte. Für seine ermordete Familie erhält er nichts.

1986 interviewt die Dokumentarfilmerin Karin Berger Ceija und ihre Schwester Kathi. Ceija übergibt ihr ihre Erinnerungen, die sie auf Zettel notiert hat. „Wir leben im Verborgenen. Erinnerungen einer Rom-Zigeunerin” erscheint 1988.
Es sind die ersten veröffentlichten Erinnerungen einer Romni in Österreich. Ceija ist als Zeitzeugin gefragt. Sie reist mit Karin Berger für Lesungen quer durchs Land und erhält zahlreiche Auszeichnungen.
Otto tritt in die SPD ein und wird Vorstandsmitglied im Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. „Er wollte lange nicht, dass wir in der Öffentlichkeit über unsere Familiengeschichte sprechen“, wird seine Tochter, die Sängerin Marianne Rosenberg, später erzählen.
In den Neunzigerjahren zeichnet Otto schließlich mit dem Schriftsteller Ulrich Enzensberger seine Erinnerungen auf. 1998 erscheinen sie unter dem Titel „Das Brennglas“. Petra Rosenberg tritt in die Fußstapfen ihres Vaters und wird Vorsitzende des Landesverbandes der Deutschen Sinti und Roma Berlin-Brandenburg.
Otto Rosenberg stirbt 2001 mit 74 Jahren in Berlin. Sechs Jahre nach seinem Tod werden in Marzahn ein Platz und eine Straße nach ihm benannt – dort, wo einst Sinti und Roma interniert worden waren. Auf Initiative seiner Tochter Petra Rosenberg befindet sich an diesem Ort heute die Gedenkstätte Zwangslager Berlin-Marzahn.
Zeit ihres Lebens gibt Ceija die Traditionen und Musik der Roma an ihre Kinder und Kindeskinder weiter. Wenn sie von ihren Nachkommen umgeben sei, sagt sie, sehe sie ihre Vorfahren lebendig werden. Ceija Stojka stirbt 2013 in Wien. Sie wurde 80 Jahre alt.